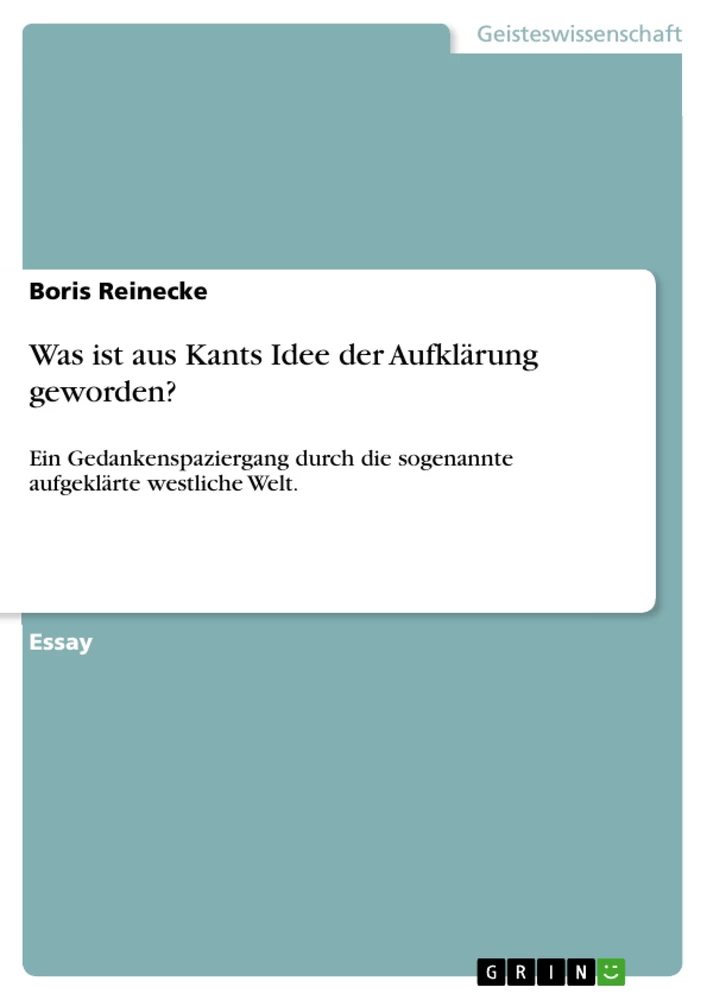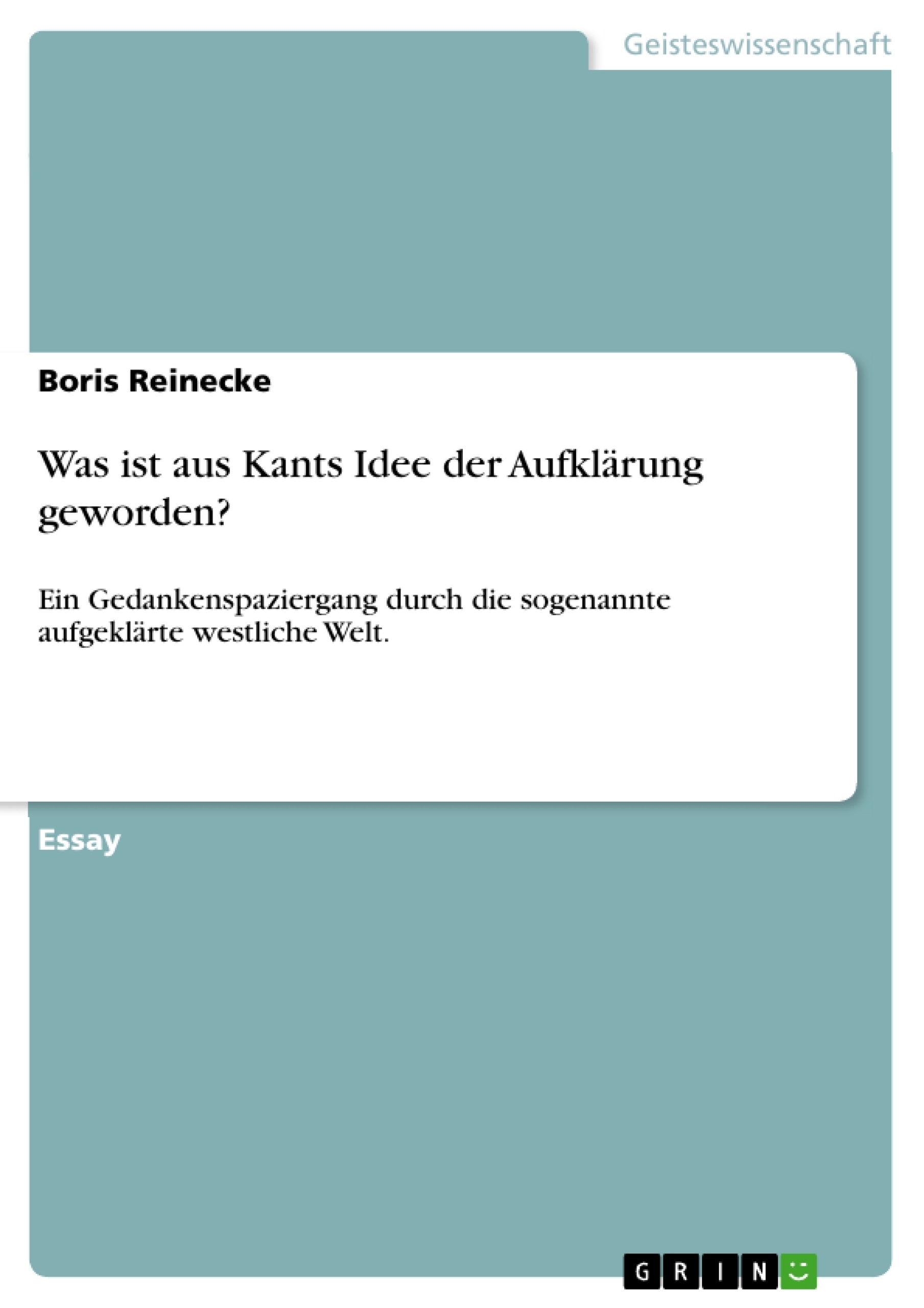Eine Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Realität eines Deutschlands nach der Epoche der Aufklärung.
Ohne Beißhemmungen und "fachliche Distanz" wird der Zustand der heutigen Bundesrepublik an den Verheißungen des aufklärerischen Ideals gemessen.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist aus Kants Idee der Aufklärung geworden?
- Ein Gedankenspaziergang durch die sogenannte aufgeklärte westliche Welt
- Ein Essay als Prüfungsleistung für das Seminar Kultur und Bildung (Sol-SM 01) bei Dr. Ehrhardt Cremers
- Nach Immanuel Kant ist die Sache mit der Aufklärung an sich keine besonders komplizierte
- Alles was es braucht, um ein aufgeklärter Mensch zu sein, ist die Benutzung des eigenen Verstandes ohne Führung durch einen Dritten
- Selbständiges Denken also ist es was Aufklärung ausmacht
- Damit dieser Prozess in Gang gesetzt werde, hat Kant sich gedacht, dass es ein Freiheitsrecht braucht, das den öffentlichen Gebrauch des eigenen Verstandes ermöglicht
- Dieses Recht kennen wir heute als das Recht auf freie Meinungsäußerung
- Weiterhin stellte Kant sich Aufklärung so vor, dass nicht jedes Individuum für sich beginnt selbständig zu denken, da dazu ihm zufolge den meisten der Mut fehle, sondern einzelne Vormünder zur Überzeugung kämen, es sei für alle Beteiligten von Vorteil, wenn jeder Mensch selbständig denke und sie daher ihren Untertanen die Freiheit dazu lassen und sie gewissermaßen dazu anleiten ihren eigenen Verstand zu gebrauchen
- Kant wünschte sich demnach also eine gesamtgesellschaftliche Aufklärung, nicht bloß eine der Bildungseliten oder ähnliches
- Interessant ist Kants Differenzierung zwischen öffentlichem Gebrauch seines Verstandes und privatem
- So findet er ersteren für die Aufklärung unverzichtbar, solange man als „Priwalqelchricr" zur Öffentlichkeit, also nicht bloß 711 seinem Stammtisch oder einem erlesenen Zuhörerkreis, spricht
- Der private Gebrauch des Verstandes darf, wenn es nach ihm geht, jedoch durchaus eingeschränkt werden, ohne damit dem Geiste der Aufklärung widersprechen
- Kant ist der Ansicht, dass Ämter und Berufsrollen prinzipiell kritiklos ausgeführt werden sollten, da dies zum Funktionieren des Staates notwendig sei
- Hat jemand etwas an seinem Beruf, beziehungsweise innerhalb seines Berufs zu kritisieren, nehmen wir zum Beispiel einen Berufssoldaten, der von seinen Vorgesetzten in einen sinnlosen Krieg geführt werden soll, so hat dieser Soldat 7unächst seine Rolle zu ende auszuführen, bevor er sich dann außerhalb seiner Dienstzeit an die Öffentlichkeit wenden und seine Kritik äußern kann
- Besonders vernünftig klingt das zunächst nicht, da Kritik an sich ja unabhängig von der Situation in der sie geäußert wird entweder zutrifft oder dies nicht tut (vgl. Kant 1784)
- Heutzutage wird Aufklärung vor allem als Alleinstellungsmerkmal westlicher, demokratischer und säkularisierter Gesellschaften hervorgehoben, wenn in öffentlichen Debatten mal wieder die Frage aufkommt, warum manche Gesellschaften im nahen Osten eben nicht so demokratisch und säkular organisiert sind, wie die zuerst genannten
- Oftmals heißt es dann, diese Gesellschaften müssten erst noch die Aufklärung nachholen, die Zustände in ihnen seien mittelalterlich, wobei gerne übersehen wird, dass manche Länder des nahen Ostens von den sogenannten aufgeklärten westlichen Mächten nicht nur ins Mittelalter, sondern quasi bis in die Steinzeit zurück gebombt wurden
- Diese Spielart des Kulturchauvinismus soll allerdings nicht näher behandelt werden, sondern stattdessen sei der Blick auf die angeblich aufgeklärte deutsche Gesellschaft geworfen, die ja bekanntlich zur westlichen Welt gezählt wird
- In einer aufgeklärten Gesellschaft müsste es von mündigen Bürgern nur so wimmeln, die zum Wohle der Allgemeinheit in öffentlichen Diskursen Themen besprechen, die für die Gesellschaft als ganze von Belang sind
- Die Menschen wären immun gegen Religionen und Ideologien, die ihnen das selbständige Denken abgewöhnen oder unmöglich machen könnten, Wissenschaft und Technik, als Mittel und Werkzeuge zum besseren Verständnis der Welt würden ohne Unterlass vorangetrieben
- Die mündigen Bürger, wenn man sie in der Breite der Gesellschaft sucht, findet man heute wohl vor allem in den Leserbriefrubriken tagesaktueller und wöchentlich erscheinender Zeitungen sowie Zeitschriften, oder in den entsprechenden Kommentarbereichen der Webpräsenzen dieser Printmedien, dazu in Blogs und Webforen; kurz gesagt überall dort, wo man ungefragt und ungehindert seine Meinung kundtun kann, ohne für die jeweiligen Inhalte verantwortlich gemacht zu werden
- Angesichts des häufig eher polemischen Tons und der teilweise reaktionär anmutenden Ansichten, die dort vertreten werden, haben diese mündigen Bürger allerdings kein wirklich großes Publikum, auch wenn sie rein technisch wohl Millionen erreichen könnten
- Anders sieht es aus, wenn man sich damit zufrieden gibt, in den oberen Schichten der Gesellschaft nach jenen zu schauen, die gesellschaftliche Diskurse vorantreiben
- Feuilletonisten, Künstler, Schriftsteller, Schauspieler, jene die man gemeinhin Intellektuelle nennt, wenden sich häufig an die Öffentlichkeit und werden dank ihrer Bekanntheit meist auch entsprechend rezipiert
- Allerdings werden manche öffentlichen Stellungnahmen, wie solche von Jean Ziegler oder weiland Pierre Bourdieu, besonders dann, wenn sie vom vorherrschenden Meinungsbild abweichen, nahezu ignoriert
- Dabei lassen besonders solche Äußerungen ja vermuten, dass sie das Produkt eigener Überlegungen sind
- Andere Intellektuelle, wie Günter Grass, können selbst Gedichte veröffentlichen, die keine sind, 711 einem Thema das sich in so kurzer Form auch nur dann behandeln lässt, wenn man es dabei belässt die allerschlichtesten Gedanken zu äußern
- Mit einer aufgeklärten Gesellschaft hat dies nun aber auch nichts zu tun, Kant wollte eine gesamtgesellschaftliche Aufklärung und keine Ansammlungen von Wutbürgern die Leserbriefe verfassen, oder eine Elite von Gebildeten, die von Zeit zu Zeit von ihrem Elfenbeinturm zum einfachen Volke sprechen
- Wobei trotz aller Polemik diesen beiden Phänomenen nicht die Existenzberechtigung abgesprochen werden soll
- Besonders die öffentliche Äußerung Intellektueller kann Vorteile haben, wie schon Emile Zolas Schrift mit dem Titel J'accuse zur Dreyfus-Affäre zeigte
- Von mündigen Bürgern könnte auch erwartet werden, dass sie die Möglichkeiten demokratischer Partizipation zumindest kennen, wenn nicht gar nutzen
- Tatsächlich werden unzählige Petitionen und Unterschriftenlisten bei entsprechenden Stellen eingewicht, in der Hoffnung so ein wenig Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen zu können
- Jedoch haben die wenigsten Erfolg, da sie nicht in genügend großer Zahl unterzeichnet wurden, oder die Berücksichtigung dieser einfach nicht verpflichtend ist
- Für viele Menschen ist jedoch schon der regelmäßige Urnengang von vollkommen zu vernachlässigender Relevanz, was die teilweise erschreckend niedrigen Wahlbeteiligungsquoten verdeutlichen
- Es tut sich der Gedanke auf, dass Deutschland weniger aus Überzeugung demokratisch ist, als aus Gewohnheit
- So scheint es, als sei Deutschland weniger ein aufgeklärtes Land, als eines, dass die Epoche der Aufklärung hinter sich hat, dieses Erbe aber keineswegs zu bewahren sucht
- Der Gedanke der Aufklärung konnte sich selbstverständlich nicht ohne weiteres von Generation zu Generation weitertragen
- Stattdessen hätte es zum Beispiel eines Bildungssystems bedurft, dass nicht ausschließlich danach geformt wurde, aus Schülern und Studenten möglichst schnell wirtschaftlich verwertbares Humankapital zu machen, nach unterschiedlichen Verwertbarkeitsgraden zu differenzieren und diejenigen die nicht zu gebrauchen sind, ohne weiteres auszulesen
- Die primäre Aufgabe hätte sein müssen, den Schülern und Studenten selbständiges Denken beizubringen
- Dazu benötigt es jedoch Zeit, Personal und möglicherweise auch andere Wege der Leistungsermittlung als ein schlichtes Notensystem
- Statt im Dienste der Aufklärung zu stehen, hat sich das Bildungssystem also dem Kapitalismus als Steigbügelhalter angedient
- Statt etwas für Menschen aus Fleisch und Blut zu bewirken, ging es um Absolventenzahlen und vergleichbare Abschlüsse
- Angesichts des Wohlstands unserer Gesellschaft stellt sich allerdings die Frage, ob dieser Mangel an selbständig denkenden Menschen überhaupt ein Problem darstellt, oder der Erfolg der Unmündigkeit recht gibt
- Vielleicht ist der Gedanke der Aufklärung schon längst obsolet und nur noch ein Hirngespinst anachronistischer Idealisten, die sich einbilden, die Welt würde zu einer besseren, wenn man nur ordentlich über sie nachdenken könne
- Literatur
- Kant, Immanuel, 1784: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Berlinische Monatsschrift S. 481494. http://wuw.uni potsdam,de/u/philosophie/texte/kant/auiklaer. htm. Letzter Zugriff: 06. 04. 2012.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay analysiert, wie die Idee der Aufklärung von Immanuel Kant in der heutigen Gesellschaft, insbesondere in Deutschland, umgesetzt wird. Der Autor befasst sich mit der Frage, ob die westliche Welt tatsächlich aufgeklärt ist und welche Herausforderungen die Umsetzung der Aufklärung im 21. Jahrhundert mit sich bringt.
- Der öffentliche und private Gebrauch des Verstandes
- Die Rolle der Medien und Intellektuellen in der Gesellschaft
- Die Bedeutung von Bildung für die Aufklärung
- Die Herausforderungen der Demokratie und Partizipation in der heutigen Zeit
- Die Frage, ob die Aufklärung obsolet geworden ist
Zusammenfassung der Kapitel
Der Essay beginnt mit einer kurzen Einführung in Kants Idee der Aufklärung. Er beschreibt die Bedeutung des selbständigen Denkens und die Rolle des öffentlichen und privaten Gebrauchs des Verstandes. Der Autor argumentiert, dass die heutige Gesellschaft zwar die Freiheit der Meinungsäußerung genießt, aber die Umsetzung der Aufklärung in der Breite der Gesellschaft fraglich ist.
Im weiteren Verlauf des Essays untersucht der Autor die Rolle der Medien und Intellektuellen in der Gesellschaft. Er kritisiert die häufig polemische und reaktionäre Art der öffentlichen Debatten in den Medien und stellt die Frage, ob die Intellektuellen tatsächlich einen Beitrag zur Aufklärung leisten. Der Autor argumentiert, dass die Intellektuellen oft nur in ihren eigenen Kreisen diskutieren und die breite Masse der Bevölkerung nicht erreichen.
Der Essay beleuchtet auch die Bedeutung von Bildung für die Aufklärung. Der Autor kritisiert das Bildungssystem, das eher auf die Ausbildung von wirtschaftlich verwertbarem Humankapital ausgerichtet ist, als auf die Förderung des selbständigen Denkens. Er plädiert für ein Bildungssystem, das die Schüler und Studenten befähigt, kritisch zu denken und sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen.
Schlussendlich stellt der Essay die Frage, ob die Aufklärung obsolet geworden ist. Der Autor argumentiert, dass die heutige Gesellschaft zwar Wohlstand genießt, aber gleichzeitig von einem Mangel an selbständig denkenden Menschen geprägt ist. Er fragt sich, ob die Unmündigkeit der Menschen ein Problem darstellt oder ob der Erfolg der Gesellschaft zeigt, dass die Aufklärung überholt ist.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Aufklärung, Immanuel Kant, selbständiges Denken, öffentlicher und privater Gebrauch des Verstandes, Medien, Intellektuelle, Bildung, Demokratie, Partizipation, Wohlstand, Unmündigkeit und Obsoletwerden der Aufklärung.
- Citar trabajo
- Boris Reinecke (Autor), 2012, Was ist aus Kants Idee der Aufklärung geworden?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215921