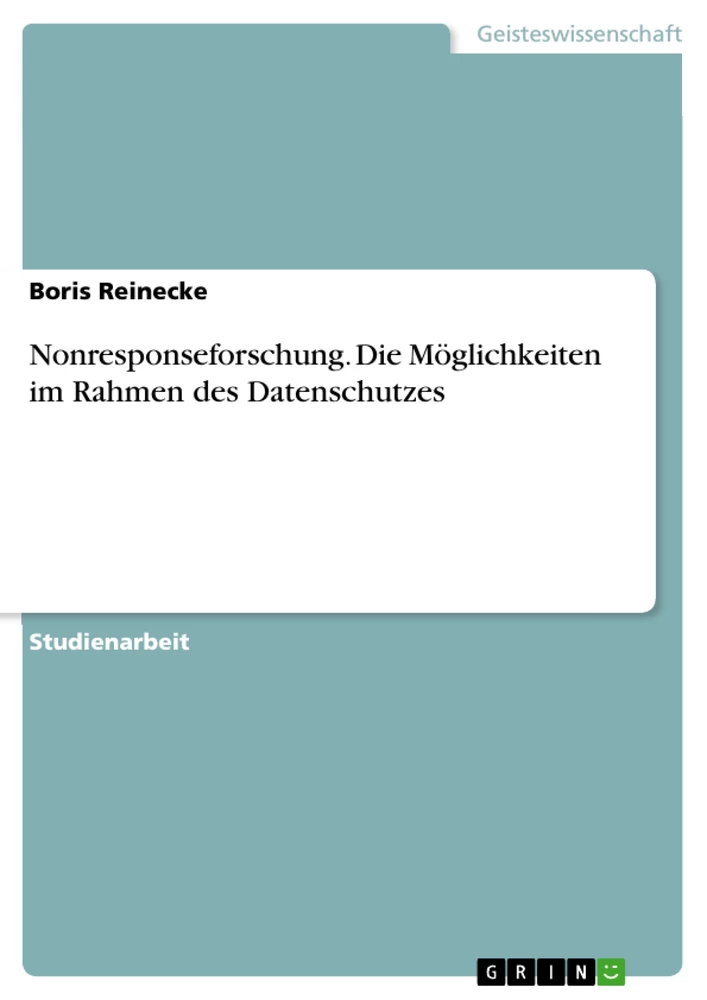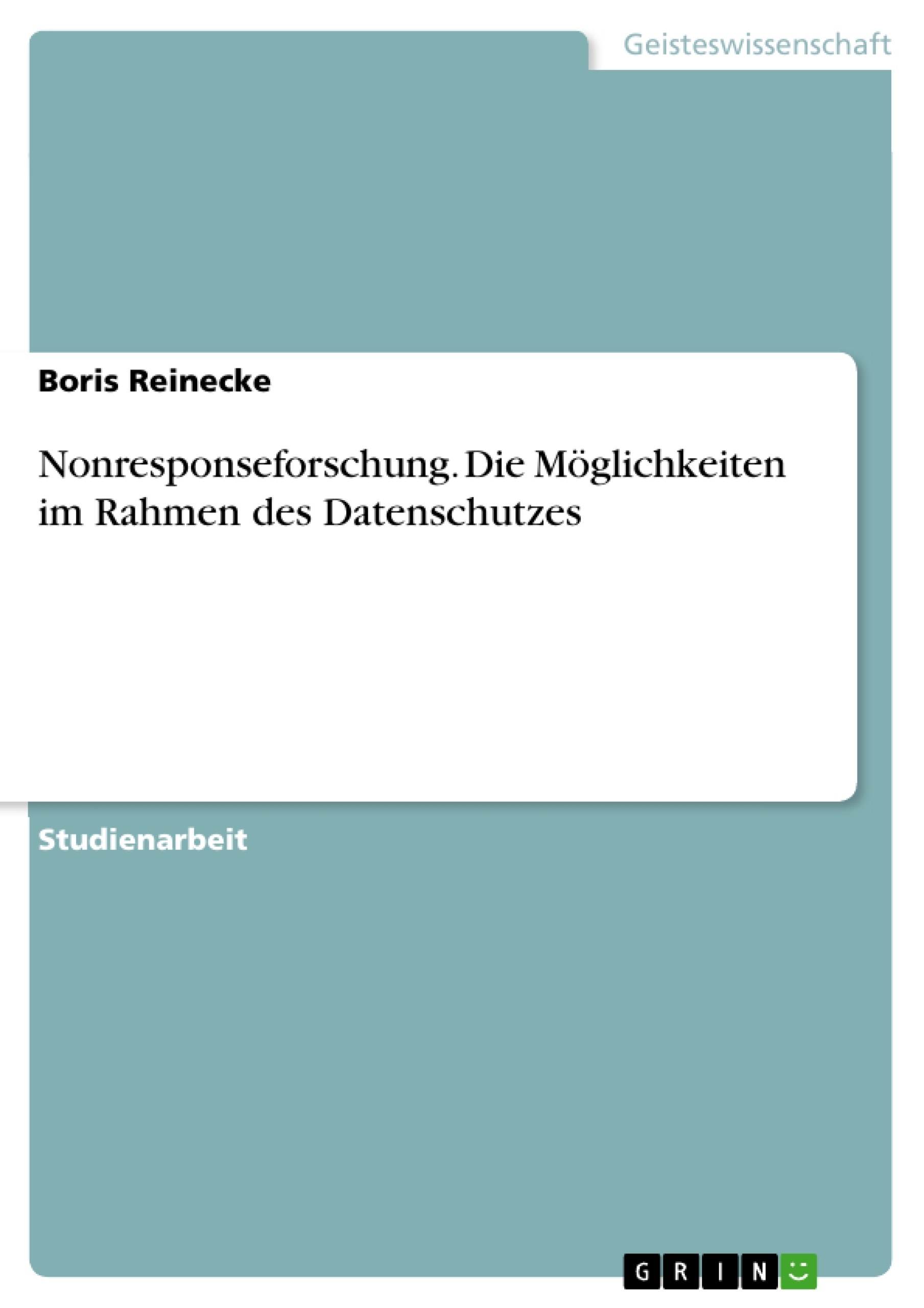Wie in jedem Bereich der sozialwissenschaftlichen Forschung, so ist auch im Bereich der Nonresponseforschung die Beachtung und Kenntnis geltender Vorgaben zur Wahrung des Datenschutzes unerlässlich. Angesichts des besonderen Forschungsgegenstandes, nämlich jenen Personen, die sich Befragungen verweigern, kann davon ausgegangen werden, dass hier ganz besondere Sorgfalt hinsichtlich des Datenschutzes zu wahren ist. Denn fragwürdige Methoden könnten dazu beitragen, das öffentliche Bild von sozialwissenschaftlicher Forschung unnötig zu schädigen, so wie sich beispielsweise sogenannte Telemarketingstrategien, wie Werbeanrufe und ähnliches, negativ auf die Akzeptanz telefonischer Befragungen zu Forschungszwecken auswirken.
Diese Arbeit wird einen Überblick darüber bieten, was der Nonresponseforschung im Rahmen des Datenschutzes in der BRD möglich beziehungsweise nicht möglich ist. Dazu werden nach einem kurzen einführenden Exkurs zu den Grundsätzen des Datenschutzes einige gängige methodische Ansätze daraufhin evaluiert, ob und wie sie mit den Prinzipien des Datenschutzes kollidieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Datenschutz in der Nonresponseforschung
- Grundsätzliches zum Datenschutz in der BRD
- Methoden der Nonresponseforschung aus der Perspektive des Datenschutzes
- Vergleich von Aggregatstatistiken mit Stichprobenergebnissen
- Individueller Abgleich mit Zensusdaten
- Individueller Abgleich mit Sampling-Frame-Daten
- Vergleich von Daten ehemaliger Panelteilnehmer
- Extrapolation auf Grundlage der Schwierigkeit des Interviews
- Interviewer-schätzungen
- Angegebene Verweigerungs- und Teilnahmegründe
- Angaben konvertierter Verweigerer
- Schlussbemerkungen
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Nonresponseforschung im Kontext des Datenschutzes in Deutschland. Der Fokus liegt auf der Analyse gängiger Forschungsmethoden und ihrer Vereinbarkeit mit den Prinzipien des Datenschutzes. Die Arbeit zielt darauf ab, zu klären, welche Methoden datenschutzrechtlich zulässig sind und welche nicht.
- Grundsätze des Datenschutzes in Deutschland
- Bewertung verschiedener Nonresponse-Methoden hinsichtlich ihrer Datenschutzkonformität
- Analyse der Herausforderungen des Datenschutzes für die Nonresponseforschung
- Diskussion von Möglichkeiten zur Bewältigung dieser Herausforderungen
- Bewertung der Bedeutung des Datentreuhänderprinzips für die Nonresponseforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Nonresponseforschung und die Bedeutung des Datenschutzes in diesem Bereich ein. Anschließend werden die grundlegenden Prinzipien des Datenschutzes in Deutschland erläutert, insbesondere die Prinzipien der Verhältnismäßigkeit, Datenvermeidung und Datensparsamkeit sowie die Bedeutung des informationellen Selbstbestimmungsrechts.
Im zweiten Kapitel werden verschiedene Methoden der Nonresponseforschung aus der Perspektive des Datenschutzes untersucht. Hierbei werden die Methoden nach ihrer Datenschutzkonformität bewertet. Es wird beispielsweise gezeigt, dass der Vergleich von Aggregatstatistiken mit Stichprobenergebnissen datenschutzrechtlich unbedenklich ist, während der individuelle Abgleich mit Zensusdaten aufgrund des Datenschutzes in Deutschland nicht ohne Weiteres möglich ist.
Das dritte Kapitel bietet Schlussbemerkungen und fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen. Es wird deutlich, dass das geltende Datenschutzrecht der Nonresponseforschung einige Hürden in den Weg stellt. Die Arbeit diskutiert die Bedeutung des Datentreuhänderprinzips als eine Möglichkeit, die Herausforderungen des Datenschutzes zu bewältigen und neue Erkenntnisse in der Nonresponseforschung zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Datenschutz, die Nonresponseforschung, die Methoden empirischer Sozialforschung, die Prinzipien des Datenschutzes, die Verhältnismäßigkeit, Datenvermeidung, Datensparsamkeit, das informationelle Selbstbestimmungsrecht, die Zensusdaten, der Sampling-Frame, das Datentreuhänderprinzip, die Forschungsfreiheit und die Persönlichkeitsrechte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Nonresponseforschung?
Die Nonresponseforschung untersucht Personen, die die Teilnahme an Umfragen verweigern, um die Qualität sozialwissenschaftlicher Daten zu verbessern und Verzerrungen in Stichproben zu minimieren.
Darf man Stichprobenergebnisse mit Zensusdaten abgleichen?
Ein individueller Abgleich mit Zensusdaten ist aufgrund des strengen Datenschutzes in Deutschland meist nicht ohne Weiteres möglich. Zulässig ist hingegen oft der Vergleich mit anonymisierten Aggregatstatistiken.
Welche Rolle spielt das "informationelle Selbstbestimmungsrecht"?
Es ist ein Grundpfeiler des Datenschutzes und besagt, dass jeder Einzelne grundsätzlich selbst entscheiden darf, wer wann welche Informationen über ihn preisgibt oder verarbeitet.
Was ist das Datentreuhänderprinzip?
Es ist ein Lösungsansatz, bei dem eine unabhängige Instanz Daten so verarbeitet oder anonymisiert, dass die Forschung ermöglicht wird, ohne die Identität der Befragten preiszugeben.
Sind Interviewer-Schätzungen datenschutzrechtlich unbedenklich?
Die Arbeit evaluiert verschiedene Methoden wie Interviewer-Schätzungen oder die Analyse von Verweigerungsgründen auf ihre Vereinbarkeit mit den Prinzipien der Datenvermeidung und Datensparsamkeit.
Wie beeinflussen Werbeanrufe die Akzeptanz der Forschung?
Fragwürdige Telemarketing-Methoden schädigen das öffentliche Bild der seriösen Forschung und führen dazu, dass immer mehr Menschen die Teilnahme an wissenschaftlichen Befragungen verweigern.
- Quote paper
- Boris Reinecke (Author), 2011, Nonresponseforschung. Die Möglichkeiten im Rahmen des Datenschutzes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215924