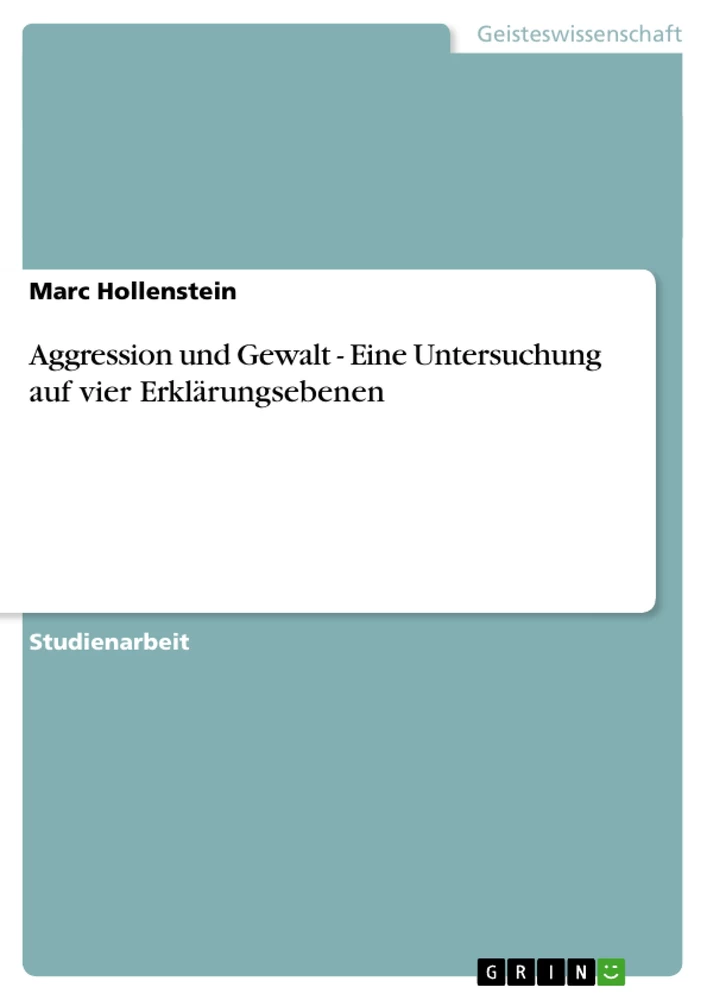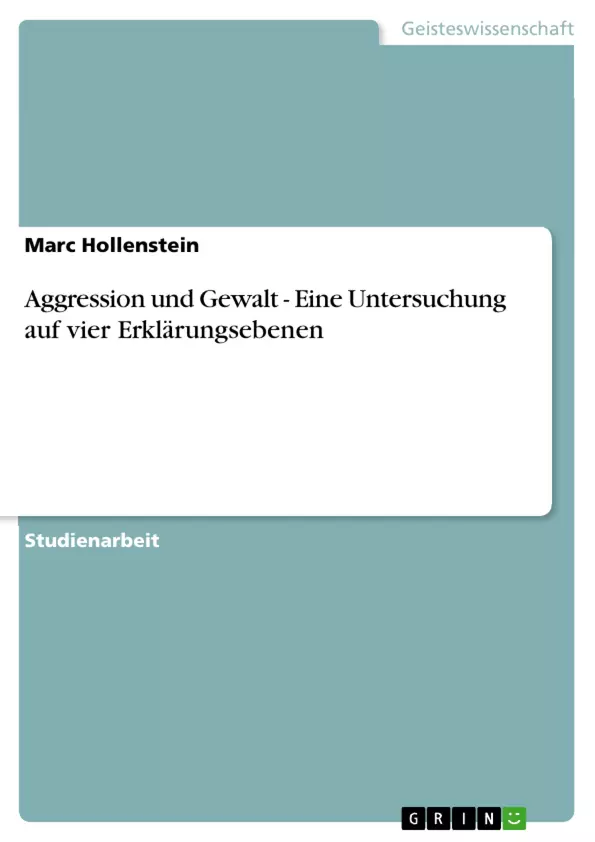Heutzutage sind wir nahezu immer und überall mit Gewalt und Aggression konfrontiert. Es fängt im Fernsehen an, zieht sich in der Schule oder am Arbeitsplatz fort und endet in der Familie. Ein besonders erschütterndes Beispiel für Gewaltausübung war der Terror der Nazis in Konzentrationslagern. Aus psychologischer Sicht haben dazu eine Reihe von Faktoren beigetragen. Unter anderem fehlten beispielsweise die üblichen externen negativen Sanktionen für Gewaltausübung; Brutalität wurde sogar vom System noch besonders anerkannt. Auch fehlten die internen moralischen Standards – Selbstbewertungsprozesse sind durch kognitive Umstrukturierungen neutralisiert worden (Bandura, 1983, 1991). Eine weitere wesentliche Rolle in diesem Zusammenhang spielten euphemistische Begriffe, mit denen das Ausmaß an Gewalt vernebelt wurde (Bsp.: „Kristallnacht“, „Ethnische Säuberung“). Auch wurde das Gefühl der eigenen Verantwortlichkeit für sein Handeln vermindert, indem die Verantwortung auf Autoritäten verschoben wurde.
Doch abgesehen von diesem schrecklichen geschichtlichen Ereignis finden wir Gewalt und Aggression – wie schon vorhin erwähnt – auch alltäglich in unserem gesellschaftlichen Umfeld. So wird zum Beispiel die Gewalt in Familien (insbesondere die Gewalt gegen Frauen und Kinder) häufig unterschätzt. Ein Grund dafür liegt im privaten Charakter solcher aggressiven Handlungen, der den Einsatz von exteren Sanktionen schwierig macht. Auch die traditionellen Rollenbilder fügen ihren Teil dazu, indem sie dem Manne („dem Hausherr“) nahezu unbegrenzte Machtausübung ermöglichen.
Aus diesen beiden Beispielen kann man schon die unterschiedlichen Ausdrucksformen von Gewalt und Aggression erahnen. Willem Doise (1986) spricht deshalb von vier Erklärungsebenen, die bei der Erklärung menschlichen Verhaltens auseinandergehalten werden sollten:
1) Intraindividuelle Erklärungen
2) Interpersonale Erklärungen
3) Intergruppale Ebene
4) Ideologische Ebene
Die folgenden Theorien und Modelle lassen sich den vier Erklärungsebenen zuordnen. Aggression und Gewalt sind jedoch in der Regel nicht auf einen einzelnen Erklärungsfaktor zurückzuführen, fast immer kommt es zum Zusammenwirken von Ursachen, die auf unterschiedlichen Erklärungsebenen anzusiedeln sind.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1 - Aggression: Definition, Theorie und Themen (Hans W. Bierhoff und Ulrich Wagner)
- 1 Einführung
- 2 Definitionen
- 3 Theorien und Erklärungsansätze
- 4 Frustrations-Aggressions-Hypothese
- 5 Aggressive Hinweisreize und andere Randbedingungen
- 5.1 Katharsis
- 5.2 Die soziale Lerntheorie und Aggressionslernen bei Kindern
- 5.3 Erregungstransfer und Attribution
- 5.4 Ein Prozessmodell der Aggression
- 5.5 Aggression als Ausdruck von Machtausübung durch Zwang
- 5.6 Aggression in und zwischen Gruppen
- 6 Zusammenfassung
- Der Einfluss von willkürlicher Provokation und unspezifischer Aktivierung auf aggressives Verhalten (Manfred Bornewasser)
- 1 Theorie
- 2 Methoden
- 3 Ergebnisse
- 4 Diskussion
- The Facilitation of Aggression by Aggression: Evidence Against the Catharsis Hypothesis (Geen Russell G., Stonner David, and Shope Gary L.)
- 1 Theorie
- 2 Methode
- 3 Ergebnisse
- 4 Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen von Aggression und Gewalt. Ziel ist es, verschiedene Definitionen, Theorien und Erklärungsansätze vorzustellen und zu diskutieren. Die Arbeit analysiert zudem empirische Studien, die den Einfluss von Provokation und Erregung auf aggressives Verhalten untersuchen und die Katharsis-Hypothese hinterfragen.
- Definition und Theorien von Aggression
- Der Einfluss von Provokation auf aggressives Verhalten
- Die Rolle von Erregung und Attribution bei Aggression
- Gruppenbezogene Aggression
- Die Katharsis-Hypothese
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 - Aggression: Definition, Theorie und Themen (Hans W. Bierhoff und Ulrich Wagner): Dieses Kapitel bietet eine umfassende Einführung in das Thema Aggression und Gewalt. Es beginnt mit der Darstellung der allgegenwärtigen Präsenz von Aggression in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, von den Medien bis hin zu familiären Kontexten. Als erschreckendes Beispiel wird der Terror im Nationalsozialismus angeführt, um die möglichen Auswirkungen von systemischer Gewalt und dem Verlust moralischer Standards zu illustrieren. Das Kapitel untersucht verschiedene Erklärungsebenen für Aggression, von intraindividuellen Faktoren wie physiologischer Erregung bis hin zu ideologischen Ebenen, die gesellschaftliche Normen und Einstellungen reflektieren. Die Bedeutung von Missverständnissen in zwischenmenschlichen Beziehungen und die Rolle von Gruppenkonflikten werden ebenso hervorgehoben. Die Autoren betonen die Komplexität des Phänomens und weisen darauf hin, dass Aggression selten auf einen einzelnen Faktor zurückzuführen ist, sondern vielmehr auf ein Zusammenspiel verschiedener Ursachen auf unterschiedlichen Ebenen.
Der Einfluss von willkürlicher Provokation und unspezifischer Aktivierung auf aggressives Verhalten (Manfred Bornewasser): Diese Studie untersucht den Einfluss von willkürlicher Provokation und unspezifischer Aktivierung auf aggressives Verhalten. Sie präsentiert eine theoretische Grundlage und beschreibt die verwendeten Methoden, bevor sie die Ergebnisse der Studie detailliert darstellt und diskutiert. Die Diskussion analysiert die Ergebnisse im Kontext bestehender Theorien und hebt möglicherweise die Bedeutung von bestimmten Faktoren für die Entstehung aggressiven Verhaltens hervor. Die Studie trägt zum Verständnis der Bedingungen bei, unter denen Provokation und Erregung zu Aggression führen.
The Facilitation of Aggression by Aggression: Evidence Against the Catharsis Hypothesis (Geen Russell G., Stonner David, and Shope Gary L.): Diese Studie stellt die Katharsis-Hypothese in Frage, die besagt, dass aggressives Verhalten aggressive Impulse reduziert. Durch die detaillierte Darstellung der Theorie, Methode, Ergebnisse und Diskussion liefert die Studie empirische Evidenz gegen diese Hypothese. Die Ergebnisse werden analysiert und im Zusammenhang mit alternativen Theorien zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Aggression diskutiert. Die Studie bietet wichtige Einblicke in die Dynamik von Aggression und deren Folgen und impliziert möglicherweise, dass der Ausdruck von Aggression nicht zu einer Verminderung, sondern eher zu einer Steigerung von Aggression führen kann.
Schlüsselwörter
Aggression, Gewalt, Theorien, Erklärungsansätze, Provokation, Erregung, Katharsis-Hypothese, soziale Lerntheorie, Attribution, Gruppenaggression, empirische Studien, Intergruppenkonflikt.
Häufig gestellte Fragen zu: Aggression: Definition, Theorie und empirische Befunde
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Aggression. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf verschiedenen Definitionen und Theorien von Aggression, dem Einfluss von Provokation und Erregung auf aggressives Verhalten, der Katharsis-Hypothese und gruppenbezogener Aggression. Der Text analysiert sowohl theoretische Ansätze als auch empirische Studien zu diesem Thema.
Welche Kapitel sind enthalten und worum geht es in jedem Kapitel?
Der Text umfasst drei Hauptkapitel: Kapitel 1 von Bierhoff und Wagner bietet eine umfassende Einführung in die Definition, Theorien und Themen der Aggression, inklusive der Frustrations-Aggressions-Hypothese, sozialer Lerntheorie und der Rolle von Erregung und Attribution. Das zweite Kapitel von Bornewasser untersucht den Einfluss von willkürlicher Provokation und unspezifischer Aktivierung auf aggressives Verhalten. Das dritte Kapitel von Geen, Stonner und Shope hinterfragt die Katharsis-Hypothese mittels empirischer Daten.
Welche Theorien der Aggression werden behandelt?
Der Text behandelt verschiedene Theorien der Aggression, darunter die Frustrations-Aggressions-Hypothese und die soziale Lerntheorie. Weitere Erklärungsansätze werden im Kontext der einzelnen Kapitel vorgestellt und diskutiert. Der Einfluss von Erregungstransfer und Attribution auf aggressives Verhalten wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Rolle spielt die Katharsis-Hypothese?
Die Katharsis-Hypothese, die besagt, dass der Ausdruck von Aggression aggressive Impulse reduziert, wird im Text kritisch untersucht. Eine empirische Studie widerlegt diese Hypothese und liefert Evidenz dafür, dass Aggression eher zu einer Steigerung als zu einer Verminderung von Aggression führen kann.
Welche empirischen Studien werden vorgestellt?
Der Text präsentiert und analysiert Ergebnisse von mindestens zwei empirischen Studien. Eine Studie untersucht den Einfluss von willkürlicher Provokation und unspezifischer Aktivierung auf aggressives Verhalten. Eine weitere Studie liefert empirische Evidenz gegen die Katharsis-Hypothese.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter des Textes sind: Aggression, Gewalt, Theorien, Erklärungsansätze, Provokation, Erregung, Katharsis-Hypothese, soziale Lerntheorie, Attribution, Gruppenaggression, empirische Studien, und Intergruppenkonflikt.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, verschiedene Definitionen, Theorien und Erklärungsansätze von Aggression vorzustellen und zu diskutieren. Er analysiert empirische Studien, die den Einfluss von Provokation und Erregung auf aggressives Verhalten untersuchen und die Katharsis-Hypothese hinterfragen.
Für welche Zielgruppe ist der Text bestimmt?
Der Text ist aufgrund seines akademischen Niveaus und der detaillierten Darstellung von Theorien und empirischen Studien primär für eine akademische Zielgruppe bestimmt, beispielsweise Studenten der Psychologie oder verwandter Disziplinen.
- Citar trabajo
- Mag. Marc Hollenstein (Autor), 2002, Aggression und Gewalt - Eine Untersuchung auf vier Erklärungsebenen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21596