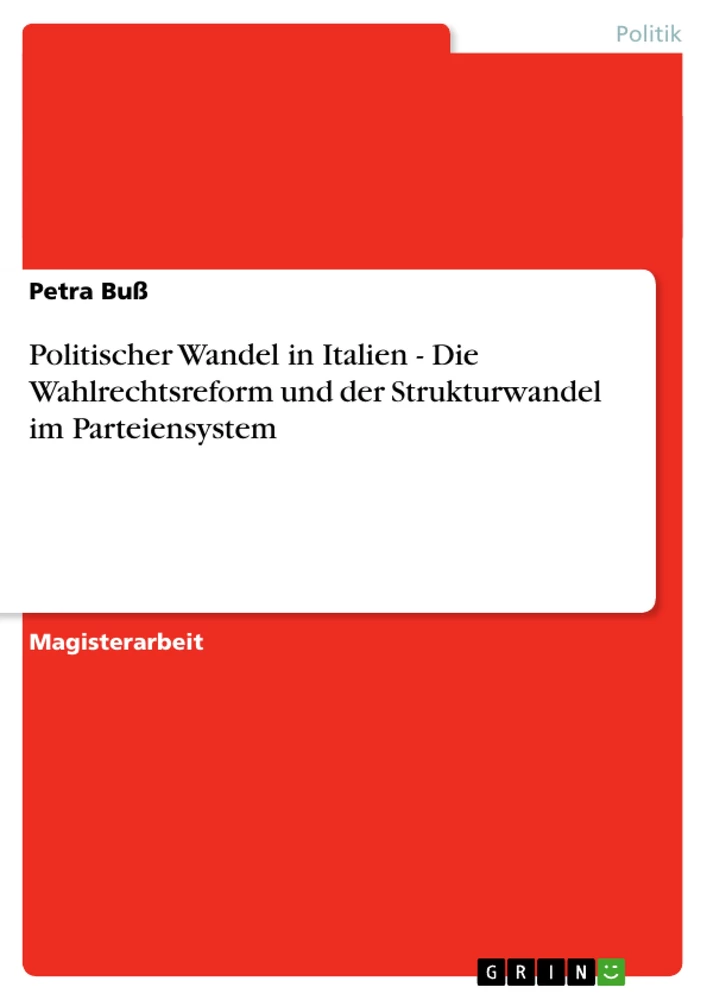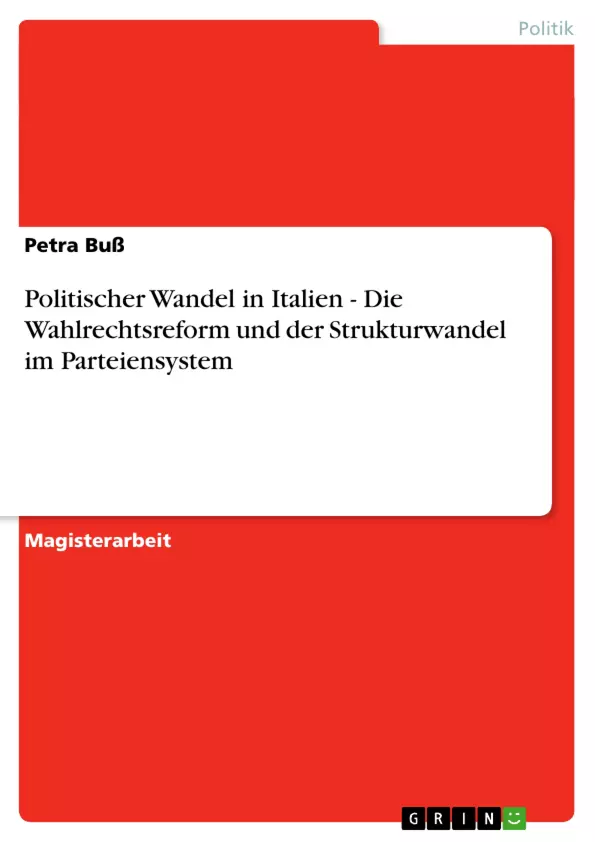Wie kaum eine andere westliche Demokratie hat Italien in den letzten zehn Jahren eine Entwicklung durchlebt, die Anfang der neunziger Jahre noch hoffnungsvoll den Begriff "Zweite Republik" aufkommen ließ. Damit war ein neues Italien gemeint, das stabiler, effizienter und erfolgreicher, kurzum "besser" als das Italien der Nachkriegszeit, das Italien der Christdemokraten und der korrupten politischen Elite sein sollte.
Die Einführung eines neuen Wahlsystems 1993 sollte Wegbereiter der neuen Republik sein und trotz einiger Erfolge, wie die Durchsetzung von wirtschafts- und finanzpolitischen Reformen, die zur Haushaltssanierung und zur Teilnahme an der Wirtschafts- und Währungsunion beitrugen, blieb der Übergang zu einer wirklich funktionsfähigen "Zweiten Republik" aufgrund des Scheiterns der Verfassungskommission von 1998 aus.
Auch die Regierungsstabilität erhöhte sich mit der Wahlrechtsreform nicht. Seit den Parlamentswahlen im Mai 2001 ist die 59. Nachkriegsregierung im Amt, die siebte seit den Wahlen von 1994, Wahlen die das Ende der so genannten "Ersten Republik" kennzeichneten und erstmals mit dem neuen Wahlsystem durchgeführt wurden. Die Regierungszeiten seit Beginn der "Zweiten Republik" haben sich mit durchschnittlich einem Jahr nicht merklich verlängert. Einzige Ausnahme bildet die Regierung Prodi mit einer Amtszeit von fast zweieinhalb Jahren, die zweitlängste Regierung nach der ersten Regierung Craxi (August 1983 bis Juli 1986) in der Nachkriegsgeschichte Italiens.
Als einer der wesentlichen Gründe für diese Instabilität wird sowohl in der Wissenschaft als auch von Politikern vor allem die seit Ende des Zweiten Weltkrieges bestehende Fragmentierung des Parteiensystems genannt. Ende der achtziger Jahre ist dieses Parteiensystem in eine Neustrukturierungsphase eingetreten, die neben der Wirtschaft den Wandel Italiens am deutlichsten macht.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit diesen Facetten des politischen Wandels in Italien. Im Vordergrund stehen dabei die Wahlrechtsreform von 1993 und der Strukturwandel im Parteiensystem, zwei der bedeutendsten Merkmale des Umbruchs in Italien. Zentrales Ziel ist es, zu untersuchen, wie es zu diesem Strukturwandel gekommen ist, welcher Art sich die Struktur des Parteiensystems verändert und ob und inwiefern das Wahlsystem von 1993 Auswirkungen darauf gehabt hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Relevante Parteien in Parteiensystemen
- Das italienische Wahlsystem
- Das Verhältniswahlsystem der Nachkriegszeit
- Das Wahlrecht für die Abgeordnetenkammer
- Das Wahlrecht für den Senat
- Das kompensatorische Wahlsystem von 1993
- Das Wahlrecht für die Abgeordnetenkammer
- Das Wahlrecht für den Senat
- Scorporo und liste civetta
- Das Verhältniswahlsystem der Nachkriegszeit
- Entwicklung des italienischen Parteiensystems von 1945 bis Anfang der neunziger Jahre
- Verfassungsrechtliche Stellung der Parteien in Italien
- Entstehung des Nachkriegsparteiensystems
- Entwicklung der Parteien
- Democrazia Cristiana
- Partito Comunista Italiano
- Partito Socialista Italiano
- Neofaschisten und Monarchisten – die extreme Rechte in Italien
- Laizistische Parteien
- Partito Repubblicano Italiano
- Partito Socialdemocratico Italiano
- Partito Liberale Italiano
- Kleine Parteien
- Partito d'Azione
- Partito Radicale
- Regionale Parteien
- Linksextreme Parteien
- Struktur des italienischen Nachkriegsparteiensystems
- Merkmale des Parteiensystems in der Nachkriegszeit
- Vom centrismo zum centro-sinistra
- Consociativismo und partitocrazia
- Problematik der Koalitionen und fehlende Alternanz
- Typologisierung des italienischen Nachkriegsparteiensystems in der Forschung
- Entwicklung der Parteien
- Strukturwandel im Parteiensystem seit den neunziger Jahren
- Krise des Parteiensystems und Reform des Wahlgesetzes
- Kritik am Verhältniswahlsystem
- Reduzierung der Präferenzstimmen und die darauf folgenden Wahlen von 1992
- Tangentopoli
- Die Referenden vom 18. April 1993 als Kritik an der partitocrazia
- Zerfall der traditionellen Parteien
- Das Ende der DC und ihre Erben
- Von Kommunisten zu Linksdemokraten
- Der Niedergang des PSI
- Vom neofaschistischen Movimento Sociale Italiano zur rechtsnationalen Alleanza Nazionale
- Laizistische Parteien
- Partito Radicale
- Neue Parteien
- Verdi - Die italienischen Grünen
- Lega Nord - Zwischen Sezession und Fremdenfeindlichkeit
- Berlusconis Forza Italia: Die Einmannpartei
- UDR Das Scheitern eines neuen Zentrums
- Democrazia Europea – UDR Nummer 2?
- La Margherita-Democrazia e Libertà: Das neue Zentrum des Mitte-Links-Bündnisses Ulivo
- Italia dei Valori - Di Pietros Alleingang
- Krise des Parteiensystems und Reform des Wahlgesetzes
- Zum Charakter des neuen Parteiensystems und den Auswirkungen des Wahlsystems
- Zusammensetzung der Parlamente seit 1994
- Parlamentswahlen vom März 1994
- Parlamentswahlen vom April 1996
- Parlamentswahlen vom Mai 2001
- Struktur des heutigen Parteiensystems
- Merkmale des heutigen Parteiensystems
- Typologisierung des neuen Parteiensystems und Veränderungen gegenüber der alten Struktur
- Diskussion um eine erneute Wahlgesetzreform
- Zusammensetzung der Parlamente seit 1994
- Ein neues Wahlsystem als Heilmittel für das fragmentierte Vielparteiensystem in Italien?
- Welchen Einfluss hatte die Änderung des Wahlgesetzes auf das Parteiensystem?
- Gibt es ein Wahlsystem, das aus dem Parteienpluralismus führt?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem politischen Wandel in Italien, insbesondere mit der Wahlrechtsreform und ihren Auswirkungen auf die Struktur des italienischen Parteiensystems. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Parteiensystems von der Nachkriegszeit bis hin zur Gegenwart und beleuchtet die entscheidenden Faktoren, die den Wandel im politischen System Italiens beeinflusst haben.
- Entwicklung des italienischen Parteiensystems von 1945 bis Anfang der neunziger Jahre
- Strukturwandel im Parteiensystem seit den neunziger Jahren
- Auswirkungen der Wahlrechtsreform auf das Parteiensystem
- Charakter des neuen Parteiensystems und seine Typologisierung
- Debatte um eine erneute Wahlgesetzreform
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des politischen Wandels in Italien ein und erläutert den Fokus der Arbeit auf die Wahlrechtsreform und den Strukturwandel im Parteiensystem. Das zweite Kapitel beleuchtet die Relevanz von Parteien in verschiedenen Parteiensystemen und stellt verschiedene Typologien vor.
Das dritte Kapitel widmet sich dem italienischen Wahlsystem. Es analysiert das Verhältniswahlsystem der Nachkriegszeit und das kompensatorische Wahlsystem von 1993.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Entwicklung des italienischen Parteiensystems von 1945 bis Anfang der neunziger Jahre. Es analysiert die Entstehung und Entwicklung der wichtigsten Parteien, die Struktur des Nachkriegsparteiensystems und dessen Merkmale sowie die typologische Einordnung des Systems in der Forschung.
Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit dem Strukturwandel im Parteiensystem seit den neunziger Jahren. Es analysiert die Krise des Parteiensystems, die Reform des Wahlgesetzes, den Zerfall der traditionellen Parteien und den Aufstieg neuer politischer Kräfte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen der politischen Wissenschaft wie Parteiensystem, Wahlsystem, Wahlrechtsreform, Strukturwandel, politische Kultur, politische Institutionen und Machtverhältnisse. Sie analysiert die Entwicklung des italienischen Parteiensystems von der Nachkriegszeit bis zur Gegenwart, wobei die Schwerpunkte auf den Wandel im Wahlsystem, dem Aufstieg neuer Parteien und dem Niedergang alter Kräfte liegen. Die Analyse basiert auf verschiedenen theoretischen Konzepten, wie z. B. dem Konzept des "partitocrazia" und der verschiedenen Typologien von Parteiensystemen.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der italienischen Wahlrechtsreform von 1993?
Ziel war es, die Zersplitterung des Parteiensystems zu verringern, stabilere Regierungen zu schaffen und den Übergang zur sogenannten "Zweiten Republik" einzuleiten.
Was bedeutet der Begriff "Partitocrazia"?
Er beschreibt die Vorherrschaft der politischen Parteien über alle Bereiche des öffentlichen Lebens und Staates, was in Italien oft mit Korruption und Ineffizienz assoziiert wurde.
Was war "Tangentopoli"?
"Tangentopoli" (Stadt der Schmiergelder) war ein massiver Korruptionsskandal Anfang der 90er Jahre, der zum Zusammenbruch der traditionellen italienischen Parteien wie der Democrazia Cristiana führte.
Hat das neue Wahlsystem die Regierungsstabilität erhöht?
Nein, die Regierungszeiten blieben auch nach 1994 mit durchschnittlich einem Jahr sehr kurz, was zeigt, dass die Reform allein die Fragmentierung nicht heilen konnte.
Welche Rolle spielte Silvio Berlusconi im Strukturwandel?
Mit seiner Partei "Forza Italia" füllte Berlusconi das Machtvakuum nach dem Zerfall der alten Parteien und prägte ein neues System, das stärker auf mediale Präsenz und Personalisierung setzte.
Was ist der "Scorporo"?
Ein technischer Verrechnungsmechanismus im italienischen Wahlrecht von 1993, der verhindern sollte, dass große Parteien sowohl bei den Direktmandaten als auch bei der Verhältniswahl übermäßig profitieren.
- Quote paper
- Petra Buß (Author), 2000, Politischer Wandel in Italien - Die Wahlrechtsreform und der Strukturwandel im Parteiensystem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21615