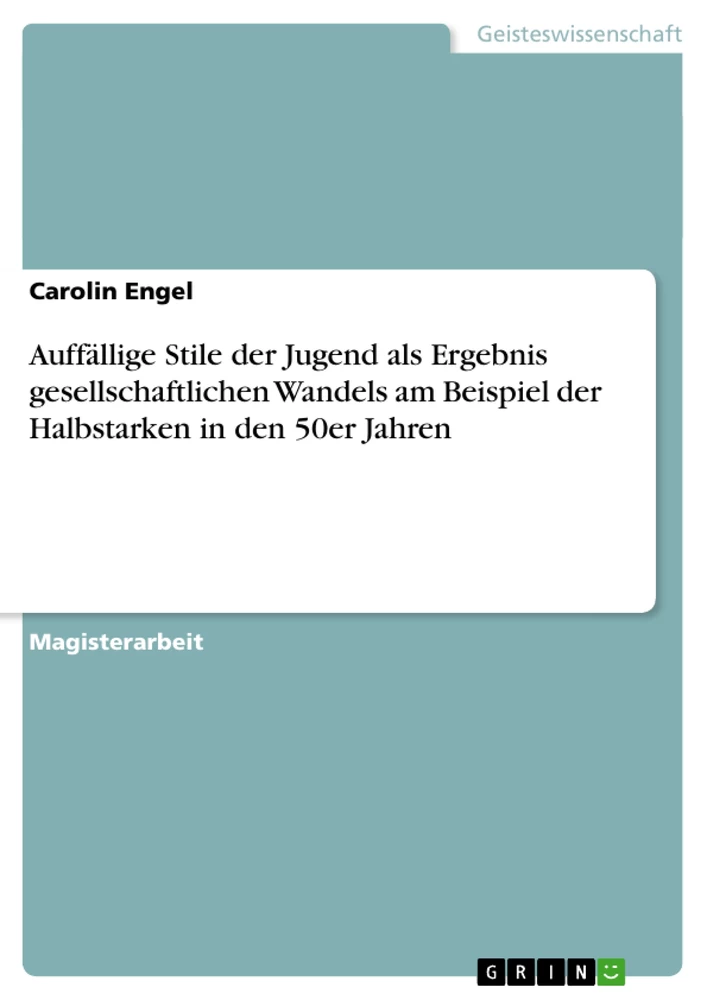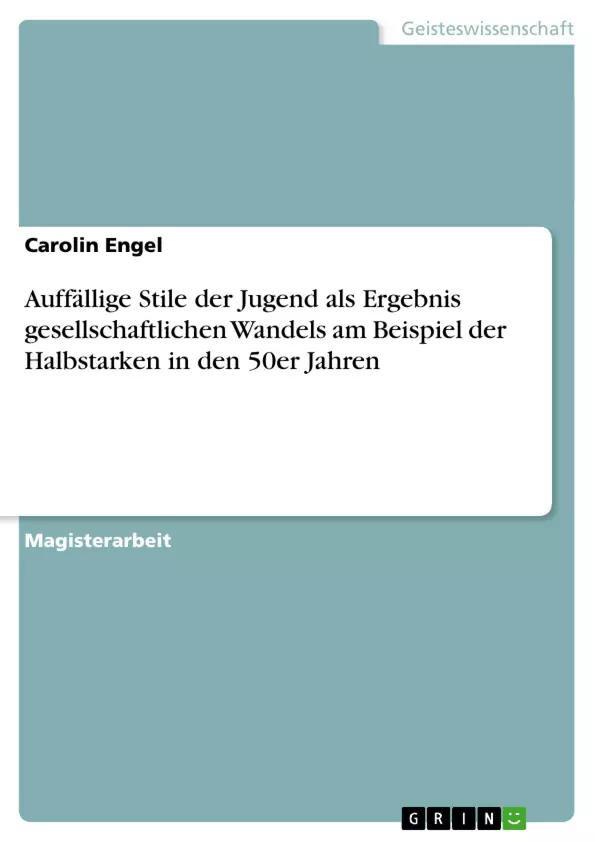Thema dieser Arbeit ist die Jugendkultur der (west)deutschen Bundesrepublik
der fünfziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts. Im Mittelpunkt
der Betrachtung soll die Gruppe der sogenannten Halbstarken
stehen, an Zahl sicher nicht die größte der Jugendsubkulturen jener
Zeit, möglicherweise aber ihre einflussreichste, was die Prägung von
Stilen anbelangt, bestimmt auch in der Art, wie sie die öffentliche Meinung
über "die Jugend" der Fünfziger bestimmte.
Das Interesse am Thema Jugendkultur bzw. Jugendsubkultur resultiert
aus der Erkenntnis, dass sich jugendliche Verhaltensweisen offenbar zu
allen Zeiten moderner Industriegesellschaften gruppenförmig herausbilden,
in Abhängigkeit von gesellschaftlichen Entwicklungen und Einflüssen.
Die Relevanz dieses Themas ist daher bis heute gegeben. Auch in
der Folgezeit der fünfziger Jahre machten Jugendkulturen auf sich aufmerksam,
seien es beispielsweise Punker oder Skinheads. Jede Generation
hat ihr "eigene" Jugendkultur, in der sich verschiedene Subkulturen
wiederfinden. Während für die 60er Jahre die Beatgeneration als
typische Vertreter dieser Zeit galten, wurden die 70er Jahre von den
Blumenkindern oder den sog. Hippies dominiert. In den 80er Jahren
sprach man von der Blütezeit der Punker, die trotz ihrer relativ geringen
Gruppengröße, meist im öffentlichen Raum den Erwachsenen negativ
auffielen. Die 90er Jahre gelten als das Jahrzehnt der Raver und
Techno-Anhänger, die sich nach außen mittels der "Love-Parade" in
Berlin darstellen - eine der größten organisierten öffentlichen Veranstaltungen,
die speziell auf die jugendliche Fangemeinde dieser Musikrichtung
zugeschnitten ist.
So unterschiedlich die Ausprägungen der einzelnen Stilrichtungen auch
sind, es gibt wesentliche Gemeinsamkeiten, die alle Jugendsubkulturen
aufweisen. Die Orientierung an Gleichaltrigen, die als Gruppe eine
wichtige Funktion erfüllt, der hohe Stellenwert des Konsums (Kleidung,
Musik etc.), sowie die Ausprägung eines eigenen Stils als Wiedererkennungswert
(Mode, Sprache etc.) sind bedeutende Merkmale von
Jugendkultur.
In den fünfziger Jahren wurde die Herausbildung einer eigenständigen
Jugendkultur erstmals verstärkt wahrgenommen und somit auch Gegenstand
wissenschaftlicher Forschung. Daher steht dieses Jahrzehnt,
mit den Halbstarken als Subkultur im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gesellschaftliche Rahmenbedingungen in der Nachkriegszeit bis Mitte der 50er Jahre
- Politische Entwicklung
- Wirtschaftliche Entwicklung
- Vom Mangel zum Konsum
- Der Wandel gesellschaftlicher Grundwerte
- Jugend und Jugendsubkulturen
- Zum geschichtlichen Begriff "Jugend"
- Klassifizierung der Lebensphase "Jugend"
- Begriffsklärung "Jugendkultur" und "Jugendsubkultur"
- Sozialwissenschaftliche Jugendtheorien
- Die phänomenologische Gegenwartsanalyse der Jugend: Helmut Schelsky
- Der funktionalistische Ansatz: Samuel N. Eisenstadt
- Der handlungstheoretische Ansatz: Friedrich H. Tenbruck
- Jugendstile in den 50er Jahren in Westdeutschland
- Die Peer-Group als informelle Gruppe
- Stile der Jugendkultur
- Die Existentialisten
- Die Teenager
- Die Motorradjungs (Rocker)
- Die Halbstarken der fünfziger Jahre
- Vorläufer der Halbstarken in der Geschichte
- Die soziale Herkunft der Halbstarken
- Die Entwicklung eines eigenen Stils in Mode, Sprache und Habitus
- Verhalten in der Freizeit
- Das Leben in Banden
- Die Reaktion der Medien auf Krawalle und Provokationen
- Rock 'n' Roll und die Rolle der USA
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Jugendkultur der Bundesrepublik Deutschland in den 1950er Jahren, wobei der Fokus auf die Gruppe der sogenannten Halbstarken liegt. Die Arbeit analysiert die Halbstarken als Ausdruck des gesellschaftlichen Wandels, der sich in der Nachkriegszeit vollzog. Die Untersuchung konzentriert sich auf die sozialen und kulturellen Bedingungen, die die Entstehung dieser Jugendsubkultur prägten, sowie auf die spezifischen Merkmale und Verhaltensweisen der Halbstarken.
- Die soziale und kulturelle Entwicklung der Nachkriegszeit
- Der Wandel von gesellschaftlichen Grundwerten und Normen
- Die Entstehung von Jugendsubkulturen in der Bundesrepublik
- Die Halbstarken als Ausdruck des gesellschaftlichen Wandels
- Die Lebenswelt und die Verhaltensweisen der Halbstarken
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Jugendkultur der 1950er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland ein und hebt die Relevanz des Themas hervor. Das zweite Kapitel beleuchtet die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in der Nachkriegszeit bis Mitte der 1950er Jahre, einschließlich der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungen, die die Entstehung der Halbstarken beeinflussten. Kapitel 3 befasst sich mit dem Begriff der Jugend und der Jugendsubkulturen und analysiert verschiedene wissenschaftliche Ansätze zur Jugendforschung.
Kapitel 4 beleuchtet verschiedene Jugendstile der 1950er Jahre in Westdeutschland, einschließlich der Peer-Group als informelle Gruppe. Das fünfte Kapitel analysiert die Halbstarken der 1950er Jahre, ihre soziale Herkunft, ihren eigenen Stil, ihre Verhaltensweisen und die Reaktion der Medien auf sie. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse.
Schlüsselwörter
Jugendkultur, Jugendsubkultur, Halbstarken, Nachkriegszeit, Bundesrepublik Deutschland, gesellschaftlicher Wandel, soziale Entwicklung, kulturelle Entwicklung, Peer-Group, Rock 'n' Roll, Medienreaktion
Häufig gestellte Fragen
Wer waren die "Halbstarken" der 50er Jahre?
Eine Jugendsubkultur der Nachkriegszeit, die durch provokantes Verhalten, Krawalle und einen eigenen Stil in Mode und Musik (Rock 'n' Roll) auffiel.
Welche Rolle spielten die USA für die Jugendkultur?
Die USA fungierten als Vorbild für Mode, Musik und Lebensgefühl, wobei der Rock 'n' Roll zum zentralen Ausdrucksmittel der Rebellion wurde.
Wie reagierten die Medien auf die Halbstarken?
Die Medien reagierten oft mit Entsetzen und negativer Berichterstattung über Krawalle, was das Bild der "verdorbenen Jugend" in der Öffentlichkeit prägte.
Was sind typische Merkmale von Jugendsubkulturen?
Orientierung an Gleichaltrigen (Peer-Groups), hoher Stellenwert von Konsum und die Ausprägung eines eigenen Stils zur Abgrenzung von der Erwachsenenwelt.
Welche soziologischen Theorien werden in der Arbeit genutzt?
Es werden Ansätze von Helmut Schelsky, Samuel N. Eisenstadt und Friedrich H. Tenbruck zur Analyse der Jugendphase herangezogen.
- Quote paper
- Carolin Engel (Author), 2003, Auffällige Stile der Jugend als Ergebnis gesellschaftlichen Wandels am Beispiel der Halbstarken in den 50er Jahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21619