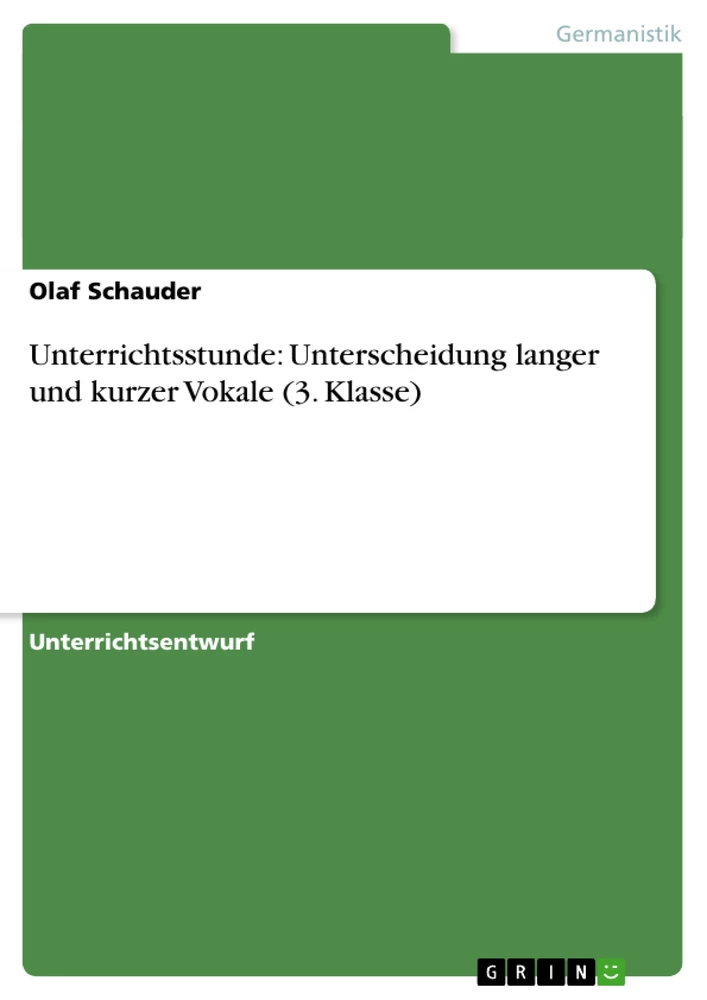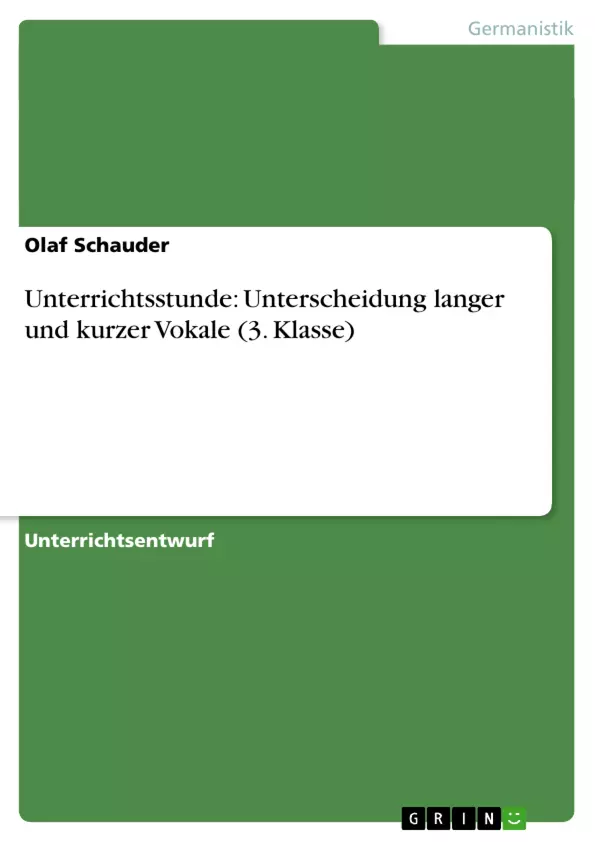Das Unterrichtsthema ,,Unterscheidung kurzer und langer Vokale“ verweist auf das phonologische (oder phonematische) Prinzip, das (neben dem semantischen, dem
syntaktischen und dem morphologischen) ein wichtiges Grundprinzip der deutschen
Rechtschreibung darstellt. Die besondere Aufmerksamkeit hat hier der Abbildung vokalischer
Phoneme (im folgenden der Einfachheit halber, wenn auch nicht ganz korrekt,
als ,,Vokale“ bezeichnet) zu gelten.
Die Lautstruktur der deutschen Sprache ist von einem dynamischen Akzent geprägt,
der zweifach bedingt ist:
• Den Hauptton trägt, auch in Ableitungen oder Komposita, der Vokal des Grundmorphems
(der sog. „Stammvokal“).
• Zwischen kurzen und langen Vokalen in betonter Stellung besteht ein relativ großer
phonetischer Unterschied.
Insgesamt sind 18 Vokale zu unterscheiden: kurzes, (offenes) a, e, i, o, u, ö, ü, langes,
(geschlossenes) a:, e:, i:, o:, u:, ö:, ü:, langes ä:, außerdem die Diphthonge au, ai und
oi.
Für ihre Abbildung stehen nur die fünf Grapheme a, e, i, o, u zur Verfügung (y, das in
deutschen Wörtern nicht vorkommt, darf hier vernachlässigt werden), zusätzlich ä, ö, ü
und die Graphemverbindungen au, ei, ai, äu, eu. Zur Abbildung von Kürze oder Länge
einfacher Vokale stehen keine besonderen Zeichen bereit; bei genauerer Analyse lassen
sich jedoch Regelmäßigkeiten in den Abbildungsbeziehungen erkennen.
1. Kurze Vokale werden in der Regel durch den entsprechenden Buchstaben wiedergegeben.
Folgt einem betonten Vokal nur ein Konsonant, wird der ihm entsprechende
Buchstabe verdoppelt (vgl. herb, aber Herr). An die Stelle von zz und kk
treten, von Fremdwörtern abgesehen, tz bzw. ck. Nach dem morphematischen
Prinzip bleibt diese Verdoppelung auch dann erhalten, wenn dem Doppelkonsonanten
z.B. Flexionsmorpheme folgen (z.B. fallen - fällst).
Eine Ausnahme stellen eine kleine Gruppe einsilbiger Wörter (Präpositionen wie
an, in; außerdem hat, bin, es, das) und Vorsilben (un-, ver-, zer-) dar, die trotz kurzen
Vokals keine Verdoppelung aufweisen, im Kontext jedoch selten in betonter
Position vorkommen.
Inhaltsverzeichnis
- Sachanalyse
- Lehr- und Lernziele
- Lehrplanbezug und Einordnung der Stunde in die Unterrichtseinheit
- Didaktische Überlegungen
- Methodische Überlegungen
- Literaturangaben
- Verlaufsplanung
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Unterrichtsentwurf zielt darauf ab, die Fähigkeit von Drittklässlern zur Unterscheidung kurzer und langer Vokale zu schulen. Dies geschieht durch die Verknüpfung von akustischer Wahrnehmung, sprechmotorischen Übungen und spielerischem Lernen. Die Stunde soll die Schüler an die Regelhaftigkeiten der deutschen Rechtschreibung heranführen und ihnen Lernhilfen zur Unterscheidung vermitteln.
- Akustische Differenzierung kurzer und langer Vokale
- Anwendung von Lernhilfen zur Rechtschreibung
- Verknüpfung von phonologischen, semantischen und morphologischen Prinzipien der Rechtschreibung
- Spielerischer Zugang zur Sprachanalyse
- Schulung der Kommunikationsfähigkeit durch Partnerarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Sachanalyse: Dieses Kapitel analysiert die phonologischen Prinzipien der deutschen Rechtschreibung, insbesondere die Unterscheidung zwischen kurzen und langen Vokalen. Es beschreibt die phonetischen Unterschiede zwischen kurzen und langen Vokalen und die verschiedenen Schreibweisen, die zur Darstellung dieser Unterschiede verwendet werden. Es werden Regelmäßigkeiten und Ausnahmen in der Abbildung von kurzen und langen Vokalen erläutert, insbesondere die Rolle des Dehnungs-h und die Bedeutung des morphematischen Prinzips. Das Kapitel betont die Notwendigkeit, neben dem phonologischen Prinzip auch das semantische und morphologische Prinzip zu berücksichtigen, um die Rechtschreibung zu verstehen. Die Zusammenfassung endet mit der Darstellung von vereinfachten Lernhilfen für Schüler zur Unterscheidung kurzer und langer Vokale.
Lehr- und Lernziele: Dieses Kapitel definiert die Lernziele der Unterrichtsstunde. Die Schüler sollen ihre Fähigkeit zur akustischen Differenzierung von kurzen und langen Vokalen schulen, diese phonetisch unterscheiden lernen, Einsicht in die Regelhaftigkeit der Schreibweisen gewinnen und Lernhilfen erkennen und anwenden können. Zusätzlich wird die Schulung der Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit durch Partnerarbeit als Lernziel genannt.
Lehrplanbezug und Einordnung der Stunde in die Unterrichtseinheit: Dieses Kapitel beschreibt den Bezug der Unterrichtsstunde zum Bildungsplan. Es argumentiert, dass die sichere akustische Unterscheidung von kurzen und langen Vokalen eine Voraussetzung für das Erkennen und Anwenden von Lernhilfen und Regeln ist, die im Bildungsplan explizit aufgeführt werden. Die Stunde dient als Einführung in das Thema Doppelkonsonanten (inkl. ck und tz).
Didaktische Überlegungen: Dieses Kapitel erläutert die didaktischen Überlegungen, die der Gestaltung der Unterrichtsstunde zugrunde liegen. Die Fähigkeit, lange und kurze Vokale zu unterscheiden, wird als Voraussetzung für die korrekte Schreibung vieler Wörter hervorgehoben. Die Bedeutung korrekter Artikulation, insbesondere im süddeutschen Raum, wird betont. Die Einbeziehung weiterer Lernkanäle zur Unterstützung der Lautdifferenzierung und der spielerische Umgang mit begrenztem Wortmaterial werden als didaktisch sinnvoll dargestellt. Das Kapitel betont den Aufbau eines Grundwortschatzes und die Förderung einer analytischen Auseinandersetzung mit Sprache.
Methodische Überlegungen: Dieses Kapitel beschreibt den geplanten Ablauf der Unterrichtsstunde und alternative methodische Ansätze. Der Einstieg erfolgt über eine märchenhafte Geschichte, um das Interesse der Schüler zu wecken. Es werden Tier-Rätsel eingesetzt, um das Wortmaterial für die nachfolgende Sprach-analyse bereitzustellen. Eine alternative Methode, die Verwendung gleichklingender Wörter, wird kritisch bewertet.
Schlüsselwörter
Kurze Vokale, lange Vokale, phonologische Prinzipien, Rechtschreibung, Dehnungs-h, Doppelkonsonanten, Lernhilfen, akustische Differenzierung, Sprechmotorik, Sprachanalyse, Artikulation, Didaktik, Methoden, Deutschunterricht, Drittklasse.
Häufig gestellte Fragen zum Unterrichtsentwurf: Rechtschreibung kurzer und langer Vokale
Was ist der Gegenstand dieses Unterrichtsentwurfs?
Der Entwurf beschreibt eine Unterrichtsstunde für Drittklässler zum Thema Rechtschreibung, speziell zur Unterscheidung von kurzen und langen Vokalen. Er beinhaltet eine detaillierte Sachanalyse, didaktische und methodische Überlegungen sowie eine Verlaufsplanung.
Welche Ziele werden mit der Unterrichtsstunde verfolgt?
Die Schüler sollen die Fähigkeit zur akustischen Differenzierung kurzer und langer Vokale schulen, phonetische Unterschiede erkennen, die Regelhaftigkeiten der Schreibweisen verstehen und Lernhilfen anwenden können. Zusätzlich wird die Förderung der Kommunikationsfähigkeit durch Partnerarbeit angestrebt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind die akustische Differenzierung von kurzen und langen Vokalen, die Anwendung von Lernhilfen zur Rechtschreibung, die Verknüpfung phonologischer, semantischer und morphologischer Prinzipien, ein spielerischer Zugang zur Sprachanalyse und die Schulung der Kommunikationsfähigkeit.
Wie wird der Lehrplanbezug hergestellt?
Der Entwurf zeigt den Bezug der Stunde zum Bildungsplan auf, indem er die sichere akustische Unterscheidung von kurzen und langen Vokalen als Voraussetzung für das Erkennen und Anwenden von Lernhilfen und Regeln im Bildungsplan darstellt. Die Stunde dient als Einführung in das Thema Doppelkonsonanten (inkl. ck und tz).
Welche didaktischen Überlegungen liegen dem Entwurf zugrunde?
Die didaktischen Überlegungen betonen die Bedeutung der korrekten Artikulation, insbesondere im süddeutschen Raum, die Einbeziehung weiterer Lernkanäle zur Unterstützung der Lautdifferenzierung und den spielerischen Umgang mit begrenztem Wortmaterial. Der Aufbau eines Grundwortschatzes und die Förderung einer analytischen Auseinandersetzung mit Sprache werden als wichtig erachtet.
Welche Methoden werden in der Unterrichtsstunde eingesetzt?
Der Einstieg erfolgt über eine märchenhafte Geschichte. Es werden Tier-Rätsel eingesetzt, um das Wortmaterial für die nachfolgende Sprach-analyse bereitzustellen. Eine alternative Methode, die Verwendung gleichklingender Wörter, wird kritisch bewertet. Partnerarbeit wird zur Förderung der Kommunikation eingesetzt.
Welche Kapitel umfasst der Unterrichtsentwurf?
Der Entwurf beinhaltet eine Sachanalyse, die Lehr- und Lernziele, den Lehrplanbezug, didaktische und methodische Überlegungen, eine Verlaufsplanung (im vollständigen Entwurf) und einen Anhang (im vollständigen Entwurf). Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über die einzelnen Abschnitte.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Unterrichtsentwurf?
Schlüsselwörter sind: Kurze Vokale, lange Vokale, phonologische Prinzipien, Rechtschreibung, Dehnungs-h, Doppelkonsonanten, Lernhilfen, akustische Differenzierung, Sprechmotorik, Sprachanalyse, Artikulation, Didaktik, Methoden, Deutschunterricht, Drittklasse.
Für welche Jahrgangsstufe ist der Unterrichtsentwurf konzipiert?
Der Unterrichtsentwurf ist für die dritte Klasse konzipiert.
Welche Rolle spielt die akustische Wahrnehmung?
Die akustische Wahrnehmung spielt eine zentrale Rolle, da die Unterscheidung zwischen kurzen und langen Vokalen zunächst auf der auditiven Ebene erfolgen muss, bevor sie schriftlich umgesetzt werden kann.
- Quote paper
- Olaf Schauder (Author), 1998, Unterrichtsstunde: Unterscheidung langer und kurzer Vokale (3. Klasse), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21624