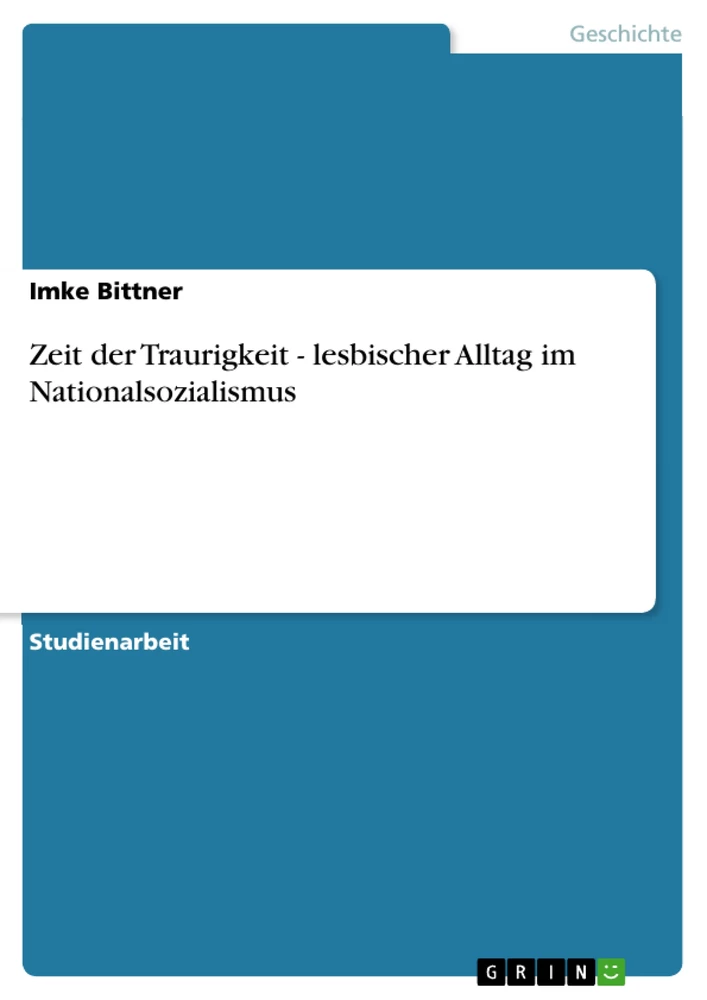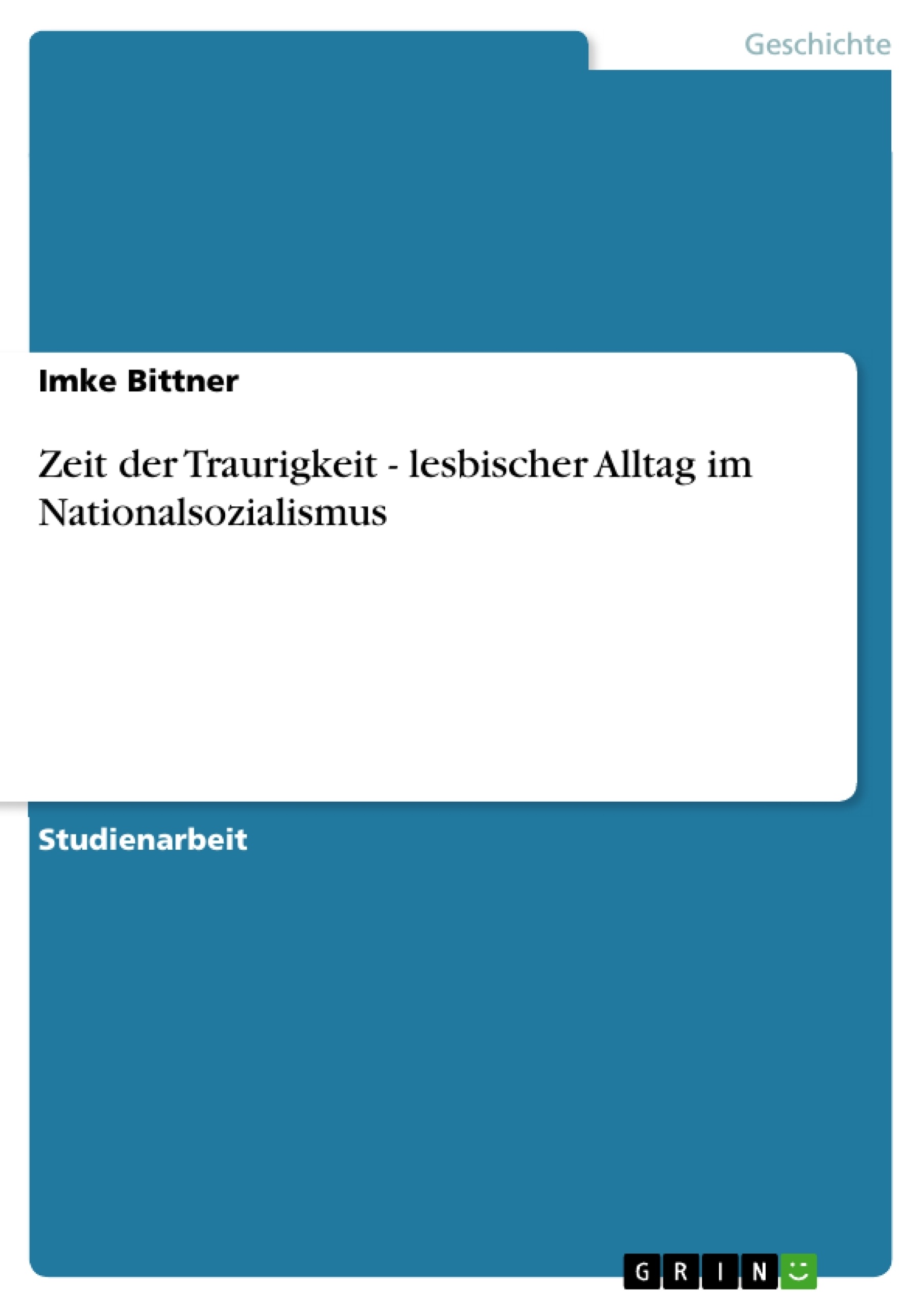In der hier vorliegenden Hausarbeit soll ein Einblick gegeben werden über das Alltagsleben lesbischer Frauen zur Zeit der nationalsozialistischen Diktatur.
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema ist noch nicht weit fortgeschritten. Während es über manche Themen, besonders für die Zeit von 1933 bis 1945, zahlreiche Publikationen unterschiedlichster Verfasser gibt, sind zum Thema „Lesbische Frauen in der NS-Zeit“ nur wenige zu finden. Am intensivsten hat sich die Berliner Historikerin Claudia Schoppmann mit diesem Thema beschäftigt, so daß ich mich in dieser Hausarbeit vornehmlich auf ihre Veröffentlichungen stütze. Zunächst soll dargestellt werden, wie die nationalsozialistische Frauen- und Bevölkerungspolitik aussah und welchen Einfluß sie auf das Leben lesbischer
Frauen hatte. Ferner beschäftige ich mich mit der rechtlichen Grundlage und der Zerschlagung und Auflösung der Homosexuellenbewegung. Ich verweise auf die von Deutschland verschiedene Gesetzeslage in Österreich nach der Annexion 1938. Ausführlicher betrachte ich sowohl die Situation lesbischer
Frauen innerhalb der nationalsozialistischen Konzentrationslager als auch die autobiographischen und biographischen Zeitzeuginnenberichte.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Nationalsozialistische Frauenpolitik
- Bevölkerungspolitik und weibliche Homosexualität
- Strafverfolgung und weibliche Homosexualität
- Die Auflösung der Homosexuellenbewegung und ihre Auswirkungen auf das alltägliche Leben lesbischer Frauen
- Zeugnisse lesbischer Frauen im Konzentrationslager
- Die juristische Situation in Österreich
- Biographische und autobiographischen Zeitzeugenberichte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Alltag lesbischer Frauen während der nationalsozialistischen Diktatur. Sie soll Einblicke in die Lebensrealität dieser Frauen in einem Kontext bieten, der von homophober Gesetzgebung, repressiver Frauenpolitik und dem Ziel der Rassenhygiene geprägt war.
- Nationalsozialistische Frauenpolitik und ihre Auswirkungen auf lesbische Frauen
- Bevölkerungspolitik und die Diskriminierung von kinderlosen und ledigen Frauen, die besonders lesbische Frauen betraf
- Die rechtliche Grundlage und die Zerschlagung der Homosexuellenbewegung, inklusive der Unterschiede in der österreichischen Gesetzgebung nach der Annexion 1938
- Die Situation lesbischer Frauen in Konzentrationslagern
- Autobiographische und biographische Zeitzeugenberichte als wichtige Quelle für die Rekonstruktion des Alltagslebens lesbischer Frauen in dieser Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Nationalsozialistische Frauenpolitik
Dieser Abschnitt analysiert die nationalsozialistische Frauenpolitik und deren Einfluss auf lesbische Frauen. Die NS-Frauenideologie, die „arische“ und „erbgesunde“ Frauen idealisierte, sah die Frau in der Rolle der Mutter und Ehefrau. Die Erhöhung der Geburtenrate war ein zentrales Ziel, das durch Maßnahmen wie die Förderung von Eheschließungen, die Bestrafung von Abtreibungen und die Einführung von „Strafsteuersätzen“ für kinderlose Paare umgesetzt werden sollte.
Bevölkerungspolitik und weibliche Homosexualität
Dieser Abschnitt zeigt auf, wie die nationalsozialistische Bevölkerungspolitik lesbische Frauen besonders betraf. Aufgrund der Stigmatisierung von Ledigen und Kinderlosen sahen sich viele lesbische Frauen gezwungen, zu heiraten, um sich vor Verdächtigungen zu schützen. Die Angst vor Verfolgung führte zu Verhaltensänderungen, wie z.B. der Veränderung des Äußeren und dem Rückzug aus homosexuellen Kreisen. Die Josefsehe, eine Scheinehe zwischen homosexuellen Männern und Frauen, war ebenfalls verbreitet.
Strafverfolgung und weibliche Homosexualität
Der Abschnitt thematisiert die Strafrechtsdebatten im Reichsjustizministerium über die Erweiterung des § 175 StGB auf lesbische Frauen. Während die Bestrafung von Homosexualität eine lange Tradition hatte, sah der § 175 des Strafgesetzbuches der Kaiserzeit, den die Nationalsozialisten übernommen hatten, die Bestrafung weiblicher Homosexualität nicht vor. Der Fokus lag auf der Bestrafung männlicher Homosexualität, da sie als größere Gefahr für den „Volkskörper“ angesehen wurde. Die unterschiedliche Bewertung von männlicher und weiblicher Homosexualität ist auf das patriarchalische Weltbild der Nationalsozialisten zurückzuführen, das Frauen eine eigene Sexualität verweigerte.
Schlüsselwörter
Nationalsozialistische Frauenpolitik, Bevölkerungspolitik, weibliche Homosexualität, Strafverfolgung, § 175 StGB, Konzentrationslager, Zeitzeugenberichte, Rassenhygiene, Homophobie, Josefsehe, Patriarchat.
- Citation du texte
- Imke Bittner (Auteur), 2001, Zeit der Traurigkeit - lesbischer Alltag im Nationalsozialismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2162