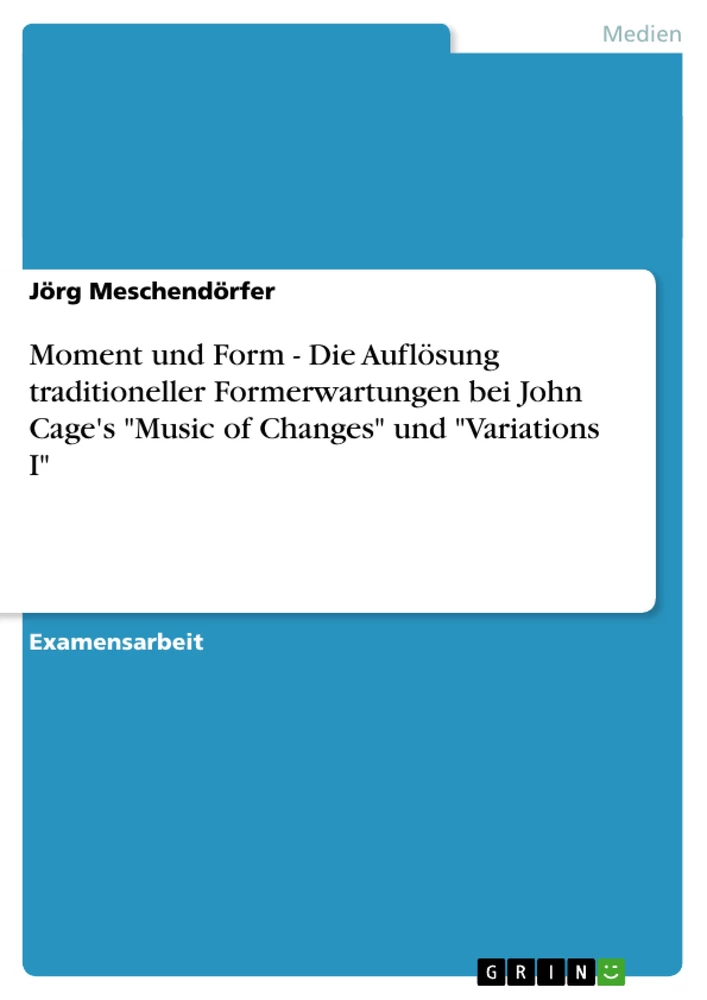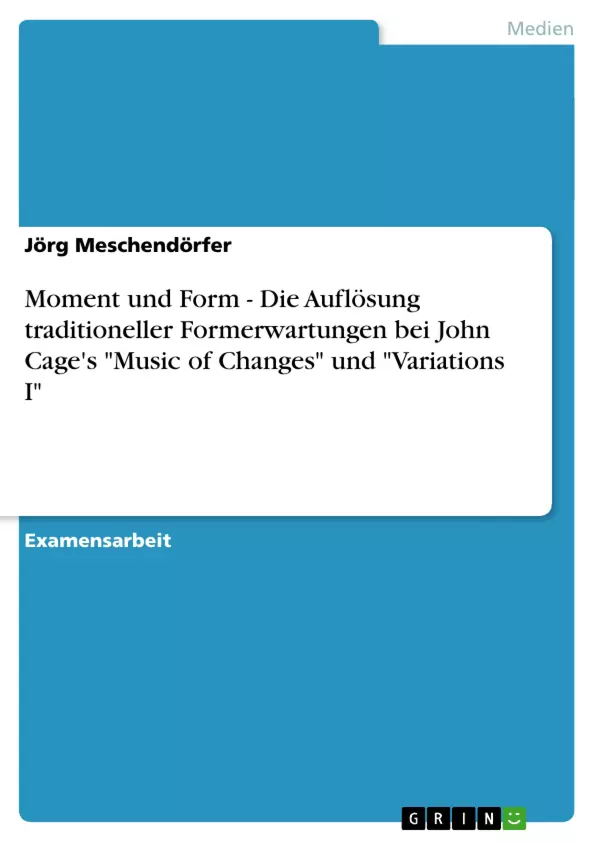Die Kunst von John Cage hat innerhalb der mächtigen Umwälzungsbewegungen in der Kunstmusik im Laufe des 20 Jahrhunderts einen Sonderplatz eingenommen. Im Zuge des zunehmenden Bedürfnisses nach Verstärkung der Kontrolle des Komponisten (insbesondere innerhalb der Richtung des Serialismus) über die musikalischen Parameter inder zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich John Cage im Laufe seines Schaffensprozesses zu einem Gegenpol zu dieser Entwicklung. Sein sich zunehmend radikalisierender Rückzug aus der Kontrolle des Komponisten über Form, musikalische Sprache, Material, Besetzung, Struktur und sein völlig neues Verständnis von dem Verhältnis von Komponist zu Interpret und Hörer, seine Erforschung neuer Klangwelten (auch innerhalb des traditionellen Instrumentariums) und das Suchen einesneuen - dem 20. Jahrhundert angemessenen - Sinns von Musik (um nur einige Aspektezu nennen) hat das gesamte Musikdenken nachhaltig beeinflusst. Sein sehr eigener Weg hat ihn aber auch von allem entfernt, was wir traditionell unter Musik verstehen, und ihn herber Kritik von allen Richtungen ausgesetzt; Und die ästhetische Diskussion ist noch längst nicht abgeschlossen. Cage hat eine langanhaltende Debatte in Gang gebracht darüber, was wir unter Musik verstehen und von ihr erwarten. Seine ästhetische Kehrtwende ist enorm und hat vielen der musikalischen Avantgarde an sich zugewandten Musikern und Experten „Kopfschmerzen” bereitet. Viele Skandalaufführungen säumen seinen „Weg“. Viele musikalische Größen der Zeit, die sich ihmzunächst neugierig annäherten, haben sich später abgewandt, darunter Stockhausen und Boulez. Cage steht außerdem nicht nur für ein einziges bestimmtes spezifisches Merkmal. Man kann ihn nicht nur auf ein Schlagwort wie „Aleatorik“ reduzieren. Diese Aleatorik hat viele sich wandelnde Gesichter. Er steht daneben genauso symbolisch fürdas „präparierte Klavier“, was wiederum nur ein Symbol für die Auslotung derKlangeigenschaften aller Musikinstrumente außerhalb der Wege traditioneller Klangerzeugung sein kann. Auch das Verständnis des multimedialen „Happenings“ hat er sicherlich mitgeprägt; Nicht zu vergessen das ganz besonders zu verstehende Element der „Stille“. Sein unermüdlich wiederholter Leitspruch „die Musik mit dem Leben gleichsetzen“ deutet bereits an, welche Umstellung der traditionelle „Beethoven-Hörer“ zu durchlaufen hat, um sich dieser Kunst anzunähern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung Rechtfertigung des Themas
- Ein Überblick über die Grundästhetik was wir unter,,Musik“ im Kontext des
Europäischen Kunstverständnisses bis in das 20. Jahrhundert hinein verstehen- Ästhetische Identifikation: Musik - ein Spiel?
- Bild und Emotion - die „Bedeutung“ in der Musik
- Musik als Reizgebilde - Klangfarben, Abbildlichkeit und außermusikalische Inhalte
- Werkidentität
- Erkennendes Verstehen
- Kurze Zusammenfassung der Situation in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
- Cages Entwicklung hin zu einer neuen Idee von Musik
- Cages Persönlichkeit - Neugier auf Unbekanntes und der Entschluss, einen
eigenen Weg zu beschreiten - Geräusche. Die Isolation der Töne. Allklang. Stille
- Der Moment - Zeit und Zeitbegriff. Struktur
- Emotion. Rückzug der Persönlichkeit. Indische Philosophie und Zen
- Anarchismus und „Offenheit für alles“ - Musik und Leben. Beurteilung von Musik
- Raum und Darstellung. Das multimediale Happening. Notation
- Aleatorik und Indetermination
- Cages Persönlichkeit - Neugier auf Unbekanntes und der Entschluss, einen
- Betrachtung der kompositorischen Prämissen Cages anhand der Music of Changes
und der Variations I. Analyse und Hintergründe- Music of Changes
- Variations I
- Musik?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Auflösung traditioneller Formerwartungen in John Cages Musik, insbesondere in seinen Werken "Music of Changes" und "Variations I". Der Schwerpunkt liegt auf Cages Entwicklung eines neuen Musikverständnisses, das sich von etablierten Konzepten des 20. Jahrhunderts abgrenzt.
- Cages Abkehr von konventionellen Kompositionsmethoden und seine Hinwendung zur Aleatorik und Indetermination.
- Die Rolle von Zufall und Unbestimmtheit in Cages Musik und die Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Form und Struktur.
- Die Bedeutung von Stille und die Erweiterung des Klangbegriffs in Cages Werk.
- Die Beziehung zwischen Musik, Leben und Philosophie in Cages Denken.
- Die ästhetische Diskussion um Cages Musik und ihre Rezeption im Kontext des 20. Jahrhunderts.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert John Cage als eine einflussreiche Persönlichkeit, die traditionelle Musikvorstellungen in Frage stellte und einen neuen Weg für die Musik des 20. Jahrhunderts eröffnete. Sie betont die Bedeutung seiner Entscheidung, sich von der Kontrolle des Komponisten über Form und Struktur zu lösen und neue Klangwelten zu erforschen.
Das zweite Kapitel stellt die gängigen ästhetischen Konzepte von Musik im europäischen Kontext vor dem Hintergrund des 20. Jahrhunderts dar. Es untersucht, wie Musik mit Emotionen, Bildern und außermusikalischen Inhalten verbunden wird und wie die Frage nach "Bedeutung" in der Musik im Laufe der Zeit behandelt wurde.
Das dritte Kapitel beleuchtet die musikalische Situation in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es skizziert die Strömungen, die Cages Werk beeinflussten und den Kontext für seine revolutionären Ideen schaffen.
Kapitel vier untersucht Cages Entwicklung hin zu einem neuen Musikverständnis. Es beleuchtet seine Persönlichkeit, seine Suche nach dem Unbekannten und seinen Rückzug von traditionellen Kompositionsmethoden. Das Kapitel beschäftigt sich mit Cages Beschäftigung mit Geräuschen, Stille, dem Moment und der Zeit, mit Emotion und Philosophie. Weiterhin wird die Rolle von Anarchismus und „Offenheit für alles“ in Cages Denken und seine Konzeption von Raum, Darstellung und Notation erörtert.
Kapitel fünf betrachtet Cages kompositorische Prämissen anhand von "Music of Changes" und "Variations I". Es analysiert die Werke und beleuchtet die Hintergründe ihrer Entstehung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie John Cage, Aleatorik, Indetermination, „Music of Changes“, „Variations I“, Stille, Form, Struktur, Zeit, Emotion, Musik und Leben, Anarchismus, Offenheit für alles, Raum, Darstellung, Notation, Kompositionsprinzipien, ästhetische Diskussion und Musikverständnis des 20. Jahrhunderts.
Häufig gestellte Fragen
Wie veränderte John Cage das traditionelle Musikverständnis?
Cage löste die Kontrolle des Komponisten über Form, Struktur und Material auf. Er integrierte Zufall, Stille und Alltagsgeräusche in seine Werke und definierte das Verhältnis zwischen Komponist, Interpret und Hörer neu.
Was bedeuten Aleatorik und Indetermination in Cages Werk?
Diese Begriffe beschreiben den Einsatz von Zufallsoperationen bei der Komposition oder Aufführung, wodurch das musikalische Ergebnis nicht mehr vollständig vorherbestimmt ist.
Welche Rolle spielt die Stille in der Musik von John Cage?
Stille wird bei Cage als eigenständiges Element verstanden, das den Hörer für die Umgebungsgeräusche öffnet und die Grenze zwischen Kunst und Leben verwischt.
Was symbolisiert das "präparierte Klavier"?
Es steht für die Erforschung neuer Klangwelten außerhalb traditioneller Klangerzeugung, indem Gegenstände in die Saiten eingefügt werden, um den Klangcharakter zu verändern.
Welche philosophischen Einflüsse prägten Cages Denken?
Besonders die indische Philosophie und der Zen-Buddhismus beeinflussten Cages Streben nach dem Rückzug der Persönlichkeit und der Offenheit für den gegenwärtigen Moment.
Welche Werke werden in dieser Analyse detailliert betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von "Music of Changes" und "Variations I", um Cages kompositorische Prämissen zu verdeutlichen.
- Quote paper
- Jörg Meschendörfer (Author), 2002, Moment und Form - Die Auflösung traditioneller Formerwartungen bei John Cage's "Music of Changes" und "Variations I", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21751