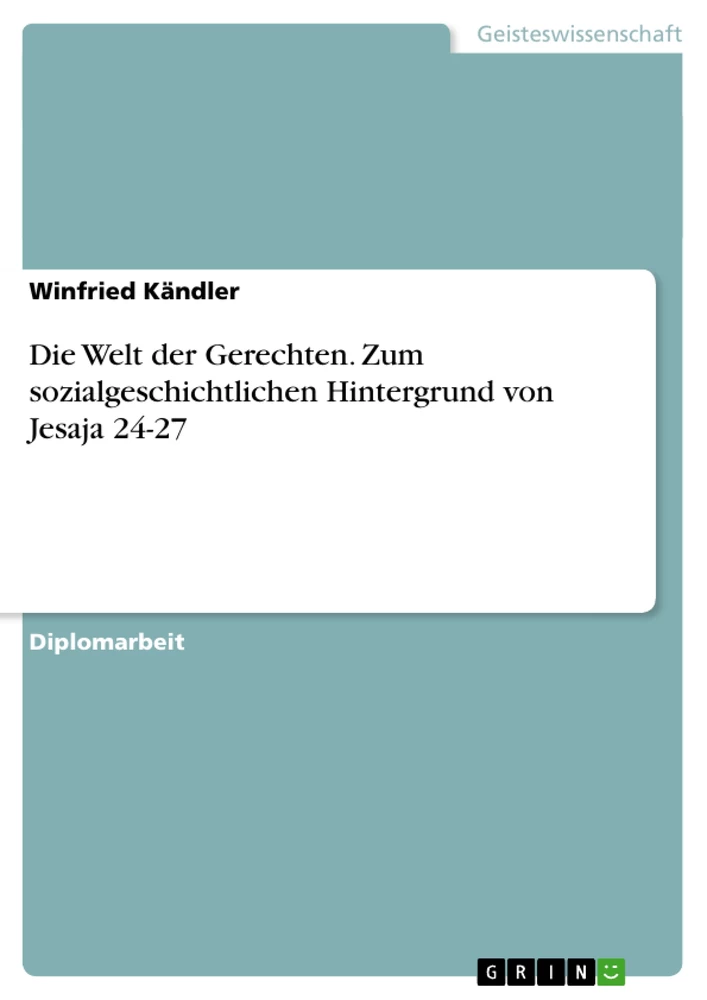Der Text Jes 24-27 gehört zu einem der umstrittensten im Ersten Testament.
Nahezu jede Frage erfährt voneinander erheblich differierende Antworten, sei es
die Frage nach seinem Aufbau, seiner Einheitlichkeit oder einem möglichen
Wachstum, die Frage nach seinem Ort innerhalb traditionsgeschichtlicher
Entwicklungen, womit auch die Frage nach seinem Verhältnis zur Apokalyptik
verbunden ist. Umstritten sind ebenso gattungs- und formkritische Zuordnungen
der einzelnen Abschnitte, und nicht zuletzt seine historische Einordnung und damit
verknüpft die Identität der Stadt, die in diesem Text einen bedeutenden Platz
einnimmt. Von einem Konsens ist die Forschung weit entfernt. Nur am Rande
allerdings wurde die sozialgeschichtliche Fragestellung an diesen Text
herangetragen. Deshalb wird diese Frage in der vorliegenden Arbeit im Mittelpunkt
stehen. Es soll untersucht werden, in welcher Weise der Text die sozialen,
ökonomischen, politischen sowie kulturellen Bedingungen des gesellschaftlichen
Kontextes seiner Entstehungszeit widerspiegelt, und wie er versucht, diese
Verhältnisse theologisch zu reflektieren.
Kurz sei zu Beginn das Vorgehen skizziert. In einem ersten Schritt wird die
Einheitlichkeit des Textes begründet. Daran schließt sich der Vorschlag einer
Gliederung an, der versucht, der Komposition des Textes gerecht zu werden. Im
Hauptteil der Arbeit beleuchte ich den sozialgeschichtlichen Hintergrund von
Jes 24-27. Dabei gehe ich zuerst Hinweisen nach, die der Text über
gesellschaftliche Zustände und Konfliktkonstellationen gibt. Von diesen Indizien
ausgehend wird eine historische Einordnung des Textes versucht. Im Anschluss
daran erfolgt eine ausführliche Beschäftigung mit der Situation und den
Vorstellungen der Gruppe der Gerechten, aus deren Perspektive der Text
vermutlich verfasst worden ist. Einen besonderen Platz nimmt in diesem
Zusammenhang das Motiv der Stadt ein. Die Auseinandersetzung mit seinen
sozialgeschichtlichen und theologischen Implikationen erfolgt deshalb in einem
eigenen Abschnitt. Der Versuch einer genaueren Charakterisierung der
TrägerInnengruppe sowie eine Verortung von Jes 24-27 innerhalb des
theologischen Diskurses seiner Entstehungszeit durch eine Verhältnisbestimmung
zu anderen ausgewählten zeitgenössischen Theologien und Texten bilden den
Abschluss der Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Text
- Die Einheitlichkeit des Textes
- Der Text als Einheit
- Auseinandersetzung mit literarkritischen Eingriffen
- Gliederung
- Die Einheitlichkeit des Textes
- Zum sozialgeschichtlichen Hintergrund
- Gesellschaftliche Ausdifferenzierung und Konfliktlagen
- Datierung
- Die Gerechten
- Die Selbstbezeichnungen
- Die gegenwärtige Situation – Jes 26,7-21
- Die Zukunftsvorstellungen
- Das Gericht
- Die Heilsvorstellungen
- Die Stadt
- Die Identität der Stadt
- Sozialgeschichtliche Implikationen des Stadtmotivs
- Das Verhältnis Stadt - Land
- Der Einfluss hellenistischer Stadtkultur in Judäa
- Der Ort von Jes 24-27 in der frühhellenistischen Gesellschaft Judäas
- Die TrägerInnengruppe
- Eine theologische Einordnung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem sozialgeschichtlichen Hintergrund von Jes 24-27. Sie untersucht, wie der Text die sozialen, ökonomischen, politischen und kulturellen Bedingungen seiner Entstehungszeit widerspiegelt und diese Verhältnisse theologisch reflektiert.
- Einheitlichkeit und Gliederung des Textes Jes 24-27
- Gesellschaftliche Zustände und Konfliktkonstellationen in der Zeit des Textes
- Die Situation und Vorstellungen der Gruppe der Gerechten im Text
- Das Motiv der Stadt in Jes 24-27 und seine sozialgeschichtlichen und theologischen Implikationen
- Einordnung des Textes innerhalb des theologischen Diskurses seiner Entstehungszeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung erläutert die Relevanz des Textes Jes 24-27 für die wissenschaftliche Forschung und stellt die Forschungsfrage nach dem sozialgeschichtlichen Hintergrund des Textes. Sie skizziert die Vorgehensweise der Arbeit, die die Einheitlichkeit des Textes begründet, eine Gliederung vorschlägt und anschließend den sozialgeschichtlichen Kontext beleuchtet. Die Analyse der Situation der Gerechten und des Stadtmotivs bildet einen weiteren Schwerpunkt. Schließlich erfolgt eine Einordnung des Textes innerhalb des theologischen Diskurses seiner Entstehungszeit.
Der Text: Dieses Kapitel behandelt die Einheitlichkeit des Textes Jes 24-27 und befasst sich mit den literarkritischen Eingriffen in die Forschung. Es argumentiert für die Einheit des Textes und präsentiert stilistische Besonderheiten, die auf die Einheitlichkeit hindeuten.
Zum sozialgeschichtlichen Hintergrund: Das Kapitel untersucht den sozialgeschichtlichen Hintergrund des Textes Jes 24-27 und beleuchtet die gesellschaftlichen Ausdifferenzierung und Konfliktlagen, die der Text impliziert. Es geht auf die Datierung des Textes ein und befasst sich ausführlich mit der Situation und den Vorstellungen der Gruppe der Gerechten. Das Motiv der Stadt und seine sozialgeschichtlichen Implikationen werden ebenfalls behandelt.
Der Ort von Jes 24-27 in der frühhellenistischen Gesellschaft Judäas: Dieser Abschnitt analysiert die TrägerInnengruppe des Textes und ordnet Jes 24-27 innerhalb des theologischen Diskurses seiner Entstehungszeit ein.
Schlüsselwörter
Jes 24-27, Sozialgeschichte, Gerechte, Stadt, Frühhellenismus, Judäa, Theologie, Gesellschaftliche Verhältnisse, Konfliktlagen, Stadtkultur, Textanalyse, Literarkritik, Einheitlichkeit, TrägerInnengruppe, Einordnung
- Citar trabajo
- Winfried Kändler (Autor), 2002, Die Welt der Gerechten. Zum sozialgeschichtlichen Hintergrund von Jesaja 24-27, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21808