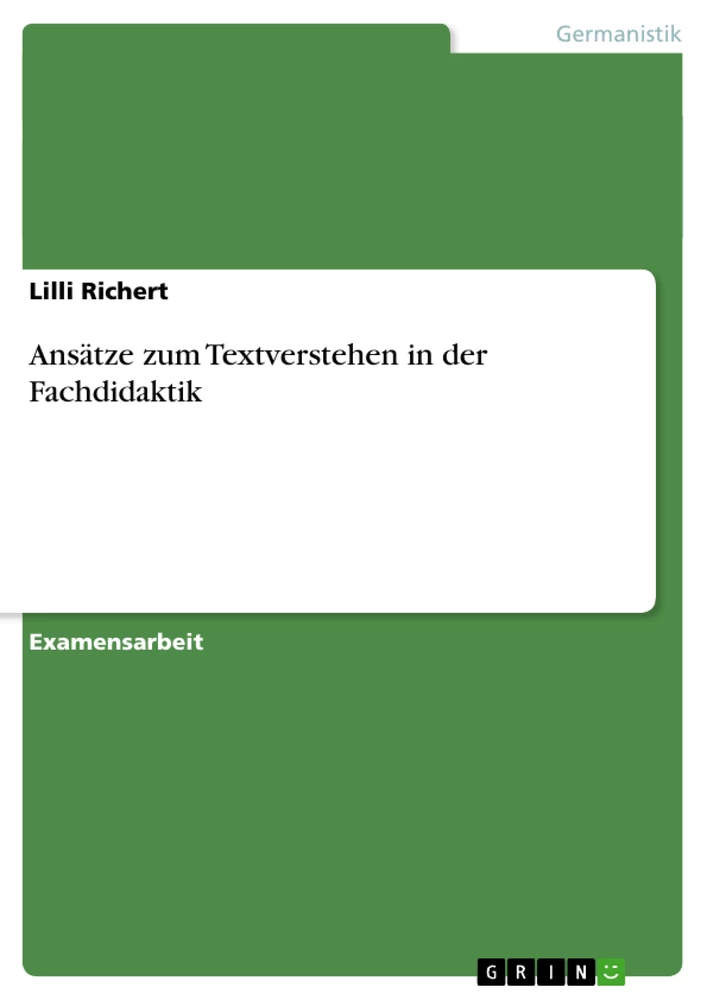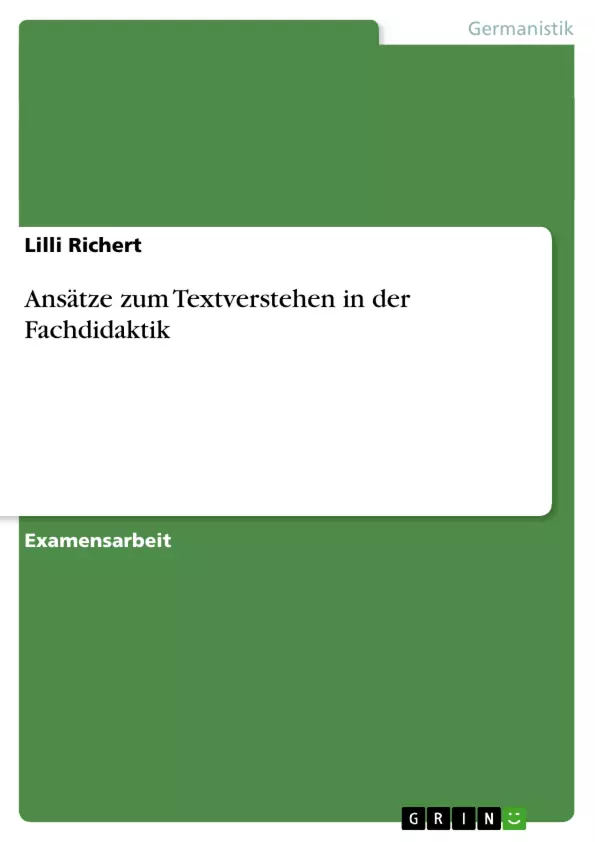[...] Die Vermittlung zwischen Theorie und Praxis scheint in der Didaktik ein Problem zu
sein. Beklagt werden neben „methodischen Handreichungen ohne didaktische
Fundierung, (...) auch viele didaktische Publikationen ohne den geringsten Bezug zur
Praxis“. (Blattmann & Frederking, 2002, 7) Es zeigt sich eine Diskrepanz zwischen
den von der Gesellschaft geforderten Notwendigkeiten und ihrer Umsetzung. Die
Notwendigkeit besteht unter anderem in der Förderung einer Lesekompetenz, die sich nicht ausschließlich auf literarische Textes bezieht, sondern „auch Gebrauchstexte mit
all ihrer Facettenhaftigkeit von der reinen Information (...) bis hin zu schieren
Appelation (...) durchdringbar“ macht. (Hahn, 1999, 10) Der Umsetzung dieser
Forderung wird zwar in gewisser Weise nachgekommen, sie fußt jedoch häufig nicht
auf der breiten theoretischen und empirischen Grundlage, die eigentlich möglich
wäre.
Mit dieser Arbeit soll darum ein Versuch gewagt werden, diesem Defizit zu
begegnen. Dazu sollen zunächst Ansätze zum Textverstehen dargestellt werden. Nach
einer Einordnung in den wissenschaftsgeschichtlichen Kontext erfolgt die Darstellung
von Ebenen des Textverstehens, um Grundlagen für anschließende richtungweisende
Verstehenstheorien zu legen. Hierauf folgen Überlegungen zur Interaktion im
Verstehensprozess und zur Situation, dem Rahmen des Verstehens. Um die
Übertragung der Befunde auf die Anwendung schrittweise zu vollziehen, werden im
Anschluss an die Verstehenstheorien zwei Konzepte der Lesekompetenz vorgestellt
und mit den Ansätzen zum Textverstehen verglichen. Die Schlussfolgerungen aus
diesem Vergleich dienen Überlegungen, was eine Methode enthalten müsste, die
Textverstehen bei Schülerinnen und Schülern fördern will. Anhand von bereits
bestehenden Ratschlägen und Strategien wird diese Methode dann konstruiert.
Überlegungen zur möglichen Integration in die Didaktik runden die Arbeit ab.
In der Didaktik wird sowohl die theoretische Fundierung als auch die Relevanz für
die Praxis beklagt. Mit dieser Arbeit wird ein Weg aus der Theorie in die Praxis
gesucht, um das aktuelle Problem der mangelnden Lesekompetenz anzugehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ansätze zum Textverstehen
- Wissenschaftsgeschichtlicher Kontext
- Ebenen des Verstehens
- Die sensorische Rezeption
- Die Bedeutung der Wörter
- Die Satzverarbeitung
- Die semantische Rezeption
- Die pragmatische Rezeption
- Verstehenstheorien
- Das Konstruktions-Integrations-Modell von Walter Kintsch
- Vorüberlegungen
- Konstruktion und Integration
- Der Kontext der Theorie
- Die Theorie mentaler Modelle von Philipp N. Johnson-Laird
- Die Interaktion
- Die Situation
- Konzepte der Lesekompetenz
- Lesekompetenz nach Hurrelmann und Groeben
- Die Kompetenz
- Die Dimensionen
- Einflussfaktoren und Bedingungen
- Das Konzept und die Theorien im Vergleich
- Kognitive Elemente
- Die Situation
- Schlussfolgerungen
- Lesekompetenz nach PISA
- Rahmenbedingungen
- Das Konzept
- Das Konzept und die Theorien im Vergleich
- Überlegungen zur Umsetzung
- Entwicklung einer Methode
- Notwendige Bestandteile der Methode
- Bestehende Mikro- und Mesostrategien
- Mikrostrategien
- Der Text
- Das Wissen
- Die Darstellung
- Die Motivation
- Mesostrategien
- Die SQ3R-Methode
- Das MURDER-Schema
- REDUTEX
- Vorteile einer Mesostrategie
- Die Effektivität von Lernstrategien
- Die Methode
- Der Aufbau der Methode
- Die Rahmenbedingungen
- Anbindung an die Fachdidaktik
- Eine Aufgabe der Fachdidaktik
- Einordnung in den Diskussionskontext
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, Ansätze zum Textverstehen in die Didaktik des Faches Deutsch zu übertragen und in Form einer praktischen Anwendung zu implementieren. Ausgehend von der bekannten geringen Lesefähigkeit deutscher Schülerinnen und Schüler, wie zuletzt durch die PISA-Studie (2001) bestätigt, soll die Arbeit die Förderung von Textverstehen als zentrale Kompetenz in den Fokus rücken. Die Arbeit beleuchtet, wie die Didaktik des Faches Deutsch diese Defizite angehen kann, indem sie sich mit verschiedenen Theorien zum Textverstehen auseinandersetzt und diese in Bezug auf ihre Relevanz für den Unterricht reflektiert.
- Analyse von Ansätzen zum Textverstehen im Kontext der kognitiven Sprachverarbeitungsforschung
- Untersuchung verschiedener Ebenen des Textverstehens
- Darstellung und Vergleich von Verstehenstheorien, insbesondere des Konstruktions-Integrations-Modells und der Theorie mentaler Modelle
- Konzeption und Entwicklung einer Methode zur Förderung von Textverstehen im Unterricht
- Integration der entwickelten Methode in die Didaktik des Faches Deutsch
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit der Problematik der geringen Lesefähigkeit von Schülerinnen und Schülern in Deutschland, die zuletzt durch die PISA-Studie (2001) bestätigt wurde. Sie zeigt auf, dass die Didaktik des Faches Deutsch die Förderung der Lesekompetenz bisher nur unzureichend berücksichtigt hat. Die Arbeit legt dar, wie die Integration von Textverstehenstheorien in die Didaktik des Faches Deutsch dazu beitragen kann, diese Defizite zu überwinden.
Das zweite Kapitel widmet sich den Ansätzen zum Textverstehen. Es beleuchtet den wissenschaftsgeschichtlichen Kontext, beschreibt verschiedene Ebenen des Textverstehens und stellt wichtige Verstehenstheorien vor, darunter das Konstruktions-Integrations-Modell von Walter Kintsch und die Theorie mentaler Modelle von Philipp N. Johnson-Laird. Des Weiteren werden die Interaktion im Verstehensprozess und die Situation, die den Rahmen des Verstehens bildet, erläutert.
Kapitel drei stellt zwei Konzepte der Lesekompetenz vor und vergleicht diese mit den Ansätzen zum Textverstehen. Es wird die Lesekompetenz nach Hurrelmann und Groeben und die Lesekompetenz nach PISA beleuchtet und ihre Relevanz für die Förderung von Textverstehen im Unterricht diskutiert.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Entwicklung einer Methode zur Förderung von Textverstehen bei Schülerinnen und Schülern. Es analysiert notwendige Bestandteile der Methode und untersucht bestehende Mikro- und Mesostrategien. Anhand dieser Erkenntnisse wird eine eigene Methode konstruiert, die den Anforderungen des Unterrichts gerecht werden soll.
Kapitel fünf widmet sich der Anbindung der entwickelten Methode an die Fachdidaktik. Es wird diskutiert, wie die Methode in den Unterricht integriert werden kann und welche Relevanz sie für die Didaktik des Faches Deutsch hat.
Schlüsselwörter
Textverstehen, Lesekompetenz, Didaktik des Faches Deutsch, Verstehenstheorien, Konstruktions-Integrations-Modell, Theorie mentaler Modelle, Mikro- und Mesostrategien, Unterrichtsmethode.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Problem der Lesekompetenz in Deutschland laut PISA?
Die PISA-Studien zeigten erhebliche Defizite bei deutschen Schülern auf, was die Notwendigkeit einer stärkeren theoretischen Fundierung in der Fachdidaktik unterstreicht.
Welche Verstehenstheorien werden in der Arbeit vorgestellt?
Zentral sind das Konstruktions-Integrations-Modell von Walter Kintsch und die Theorie mentaler Modelle von Philipp N. Johnson-Laird.
Was sind Mikro- und Mesostrategien beim Textverstehen?
Mikrostrategien beziehen sich auf Wissen und Motivation, während Mesostrategien komplexe Schemata wie die SQ3R-Methode oder das MURDER-Schema umfassen.
Welche Ebenen des Verstehens unterscheidet die Arbeit?
Die Ebenen reichen von der sensorischen Rezeption über Wortbedeutung und Satzverarbeitung bis hin zur semantischen und pragmatischen Rezeption.
Wie kann Textverstehen im Unterricht gefördert werden?
Die Arbeit schlägt die Entwicklung einer Methode vor, die kognitive Elemente und die spezifische Situation des Lesers integriert, um die Lesefähigkeit nachhaltig zu steigern.
- Arbeit zitieren
- Lilli Richert (Autor:in), 2003, Ansätze zum Textverstehen in der Fachdidaktik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21879