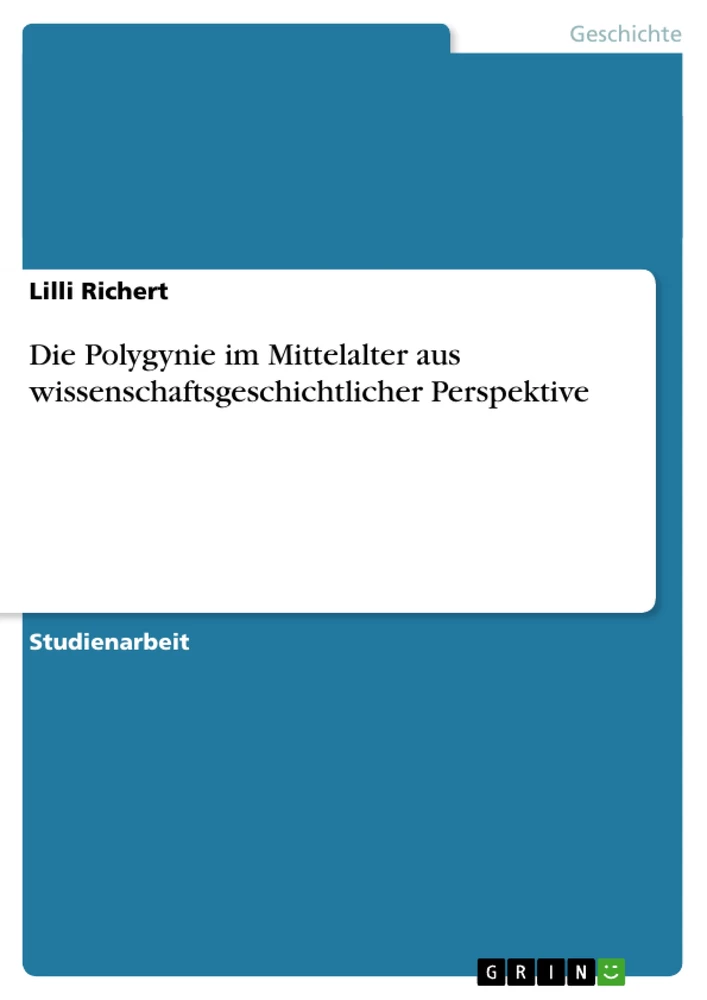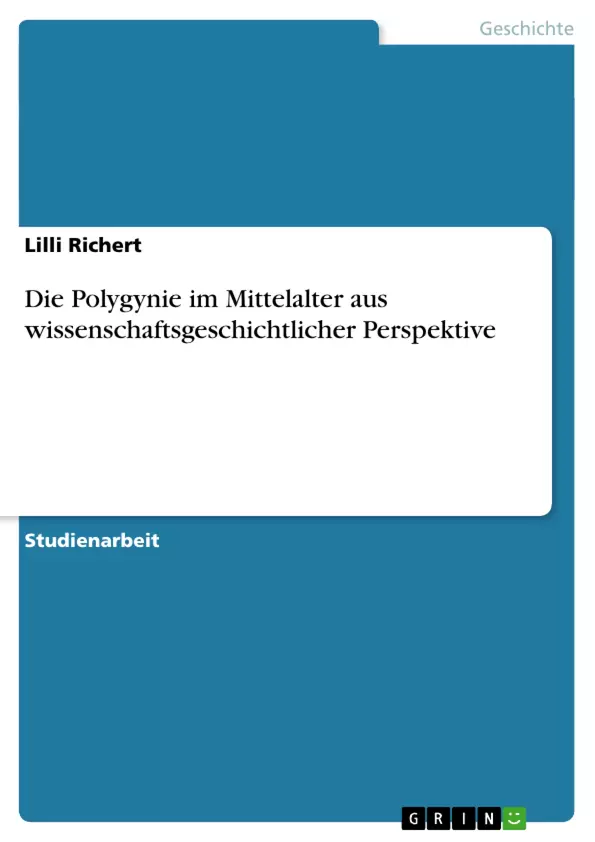Das Thema dieser Hausarbeit ist die Polygynie im Mittelalter aus wissenschaftsgeschichtlicher Perspektive. Mit der Polygynie im Mittelalter rückt ein Gegenstand ins Blickfeld, der vor allem nach den Thesen Jack Goodys von Bedeutung ist.
„Um zu wachsen und zu überleben, musste die Kirche Besitz anhäufen, und das hieß: die Kontrolle darüber erreichen, wie Besitz von einer Generation an die nächste übertragen wurde. Da die Verteilung des Besitzes zwischen den Generationen verknüpft ist mit den Heiratsmustern und der Legitimität von Kindern, musste die Kirche darüber Macht gewinnen, um die Erbschaftsstrategie beeinflussen zu können“1. Einer der Bereiche, in welche die Kirche eingriff, ist laut Goody die Polygynie. Auf Grund des Zurückdrängens der Polygynie durch die Kirche wurde eine der Möglichkeiten legitime Erben einzusetzen, zunichte gemacht. Die Kirche erhöhte somit ihre Chancen, dass ihr das Erbe zufiel.
Goodys Überlegungen werden zwar als monokausale Deutungen2 kritisiert, dies soll jedoch nicht von einer eingehenden Überprüfung der These abhalten. Der von Goody angegebene Grund, die Besitzakkumulation der Kirche, ist zwar einseitig, doch baut er auf einer Grundlage, nämlich, dass die Kirche die Polygynie verdrängt haben soll. Dieser Grundlage soll mit dieser Arbeit nachgegangen werden. Dabei ist nicht nur ein gegenwärtiger Standpunkt der Wissenschaft zur Polygynie im Mittelalter von Interesse. Es stellt sich die Frage, wie von der deutschen Forschung ausgehend die Polygynie diskutiert wurde, um eventuelle Anknüpfungspunkte für die These Goodys zu finden. Die wissenschaftsgeschichtliche Perspektive ist notwendig, um gewissermaßen als Standortbestimmung darzustellen, in welcher Form die Polygynie bisher betrachtet wurde. Von dieser Perspektive aus können dann Überlegungen angestellt werden, wie sicher die Grundlage von Goodys Argumentation ist oder in welche Richtung weitere Forschungen erfolgen müssten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Polygynie in rechtshistorischen Werken
- 2.1 Am Ende des 19. Jahrhunderts
- 2.2 Die Polygynie im Kontext der Kebs-, Friedel- und Muntehe
- 2.3 Eine strafrechtliche Perspektive
- 3. Die Polygynie und das Christentum
- 3.1 Diskussionen um die Polygynie
- 3.2 Umgang der Kirche mit der Polygynie
- 4. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Polygynie im Mittelalter aus wissenschaftsgeschichtlicher Perspektive. Sie prüft die These Jack Goodys, wonach die Kirche die Polygynie zurückgedrängt hat, um ihre Macht über die Erbfolge und Besitzakkumulation zu stärken. Die Arbeit analysiert, wie die deutsche Forschung die Polygynie diskutiert hat und welche Anknüpfungspunkte für Goodys These bestehen.
- Wissenschaftsgeschichtliche Entwicklung der Diskussion um Polygynie im Mittelalter
- Analyse rechtshistorischer Werke und ihrer Darstellung der Polygynie
- Der Einfluss des Christentums auf die Verbreitung und Akzeptanz der Polygynie
- Bewertung von Goodys These zur Rolle der Kirche bei der Unterdrückung der Polygynie
- Identifizierung von Forschungslücken und zukünftigen Forschungsansätzen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Polygynie im Mittelalter ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Gültigkeit von Jack Goodys These über den Einfluss der Kirche auf die Unterdrückung der Polygynie vor. Goodys These wird als Ausgangspunkt der Arbeit vorgestellt und gleichzeitig auf deren monokausale Deutung hingewiesen. Die Einleitung betont die Notwendigkeit einer wissenschaftsgeschichtlichen Perspektive, um den bisherigen Forschungsstand zu beleuchten und zukünftige Forschungsrichtungen aufzuzeigen. Der Mangel an separaten Untersuchungen zur Polygynie im Mittelalter wird hervorgehoben, und der Fokus der Arbeit auf die Analyse von Diskussionskontexten in Nachschlagewerken wird begründet.
2. Die Polygynie in rechtshistorischen Werken: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung der Polygynie in rechtshistorischen Werken, insbesondere am Ende des 19. Jahrhunderts. Es zeigt, dass die Polygynie in damaligen Nachschlagewerken und Enzyklopädien kaum Beachtung fand. Die vorherrschende Vorstellung einer monogamen Ehe bei den Germanen wird untersucht, welche die Berücksichtigung von Polygynie ausschloss. Die Kapitel beleuchtet die moralische Überhöhung der germanischen Ehe und ihren Einfluss auf die wissenschaftliche Wahrnehmung der Polygynie. Die fehlende Diskussion der Polygynie im Kontext von Erbfolgeregelungen für uneheliche Kinder wird ebenfalls thematisiert.
Schlüsselwörter
Polygynie, Mittelalter, Wissenschaftsgeschichte, Rechtsgeschichte, Christentum, Kirche, Jack Goody, Erbrecht, Ehe, Familie, Germanen, Monogamie, Besitzakkumulation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wissenschaftsgeschichtliche Analyse der Polygynie im Mittelalter
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Polygynie (Vielweiberei) im Mittelalter aus wissenschaftsgeschichtlicher Perspektive. Sie analysiert die Diskussion um die Polygynie in der deutschen Forschung und prüft die These von Jack Goody, wonach die Kirche die Polygynie zurückgedrängt hat, um ihre Macht über Erbfolge und Besitzakkumulation zu stärken.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die wissenschaftsgeschichtliche Entwicklung der Diskussion um Polygynie im Mittelalter, analysiert rechtshistorische Werke und deren Darstellung der Polygynie, untersucht den Einfluss des Christentums auf die Verbreitung und Akzeptanz der Polygynie, bewertet Goodys These zur Rolle der Kirche bei der Unterdrückung der Polygynie und identifiziert Forschungslücken und zukünftige Forschungsansätze.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit analysiert vor allem rechtshistorische Werke, insbesondere Nachschlagewerke und Enzyklopädien vom Ende des 19. Jahrhunderts. Sie untersucht, wie die Polygynie in diesen Werken dargestellt wurde und welche Rolle die Vorstellung einer monogamen Ehe bei den Germanen spielte.
Welche These von Jack Goody wird untersucht?
Die Arbeit untersucht die These von Jack Goody, wonach die Kirche die Polygynie im Mittelalter unterdrückt hat, um ihre Macht über Erbfolge und Besitzakkumulation zu stärken. Die Arbeit hinterfragt dabei die monokausale Deutung dieser These und sucht nach weiteren Erklärungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Einleitung, Die Polygynie in rechtshistorischen Werken (inkl. Unterkapitel zu verschiedenen Aspekten und Perspektiven), Die Polygynie und das Christentum (inkl. Diskussionen um die Polygynie und den Umgang der Kirche damit) und Resümee.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Zusammenfassung der Kapitel liefert detaillierte Einblicke in die jeweiligen Ergebnisse. Die Arbeit identifiziert Forschungslücken und schlägt zukünftige Forschungsansätze vor, um die Rolle der Polygynie im Mittelalter umfassender zu verstehen. Die Bewertung der These von Jack Goody wird im Resümee zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Polygynie, Mittelalter, Wissenschaftsgeschichte, Rechtsgeschichte, Christentum, Kirche, Jack Goody, Erbrecht, Ehe, Familie, Germanen, Monogamie, Besitzakkumulation.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler*innen, Studierende und alle Interessierten, die sich mit der Geschichte des Mittelalters, der Rechtsgeschichte, der Geschichte des Christentums, der Familien- und Geschlechtergeschichte sowie der Wissenschaftsgeschichte beschäftigen.
- Quote paper
- Lilli Richert (Author), 2004, Die Polygynie im Mittelalter aus wissenschaftsgeschichtlicher Perspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21885