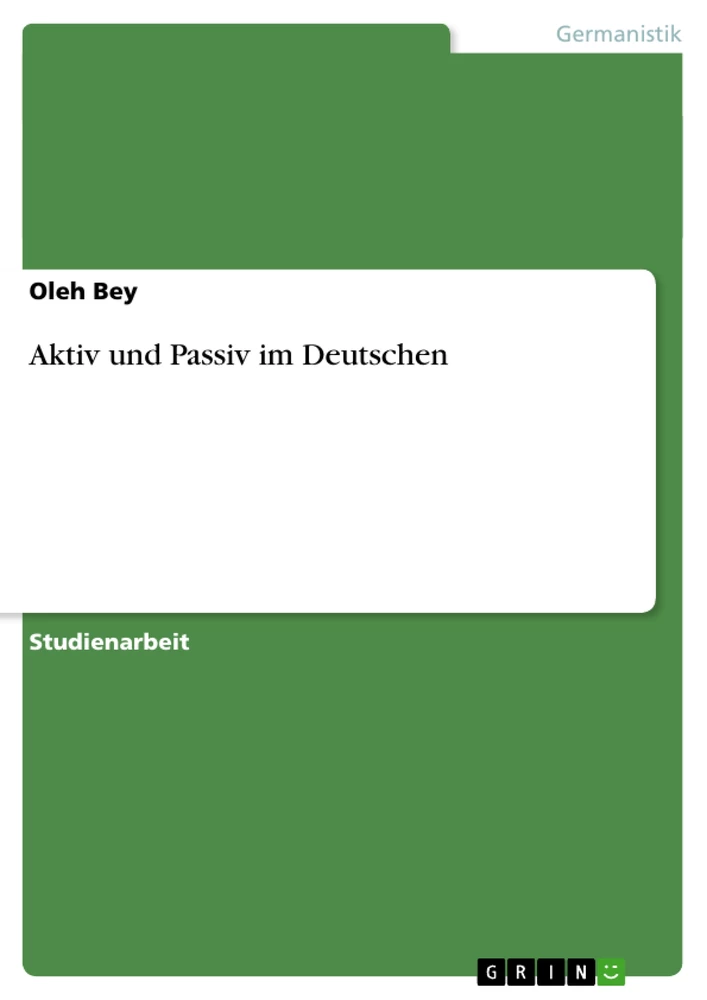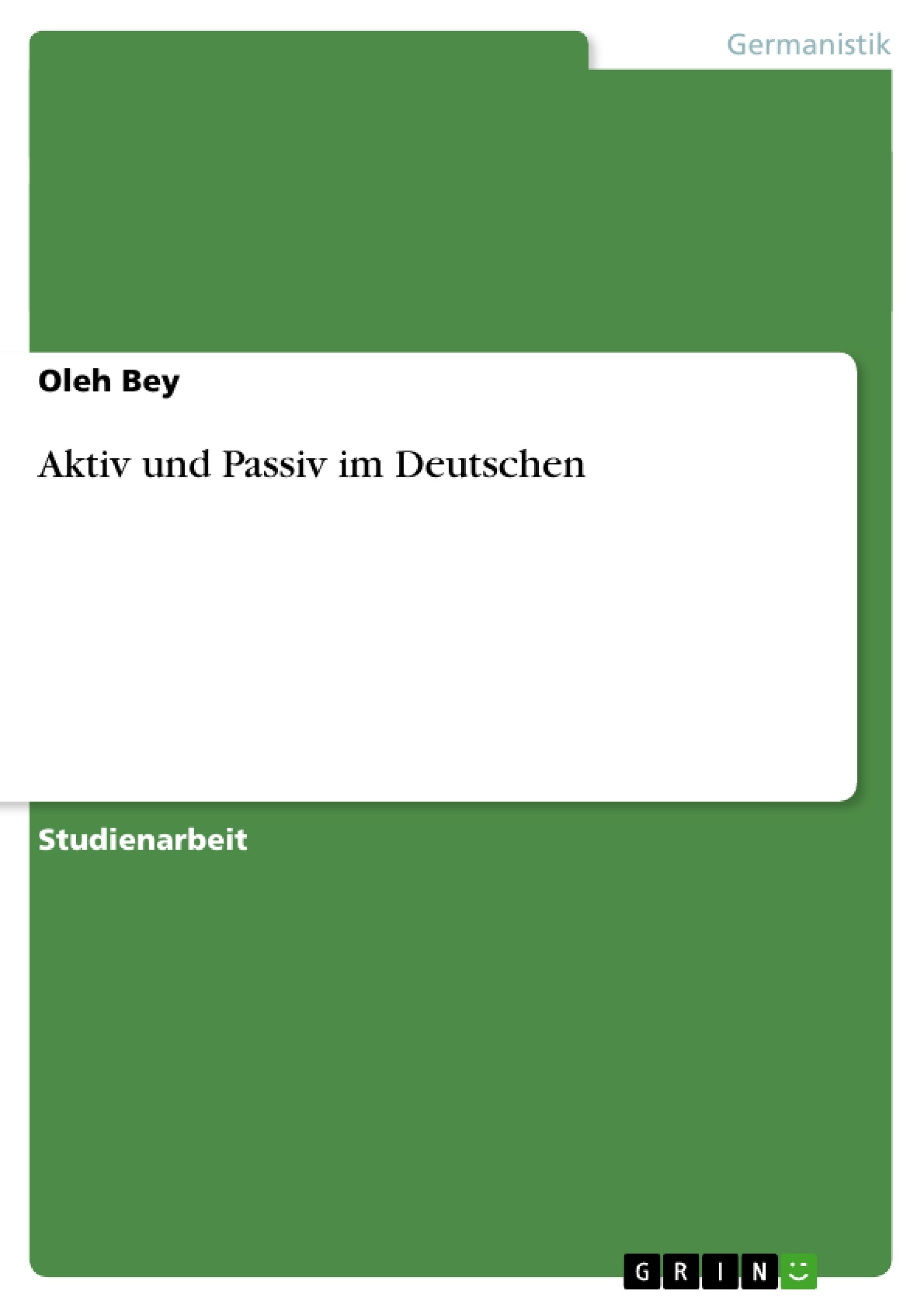Die vorliegende Hausarbeit ist der grammatischen Kategorie der Genera verbi gewidmet. Der Bereich des Aktivs und Passivs wird unter linguistischem und didaktisch-methodischem Aspekt beschrieben. Hier wird versucht, sowohl auf die Oppositionsverhältnisse zwischen Aktiv und Passiv einzugehen als auch die Kriterien für die Stoffauswahl und die Vermittlung im Unterricht Deutsch als Fremdsprache zu entwickeln. Die Arbeit bezieht auch die sogenannten Passivparaphrasen in die Beschreibung mit ein.
Das behandelnde Thema ist unter linguistischem Aspekt gleichermaßen wichtig wie schwierig: Einerseits ist das Passiv eine häufige Form, hat ein weites Verbreitungsgebiet und einen eigenen kommunikativen Bereich. Andererseits enthält seine linguistische Beschreibung zahlreiche Probleme, die in den Gesamtgrammatiken unzureichend reflektiert werden und sehr oft auch eine unterschiedliche oder gar kontroverse Erklärung finden.
Dieses Thema stellt für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache ein schwieriges Lernobjekt dar, weil die Äquivalente in den anderen Sprachen (den Muttersprachen der Lerner) verschieden und teilweise auch anderer Natur sind. So wird z. B. das werden-Passiv oft mit dem sein-Passiv verwechselt, wenn für beide grammatischen Erscheinungen des Deutschen in der Muttersprache nur ein Äquivalent vorhanden ist (etwa im Englischen) oder das sein-Passiv durch eine andere grammatische Kategorie – etwa den Aspekt – ausgedrückt wird (etwa in einigen slawischen Sprachen).
Die theoretische sowie didaktisch-methodische Fundierung der Arbeit bilden vor allem die Werke von deutschen Grammatikern L. Götze, U. Engel, Helbig/Kempter. Auch russische Autoren O. Moskalskaja und E. Schendels werden teilweise dazu herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Teil
- Wesen und Bedeutung von Aktiv und Passiv
- Aktiv und Passiv im Vergleich
- Anschluss des Agens im Passiv
- Gebrauch des Passivs in Textsorten
- Unpersönliches Passiv
- Problem des sein-Passivs
- Parallelformen des Passivs (Passiv-Paraphrasen)
- Einschränkungen beim Gebrauch des Passivs
- Wesen und Bedeutung von Aktiv und Passiv
- Didaktisch-methodischer Teil
- Stoffauswahl
- Stoffvermittlung
- Behandlung des werden-Passivs
- Behandlung des sein-Passivs
- Ausgewählte Übungen und Aufgaben
- Eigene Didaktisierungsvorschläge für die Passivvermittlung im Unterricht Deutsch als Fremdsprache
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Aktiv und Passiv im Deutschen, sowohl aus linguistischer als auch aus didaktisch-methodischer Perspektive. Ziel ist es, die komplexen Aspekte dieser grammatischen Strukturen zu beleuchten und didaktische Ansätze für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache zu entwickeln.
- Vergleich von Aktiv und Passiv und ihre unterschiedlichen kommunikativen Funktionen
- Analyse des unpersönlichen Passivs und des sein-Passivs
- Untersuchung der Einschränkungen beim Gebrauch des Passivs
- Entwicklung von didaktischen Methoden zur Vermittlung des Aktivs und Passivs
- Berücksichtigung interlingualer Unterschiede beim Erlernen des Passivs
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Aktiv und Passiv im Deutschen ein und hebt dessen linguistische Komplexität und didaktische Herausforderung hervor. Sie betont die Unterschiede in der Realisierung von Aktiv und Passiv in verschiedenen Sprachen und die damit verbundenen Schwierigkeiten für Deutschlernende. Die Arbeit stützt sich auf die Werke von deutschen und russischen Grammatikern.
Theoretischer Teil, Kapitel 1: Wesen und Bedeutung von Aktiv und Passiv: Dieses Kapitel analysiert den Unterschied zwischen Aktiv und Passiv, widerlegt die vereinfachte Vorstellung des Passivs als bloße Umkehrung des Aktivs und beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven, die Aktiv- und Passivkonstruktionen einnehmen. Es wird der Unterschied zwischen agensorientierten und agensabgewandten Perspektiven erörtert, wobei die optionale Angabe des Agens im werden-Passiv im Gegensatz zur obligatorischen Angabe im Aktiv hervorgehoben wird. Beispiele illustrieren, wie das Agens im Passiv hervorgehoben und rhematisiert werden kann, was dem vereinfachten Verständnis des Passivs als agensabgewandt widerspricht. Das Kapitel veranschaulicht, dass Aktiv und Passiv zwar den gleichen Sachverhalt beschreiben, aber unterschiedliche subjektive Blickwinkel repräsentieren.
Schlüsselwörter
Aktiv, Passiv, werden-Passiv, sein-Passiv, Agens, Agenszugewandtheit, Agensabgewandtheit, Deutsch als Fremdsprache, Didaktik, Grammatik, Sprachvergleich, Interferenz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Aktiv und Passiv im Deutschen - Linguistische und Didaktisch-Methodische Analyse
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Aktiv und Passiv im Deutschen aus linguistischer und didaktisch-methodischer Sicht. Sie vergleicht Aktiv und Passiv, untersucht verschiedene Passivtypen (werden-Passiv, sein-Passiv, unpersönliches Passiv), beleuchtet deren kommunikative Funktionen und entwickelt didaktische Ansätze für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Der Fokus liegt auf der Komplexität dieser grammatischen Strukturen und den Herausforderungen für Lerner.
Welche Themen werden im theoretischen Teil behandelt?
Der theoretische Teil befasst sich mit dem Wesen und der Bedeutung von Aktiv und Passiv, einem detaillierten Vergleich beider Formen, der Rolle des Agens (Handelnden), dem Gebrauch des Passivs in verschiedenen Textsorten, dem unpersönlichen Passiv, den Problemen des sein-Passivs, Paraphrasen des Passivs und den Einschränkungen beim Gebrauch des Passivs.
Welche Aspekte werden im didaktisch-methodischen Teil behandelt?
Der didaktisch-methodische Teil konzentriert sich auf die Stoffauswahl und -vermittlung von Aktiv und Passiv, insbesondere die Behandlung des werden- und sein-Passivs. Er enthält ausgewählte Übungen und Aufgaben und eigene Vorschläge zur Didaktisierung der Passivvermittlung im Unterricht Deutsch als Fremdsprache.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die komplexen Aspekte von Aktiv und Passiv im Deutschen zu beleuchten und didaktische Ansätze für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache zu entwickeln. Sie untersucht die unterschiedlichen kommunikativen Funktionen von Aktiv und Passiv und berücksichtigt interlinguale Unterschiede beim Erlernen des Passivs.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Aktiv, Passiv, werden-Passiv, sein-Passiv, Agens, Agenszugewandtheit, Agensabgewandtheit, Deutsch als Fremdsprache, Didaktik, Grammatik, Sprachvergleich, Interferenz.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Einleitung, theoretischen Teil, didaktisch-methodischen Teil und Schlussfolgerungen gegliedert. Der theoretische Teil analysiert die linguistischen Aspekte von Aktiv und Passiv, während der didaktisch-methodische Teil sich mit der Vermittlung dieser grammatischen Strukturen im Unterricht beschäftigt. Die Einleitung führt in das Thema ein und die Schlussfolgerung fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Kapitel enthält die Arbeit und worum geht es jeweils?
Die Arbeit enthält Kapitel zu Einleitung (Einführung in das Thema), Wesen und Bedeutung von Aktiv und Passiv (Vergleich, Agens, Perspektiven), unpersönlichem Passiv, Problemen des sein-Passivs, Passivparaphrasen, Einschränkungen beim Passivgebrauch, Stoffauswahl und -vermittlung (werden- und sein-Passiv), ausgewählten Übungen und Aufgaben und eigenen Didaktisierungsvorschlägen. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt von Aktiv und Passiv.
- Citar trabajo
- Oleh Bey (Autor), 2003, Aktiv und Passiv im Deutschen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22009