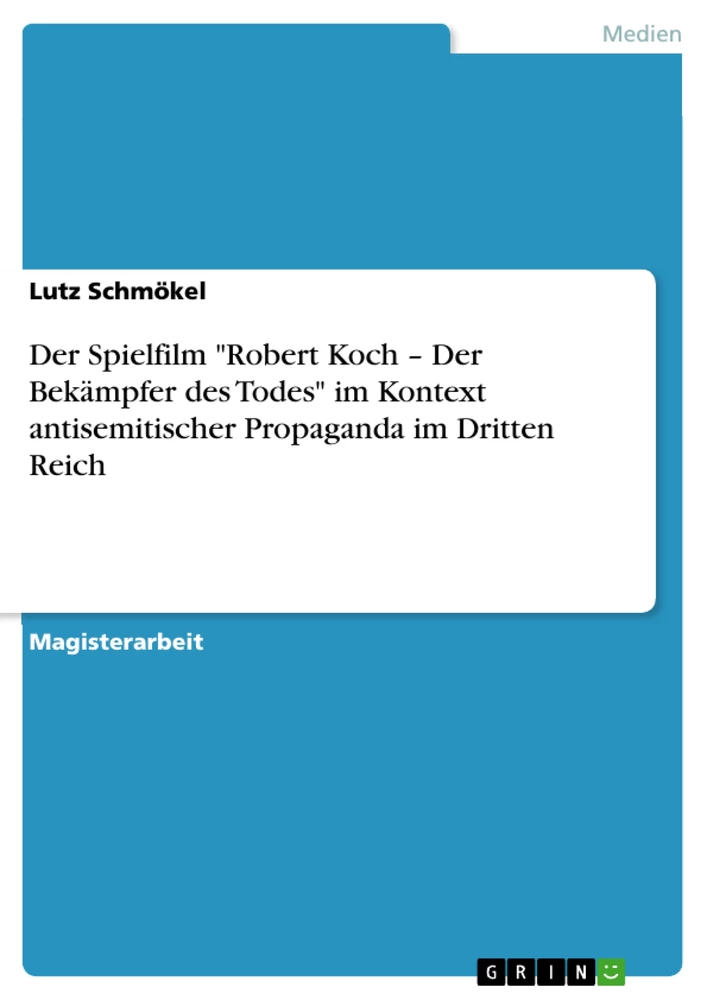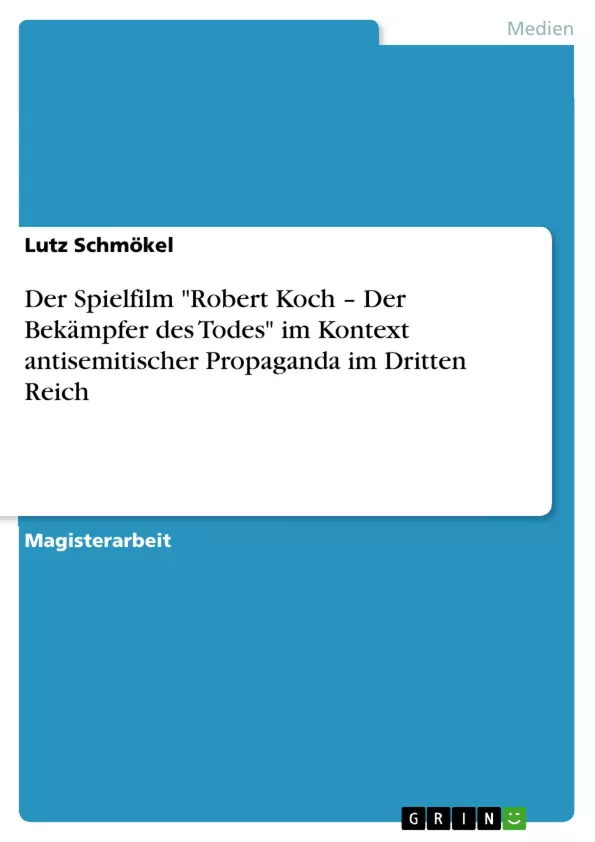Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Spielfilm "Robert Koch - Der Bekämpfer des Todes", der 1939 von Hans Steinhoff gedreht wurde. Dabei soll dieser Film auf seine propagandistischen Inhalte untersucht werden, ganz besonders auf jene, die nur im Zusammenhang mit dem zeitgenössischen Kontext der Entstehung und Aufführung des Filmes im Dritten Reich verständlich sind. Dies bedeutet, dass die inhaltliche Gestaltung des Filmes in Bezug gesetzt werden soll zu den politischen und propagandistischen Informationen, die zur Zeit der damaligen Aufführung im Umlauf waren. Besonderes Augenmerk soll dabei auf antisemitische Aussagen geworfen werden.
Dem Massenmedium Film kommt mit seinem eigenständigen sprachlichen und emotionalen Code eine besondere Bedeutung für die politische Nutzung als Propagandamittel im Dritten Reich zu. Zwar existiert diesbezüglich eine Fülle von Material, die Forschung konzentrierte sich jedoch bisher immer auf eine zusammenfassende Darstellung des NS-Filmwesens oder auf die Analyse einiger weniger Filme, wie z.B. die Parteifilme von 1933 (Steinhoffs "Hitlerjunge Quex", Seitz' "SA-Mann Brand" und Wenzlers "Hans Westmar") oder "Jud Süß" (Harlan, 1941). Was fehlt, ist die Untersuchung weiterer, auf den ersten Blick nicht als antisemtisch erkennbare, Filme, deren Einordnung in den politischen Kontext sowie ihre Ergänzung durch andere propagandistische Aussagen aus unterschiedlichsten Bereichen. Das so entstehnde Bild des Wirkzusammenhangs unterschiedlichster propagandistischer Aussagen erschließt einen Einblick auf das konnotative Umfeld und eine Einschätzung der subjektiven Wahrnehmung von Filmen im "Dritten Reich".
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einleitung
- 2. Propaganda
- 2.1. Begriffsbestimmung
- 2.2. Propagandaverständnis im Nationalsozialismus
- 2.3. Grundlagen der NS-Propaganda
- 2.4. Umsetzung der Propagandatheorie
- 2.4.1. Ansätze zur Wirkungserklärung nationalsozialistischer Propaganda
- 2.4.2. Feindbilder
- 2.4.3. Sprachregelung
- 2.5. Spielfilm als Propagandainstrument im Dritten Reich
- 2.6. Zusammenfassung
- 3. Antisemitismus im Dritten Reich
- 3.1. Ursprünge der NS-Rassenideologie und Stellenwert im nationalsozialistischen Weltbild
- 3.2. Rassismus im nationalsozialistischen Weltbild
- 3.3. Antisemitische Propaganda im Dritten Reich
- 3.3.1. Das jüdische Feindbild und seine sprachliche Gestaltung
- 3.3.2. Antisemitische Filmpropaganda
- 3.4. Zusammenfassung
- 4. Der "Robert-Koch"-Spielfilm
- 4.1. Entstehungszusammenhang des Filmes
- 4.1.2. Produktionsdaten
- 4.1.3. Produktionsbeteiligte
- 4.1.4. Distribution und Förderung des Filmes
- 4.2. Besprechung in Filmkritiken
- 4.3. Beurteilung des Filmes in der Nachkriegsliteratur - Forschungsstand
- 4.4. Zusätzliche Kontextinformationen
- 4.4.1. Medizin und Medizinerfilm im Dritten Reich
- 4.4.2. Darstellung historischer Personen
- 4.1. Entstehungszusammenhang des Filmes
- 5. Produktanalyse
- 5.1. Gliederung bzw. Segmentierung des Spielfilmes
- 5.1.1. Akteinteilung
- 5.1.2. Einteilung in Sequenzen und Subsequenzen
- 5.2. Beschreibung des Verlaufsprotokolls
- 5.3. Auswertung
- 5.3.1. Gestaltung des Filmes
- 5.3.2. Untersuchung von manifesten propagandistischen Elementen des Filmes
- 5.4. Feinanalyse - Untersuchung des Feindbildes im Spielfilm
- 5.4.1. Auswahl und Protokollierung der Schlüsselszenen
- 5.4.2. Untersuchung des Filmes auf latente propagandistische Inhalte
- 5.1. Gliederung bzw. Segmentierung des Spielfilmes
- 6. Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Spielfilm "Robert Koch - Der Bekämpfer des Todes", der 1939 von Hans Steinhoff gedreht wurde. Sie untersucht die propagandistischen Inhalte des Films, insbesondere jene, die nur im Kontext des Dritten Reiches verständlich sind. Die Analyse des Films setzt die inhaltliche Gestaltung in Bezug zu den politischen und propagandistischen Informationen, die bei seiner damaligen Aufführung im Umlauf waren. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf antisemitische Aussagen gelegt.
- Die Nutzung des Films als Propagandamittel im Dritten Reich
- Die Analyse des "Robert Koch"-Films auf seine manifesten und latenten propagandistischen Inhalte
- Die Untersuchung des Feindbildes im Film und dessen sprachliche Parallelen zum jüdischen Feindbild des Nationalsozialismus
- Die Darstellung der Wechselwirkung der Aussagen des Films mit dem propagandistischen System des Dritten Reiches
- Die Erforschung der möglichen Bedeutung des Films für die zeitgenössische Rezeption und die Verbreitung antisemitischer Propaganda
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext des Spielfilms "Robert Koch - Der Bekämpfer des Todes" und die Zielsetzung der Arbeit erläutert. Kapitel 2 widmet sich dem Thema Propaganda und erörtert die Definition, das Verständnis im Nationalsozialismus, die Grundlagen und die Umsetzung der Propagandatheorie. In Kapitel 3 wird der Antisemitismus im Dritten Reich behandelt, einschließlich der Ursprünge der NS-Rassenideologie, des Rassismus im nationalsozialistischen Weltbild und der antisemitischen Propaganda. Kapitel 4 analysiert den Film "Robert Koch - Der Bekämpfer des Todes" in Bezug auf seinen Entstehungszusammenhang, die Besprechungen in Filmkritiken, die Beurteilung in der Nachkriegsliteratur und zusätzliche Kontextinformationen. In Kapitel 5 folgt eine Produktanalyse des Films, die die Gliederung, die Beschreibung des Verlaufsprotokolls, die Auswertung der Gestaltung und die Untersuchung manifesten und latenten propagandistischen Elementen beinhaltet. Schließlich fasst Kapitel 6 die Ergebnisse der Analyse zusammen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt wichtige Themen wie Propaganda, Antisemitismus, Filmpropaganda, das Feindbild, die NS-Rassenideologie, der "Robert Koch"-Spielfilm und die Analyse von Filminhalten im Kontext des Dritten Reiches. Wichtige Begriffe sind: Propagandainstrumente, Feindbilder, sprachliche Gestaltung, latente Inhalte, manifester Propaganda, politischer Kontext, antisemitische Propaganda, mediengeschichtliche Analyse, Film als Medium, Drittes Reich, Robert Koch.
Häufig gestellte Fragen
Ist "Robert Koch – Der Bekämpfer des Todes" ein Propagandafilm?
Ja, die Arbeit zeigt auf, dass der Film von 1939 gezielt propagandistische Inhalte nutzt, um das NS-Weltbild und Feindbilder zu transportieren.
Welche antisemitischen Elemente enthält der Film?
Die Arbeit untersucht latente antisemitische Aussagen und sprachliche Parallelen, die das jüdische Feindbild des Nationalsozialismus widerspiegeln.
Warum wurde gerade ein Medizinerfilm für Propaganda genutzt?
Medizinerfilme eigneten sich im Dritten Reich ideal, um Themen wie "Volksgesundheit", "Rassenhygiene" und den heroischen Kampf gegen "Schädlinge" zu metaphorisieren.
Wer war der Regisseur des Films?
Der Film wurde von Hans Steinhoff gedreht, der auch für andere bekannte NS-Propagandafilme wie "Hitlerjunge Quex" verantwortlich war.
Was ist der Unterschied zwischen manifester und latenter Propaganda?
Manifeste Propaganda ist direkt erkennbar, während latente Propaganda Botschaften subtil über Handlung, Bildsprache und Metaphern vermittelt.
Wie wird Robert Koch im Film dargestellt?
Er wird als einsamer, genialer Kämpfer gegen den "Tod" (und metaphorisch gegen das "Undeutsche") stilisiert, was dem NS-Führerprinzip entsprach.
- Citation du texte
- Lutz Schmökel (Auteur), 1992, Der Spielfilm "Robert Koch – Der Bekämpfer des Todes" im Kontext antisemitischer Propaganda im Dritten Reich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/221