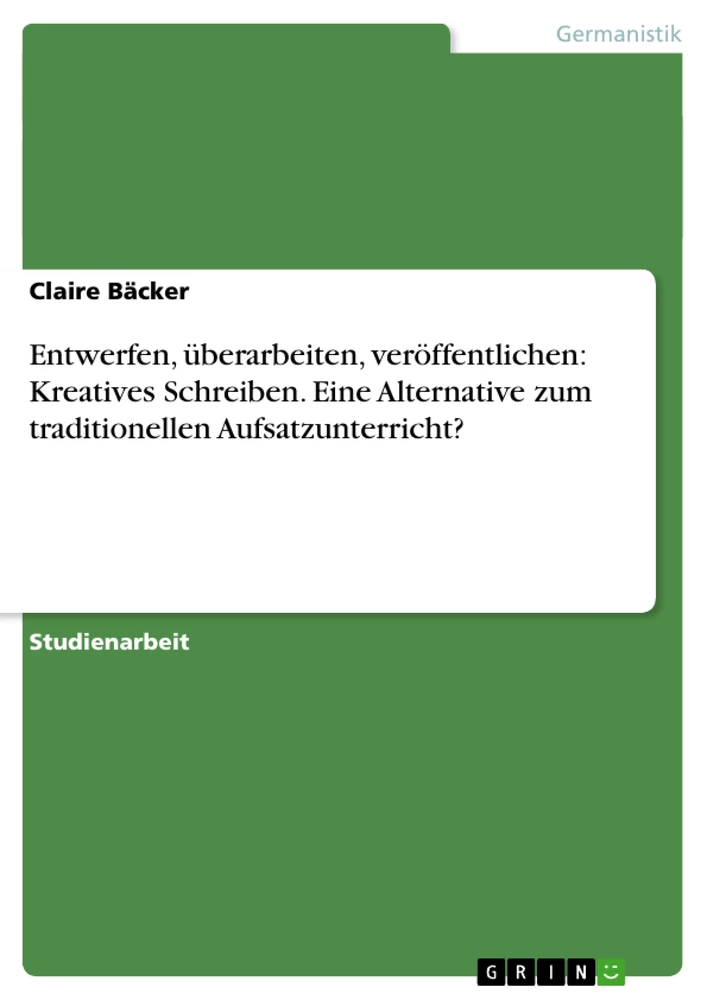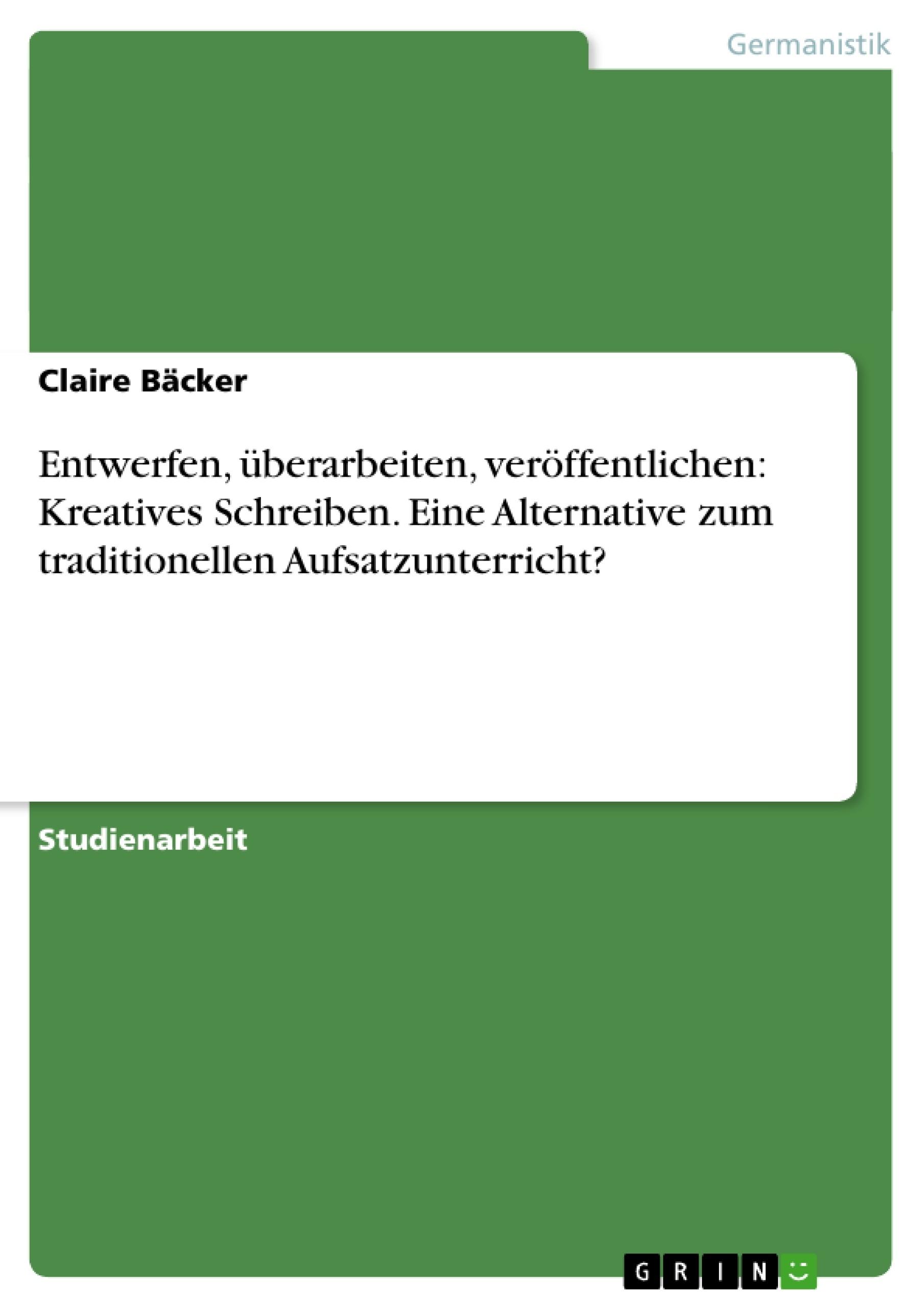In meiner Arbeit möchte ich zunächst mit Hilfe der Begriffe „traditioneller Aufsatzunterricht“, „kommunikatives Schreiben“, „freies Schreiben“, „personales Schreiben“ und „prozessorientiertes Schreiben“ die Entwicklungen in der Aufsatzdidaktik, die sich auf das kreative Schreiben ausgewirkt haben, skizzieren, bevor ich im nächsten Schritt das kreative Schreiben als Alternative und Ergänzung zum traditionellen Aufsatzunterricht darstelle. Hierzu werde ich die Grundlagen des kreativen Schreibens und einige kreative Schreibverfahren vorstellen, um die Bedeutung dieser neuen Schreibdidaktik für den Unterricht zu klären. Im weiteren Teil der Arbeit wende ich mich dem Umgang mit kreativen Schreibergebnissen zu und gehe dabei näher auf den Begriff der Überarbeitung ein. In Punkt 5 beschäftige ich mich schließlich mit den Schreibkonferenzen, die ich aufgrund ihrer Wichtigkeit in einem gesonderten Kapitel bearbeiten möchte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Neuere Entwicklungen in der Aufsatzdidaktik
- Kommunikatives Schreiben
- Freies Schreiben
- Personales Schreiben
- Prozessorientiertes Schreiben
- Kreatives Schreiben
- Grundlagen des kreativen Schreibens
- Definition
- Tendenzen des kreativen Schreibens
- Kreative Schreibverfahren
- Das Cluster
- Die Fantasiereise
- Situatives Schreiben
- Umgang mit kreativen Schreibergebnissen
- Zum Begriff „Überarbeitung“
- Arten der Überarbeitung
- Vorstellung einiger produktiver schriftlicher Bearbeitungsverfahren
- Didaktisch – methodische Erwägungen zu Überarbeiten
- Schreibkonferenzen
- Begriffsklärung
- Schreibkonferenzen und die Dynamik von Schreibprozessen
- Entwerfen, Überarbeiten, Veröffentlichen
- Der typische Ablauf einer Schreibkonferenz
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Ansatz des kreativen Schreibens als alternative und ergänzende Methode zum traditionellen Aufsatzunterricht. Sie beleuchtet die Entwicklungen in der Aufsatzdidaktik, die zum kreativen Schreiben führten, und stellt dessen Grundlagen und Schreibverfahren vor. Darüber hinaus wird der Umgang mit kreativen Schreibergebnissen, insbesondere die Bedeutung der Überarbeitung, untersucht. Schließlich widmet sich die Arbeit den Schreibkonferenzen und deren Rolle im Schreibprozess.
- Entwicklungen in der Aufsatzdidaktik
- Grundlagen und Verfahren des kreativen Schreibens
- Umgang mit kreativen Schreibergebnissen
- Bedeutung der Überarbeitung
- Rolle von Schreibkonferenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema „Kreatives Schreiben als Alternative zum traditionellen Aufsatzunterricht“ ein und beleuchtet die Bedeutung der Überarbeitung im Schreibprozess. Kapitel 2 skizziert die Entwicklungen in der Aufsatzdidaktik, die sich im Anschluss an den traditionellen Aufsatzunterricht herausgebildet haben. Es werden die Begriffe „kommunikatives Schreiben“, „freies Schreiben“, „personales Schreiben“, „prozessorientiertes Schreiben“ und „kreatives Schreiben“ erläutert. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Grundlagen des kreativen Schreibens, definiert den Begriff und präsentiert verschiedene Schreibverfahren. In Kapitel 4 wird der Umgang mit kreativen Schreibergebnissen beleuchtet und die Bedeutung der Überarbeitung hervorgehoben. Kapitel 5 widmet sich den Schreibkonferenzen und ihrer Rolle im Schreibprozess.
Schlüsselwörter
Kreatives Schreiben, traditioneller Aufsatzunterricht, Aufsatzdidaktik, kommunikatives Schreiben, freies Schreiben, personales Schreiben, prozessorientiertes Schreiben, Überarbeitung, Schreibkonferenzen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen traditionellem Aufsatzunterricht und kreativem Schreiben?
Traditioneller Aufsatzunterricht ist oft produktorientiert und normgebunden. Kreatives Schreiben ist prozessorientiert und nutzt Verfahren wie Cluster oder Fantasiereisen, um die Schreiblust und individuelle Ausdruckskraft zu fördern.
Was versteht man unter einem „Cluster“?
Ein Cluster ist ein kreatives Verfahren zur Ideenfindung, bei dem Assoziationen rund um ein Kernwort grafisch vernetzt werden, ähnlich einer Mindmap, aber freier im Fluss.
Was ist eine Schreibkonferenz?
In einer Schreibkonferenz tauschen sich Schüler über ihre Entwürfe aus. Sie geben sich gegenseitig Rückmeldung, um Texte gemeinsam zu überarbeiten und zu verbessern.
Warum ist die Überarbeitung beim Schreiben so wichtig?
Schreiben wird als Prozess verstanden. Die Überarbeitung hilft, Gedanken zu präzisieren, die sprachliche Form zu feilen und den Text für die spätere Veröffentlichung vorzubereiten.
Können Fantasiereisen das Schreiben fördern?
Ja, Fantasiereisen dienen als situativer Einstieg, um innere Bilder zu wecken, die dann als Grundlage für kreative Texte genutzt werden können.
- Quote paper
- Claire Bäcker (Author), 2003, Entwerfen, überarbeiten, veröffentlichen: Kreatives Schreiben. Eine Alternative zum traditionellen Aufsatzunterricht?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22135