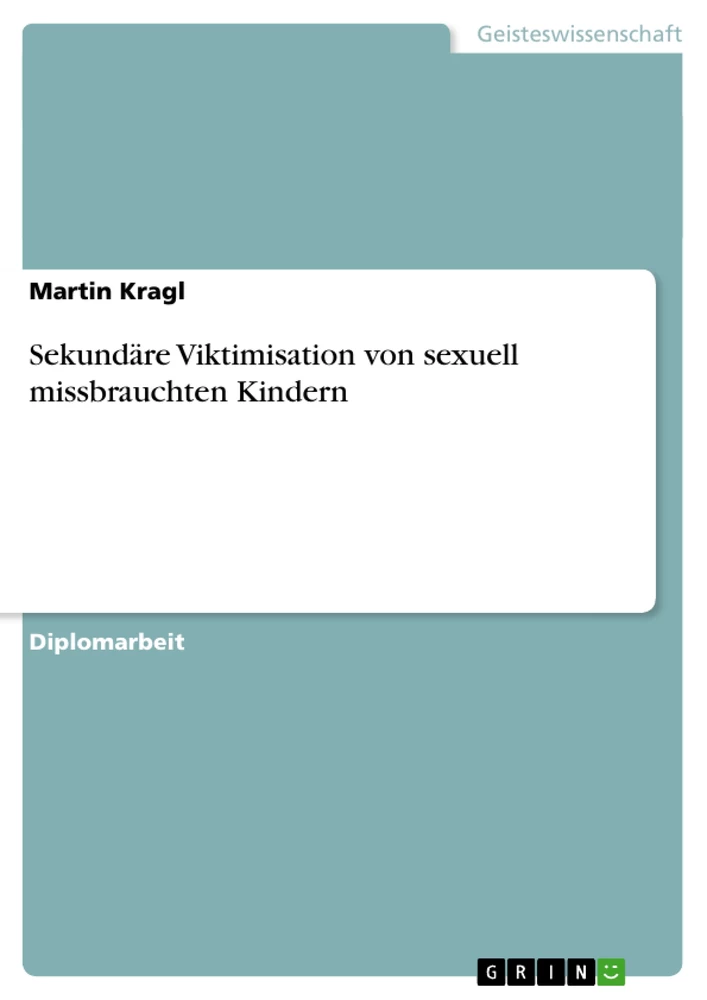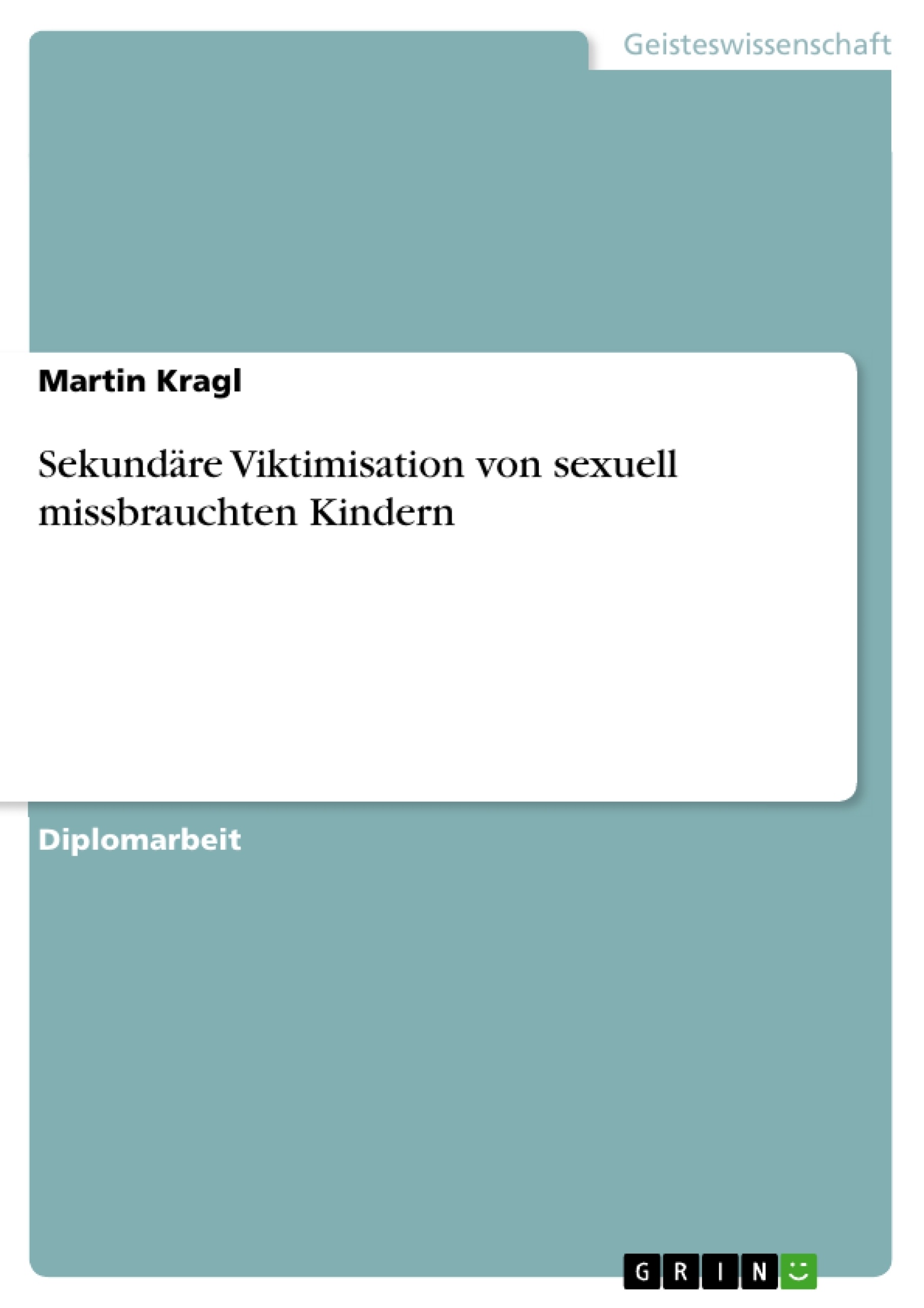Bei der Beschäftigung des Autoren mit diesem Thema gilt sein besonderes Interesse dem Versuch, eine (zumindest literarische) Schnittstelle zwischen viktimologischer Wissenschaft (Arbeit) mit psychologischer und juristischer Praxis zu schaffen.
Neben der Findung griffiger Definitionen der Begrifflichkeiten im Themenfeld der Viktimologie, speziell des sexuellen Missbrauchs an Kindern und seinen Ausprägungen sollen insbesondere Antworten auf folgende Fragen gefunden werden:
Wo wird das sexuell missbrauchte Kind sekundär viktimisierenden Einflüssen ausgesetzt?
Wie können diese Einflüsse vermieden oder zumindest reduziert werden?
Um die allgemeine Fragestellung einzugrenzen, wird der Fokus vor allem auf das Strafverfahren und dessen Umfeld unter Bezugnahme auf konkrete Fallbeispiele gelegt.
In diesem Zusammenhang wird der Autor ausführlicher auf die mögliche Sekundärviktimisation durch sogenannte aussagepsychologische Gutachten (auch bekannt als Glaubwürdigkeitsgutachten) und deren mögliche Reduzierung eingehen.
Indem er die derzeitigen strukturellen Gegebenheiten darlegt, möchte er die Leser für die Situation des Kindes als Opfer sexuellen Missbrauchs im Strafverfahren sensibilisieren. Des weiteren wird er über die Probleme in der momentanen Verfahrensweise reflektieren und versuchen, daraus Lösungsvorschläge abzuleiten.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0. Vorwort
- 2.0. Zur Begrifflichkeit sexueller Missbrauch
- 3.0. Definitionen
- 3.1. Definition des Begriffes „Kind“
- 3.2. Definition des Begriffes „sexueller Missbrauch“
- 3.3. Eigene Forschungsdefinition
- 3.4. Formen des sexuellen Missbrauchs
- 3.5. Definition von primärer und sekundärer Viktimisation
- 4.0. Darstellung der Wormser Prozesse als Ausgangspunkt der Überlegungen zur sekundären Viktimisation
- 5.0. Primäre und sekundäre Viktimisierung von sexuell missbrauchten Kindern
- 5.1. Primäre Folgen sexuellen Missbrauchs
- 5.2. Sekundäre Folgen sexuellen Missbrauchs
- 5.3. Die Situation des kindlichen Opferzeugen vor Gericht
- 6.0. Zwischenresümee
- 7.0. Sekundäre Viktimisation durch Glaubhaftigkeitsgutachten
- 7.1. Begrifflichkeiten im Bereich der aussagepsychologischen Begutachtung
- 7.2. Die wesentlichen Elemente eines Glaubhaftigkeitsgutachtens
- 7.3. Die historische Entwicklung der Glaubhaftigkeitsbegutachtung
- 7.4. Rolle und Situation des Gutachters
- 8.0. Der aktuelle wissenschaftliche Stand
- 8.1. Die Criteria Based Content Analysis
- 8.2. Der Validity Check
- 8.3. Ergänzungen zur Zusammensetzung eines umfassenden Gutachtens nach Fiedler und Steller
- 8.4. Kurze zusammenfassende Darstellung
- 9.0. Praxis der Begutachtung
- 9.1. Richtlinien für die Zeugenbefragung im Zuge der aussagepsychologischen Begutachtung
- 9.2. Richtlinien der Polizei zur Befragung kindlicher Opferzeugen sexuellen Missbrauchs
- 10.0. Konsequenzen aus den Wormser Prozessen
- 11.0. Ausblick auf die Zukunft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die sekundäre Viktimisierung sexuell missbrauchter Kinder, insbesondere im Kontext des Strafverfahrens. Ziel ist es, die Einflüsse aufzuzeigen, die zu sekundärer Viktimisierung führen, und Möglichkeiten zur Vermeidung oder Reduktion dieser Einflüsse zu erörtern. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf das Strafverfahren und die Rolle von Glaubhaftigkeitsgutachten.
- Definition und Abgrenzung sexueller Missbrauch
- Primäre und sekundäre Folgen sexuellen Missbrauchs bei Kindern
- Die Rolle von Glaubhaftigkeitsgutachten im Strafverfahren
- Analyse der Wormser Prozesse als Fallbeispiel
- Möglichkeiten zur Verbesserung des Umgangs mit kindlichen Opferzeugen
Zusammenfassung der Kapitel
2.0. Zur Begrifflichkeit „Sexueller Missbrauch“: Dieses Kapitel befasst sich mit der Begrifflichkeit „sexueller Missbrauch“ und diskutiert alternative Begriffe wie „sexuelle Gewalt“ oder „sexuelle Ausbeutung“. Es werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Begriffe im Hinblick auf juristische Konnotationen und die Vermeidung von Verantwortungszuschreibung an die Opfer erörtert. Der Autor argumentiert für die Verwendung des Begriffs „sexueller Missbrauch“ aufgrund seiner weit verbreiteten Akzeptanz in der Fachwelt und seiner juristischen Relevanz, gleichzeitig aber auch die potenziellen Nachteile des Begriffs bezüglich der Implikation von „Benutzung“ und der damit verbundenen Stigmatisierung für das Kind. Die Auswahl des Begriffs wird sorgfältig abgewogen und begründet.
3.0. Definitionen: Dieses Kapitel liefert wichtige Definitionen, die für das Verständnis der Arbeit fundamental sind. Es definiert den Begriff „Kind“, „sexueller Missbrauch“ und präsentiert eine eigene Forschungsdefinition. Des Weiteren werden verschiedene Formen sexuellen Missbrauchs beschrieben und die Begriffe „primäre“ und „sekundäre Viktimisierung“ klar abgegrenzt. Diese Definitionen bilden die Grundlage für die spätere Analyse und schaffen ein gemeinsames Verständnis der zentralen Begriffe für den Leser.
4.0. Darstellung der Wormser Prozesse als Ausgangspunkt der Überlegungen zur sekundären Viktimisation: Das Kapitel beschreibt die Wormser Prozesse als Negativbeispiel für den Umgang mit kindlichen Zeugenaussagen in Fällen sexuellen Missbrauchs. Es dient als Ausgangspunkt für die Untersuchung der sekundären Viktimisierung. Die Darstellung der Prozesse liefert einen konkreten Fall, an dem die Problematik der sekundären Viktimisierung verdeutlicht werden kann und legt den Fokus auf die kritischen Aspekte der damaligen Gerichtsverfahren.
5.0. Primäre und sekundäre Viktimisierung von sexuell missbrauchten Kindern: Dieses Kapitel unterscheidet zwischen primären und sekundären Folgen sexuellen Missbrauchs. Die primären Folgen betreffen die unmittelbaren Auswirkungen des Missbrauchs auf das Kind, während die sekundären Folgen durch das Umfeld und die Reaktionen auf den Missbrauch entstehen. Der Fokus liegt auf der Schilderung der sekundären Viktimisierung, insbesondere im Kontext der juristischen Aufarbeitung und der damit verbundenen Herausforderungen für das Kind als Opferzeuge. Konkrete Beispiele verdeutlichen die Folgen für das Kind.
7.0. Sekundäre Viktimisation durch Glaubhaftigkeitsgutachten: Dieses Kapitel analysiert die sekundäre Viktimisierung durch aussagepsychologische Gutachten. Es beleuchtet die Begrifflichkeiten der aussagepsychologischen Begutachtung, die wesentlichen Elemente eines Glaubhaftigkeitsgutachtens sowie deren historische Entwicklung. Die Rolle und Situation des Gutachters werden kritisch beleuchtet. Es wird dargelegt, wie Gutachten, anstatt das Opfer zu schützen, zu weiterer Traumatisierung beitragen können. Der Fokus liegt auf den potenziellen negativen Auswirkungen dieser Gutachten auf die Kinder.
8.0. Der aktuelle wissenschaftliche Stand: Das Kapitel präsentiert den aktuellen wissenschaftlichen Stand zur aussagepsychologischen Begutachtung, einschließlich der Criteria Based Content Analysis und des Validity Checks. Zusätzliche Informationen zur Zusammensetzung eines umfassenden Gutachtens werden nach Fiedler und Steller vorgestellt. Es wird ein Überblick über die gängigen wissenschaftlichen Methoden und Ansätze gegeben, die zur Beurteilung der Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen herangezogen werden. Dies legt die wissenschaftliche Fundierung der Arbeit dar.
9.0. Praxis der Begutachtung: Dieses Kapitel beschreibt die Praxis der aussagepsychologischen Begutachtung, darunter Richtlinien für die Zeugenbefragung und Richtlinien der Polizei zur Befragung kindlicher Opferzeugen. Es werden konkrete Praktiken und Verfahren im Umgang mit kindlichen Zeugen im Kontext des sexuellen Missbrauchs beleuchtet und deren Wirksamkeit im Kontext der Viktimisierung kritisch diskutiert.
Schlüsselwörter
Sekundäre Viktimisierung, sexueller Missbrauch, Kinder, Opferzeugen, Strafverfahren, Glaubhaftigkeitsgutachten, aussagepsychologische Begutachtung, Wormser Prozesse, Criteria Based Content Analysis, Validity Check.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Sekundäre Viktimisierung sexuell missbrauchter Kinder
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die sekundäre Viktimisierung sexuell missbrauchter Kinder, insbesondere im Kontext des Strafverfahrens. Der Fokus liegt auf den Einflüssen, die zu sekundärer Viktimisierung führen, und auf Möglichkeiten, diese zu vermeiden oder zu reduzieren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Rolle von Glaubhaftigkeitsgutachten im Strafverfahren.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung sexuellen Missbrauchs, primäre und sekundäre Folgen sexuellen Missbrauchs bei Kindern, die Rolle von Glaubhaftigkeitsgutachten im Strafverfahren, Analyse der Wormser Prozesse als Fallbeispiel und Möglichkeiten zur Verbesserung des Umgangs mit kindlichen Opferzeugen. Die Arbeit beinhaltet auch eine ausführliche Diskussion der Begrifflichkeiten, Definitionen und des aktuellen wissenschaftlichen Stands zur aussagepsychologischen Begutachtung.
Welche Definitionen werden verwendet?
Die Arbeit liefert präzise Definitionen für "Kind", "sexueller Missbrauch" und "Viktimisierung" (primär und sekundär). Sie präsentiert zudem eine eigene Forschungsdefinition für sexuellen Missbrauch und diskutiert verschiedene Formen sexuellen Missbrauchs. Die Definitionen bilden die Grundlage für die gesamte Analyse.
Welche Rolle spielen die Wormser Prozesse?
Die Wormser Prozesse dienen als Negativbeispiel für den Umgang mit kindlichen Zeugenaussagen in Fällen sexuellen Missbrauchs. Sie werden als Ausgangspunkt verwendet, um die Problematik der sekundären Viktimisierung zu veranschaulichen und kritische Aspekte der damaligen Gerichtsverfahren zu beleuchten.
Wie werden primäre und sekundäre Viktimisierung unterschieden?
Primäre Folgen sexuellen Missbrauchs sind die unmittelbaren Auswirkungen auf das Kind. Sekundäre Folgen entstehen durch das Umfeld und die Reaktionen auf den Missbrauch, insbesondere im Kontext des Strafverfahrens und durch den Umgang mit den Gutachten.
Welche Rolle spielen Glaubhaftigkeitsgutachten?
Die Arbeit analysiert die potenzielle sekundäre Viktimisierung durch aussagepsychologische Gutachten. Sie beleuchtet die Begrifflichkeiten, die wesentlichen Elemente und die historische Entwicklung solcher Gutachten. Die Rolle und Situation des Gutachters werden kritisch betrachtet, wobei der Fokus auf den potenziellen negativen Auswirkungen auf die Kinder liegt.
Welcher wissenschaftliche Stand wird dargestellt?
Die Arbeit präsentiert den aktuellen wissenschaftlichen Stand zur aussagepsychologischen Begutachtung, einschließlich der Criteria Based Content Analysis und des Validity Checks. Sie beschreibt die gängigen wissenschaftlichen Methoden und Ansätze zur Beurteilung der Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen nach Fiedler und Steller.
Welche praktischen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt die Praxis der aussagepsychologischen Begutachtung, einschließlich Richtlinien für die Zeugenbefragung und Richtlinien der Polizei zur Befragung kindlicher Opferzeugen. Sie diskutiert konkrete Praktiken und Verfahren und deren Wirksamkeit im Kontext der Viktimisierung.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen aus den Wormser Prozessen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Verbesserungen im Umgang mit kindlichen Opferzeugen sexuellen Missbrauchs, um sekundäre Viktimisierung zu minimieren. Die Arbeit bietet somit wichtige Hinweise zur Verbesserung von Verfahren und Gutachten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Sekundäre Viktimisierung, sexueller Missbrauch, Kinder, Opferzeugen, Strafverfahren, Glaubhaftigkeitsgutachten, aussagepsychologische Begutachtung, Wormser Prozesse, Criteria Based Content Analysis, Validity Check.
- Citation du texte
- Martin Kragl (Auteur), 2003, Sekundäre Viktimisation von sexuell missbrauchten Kindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22177