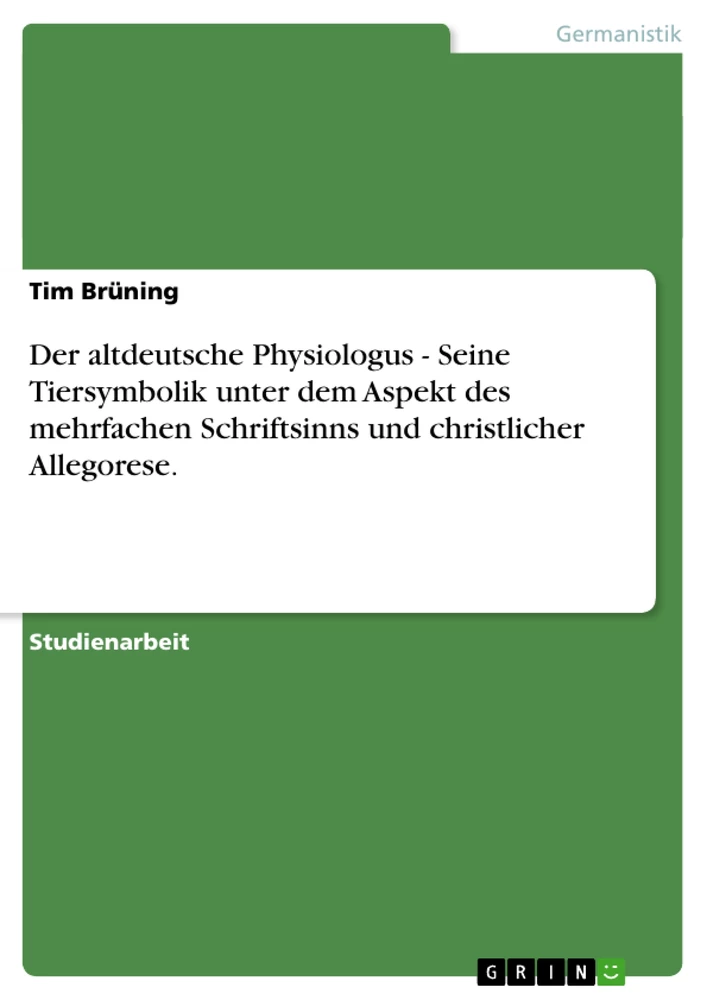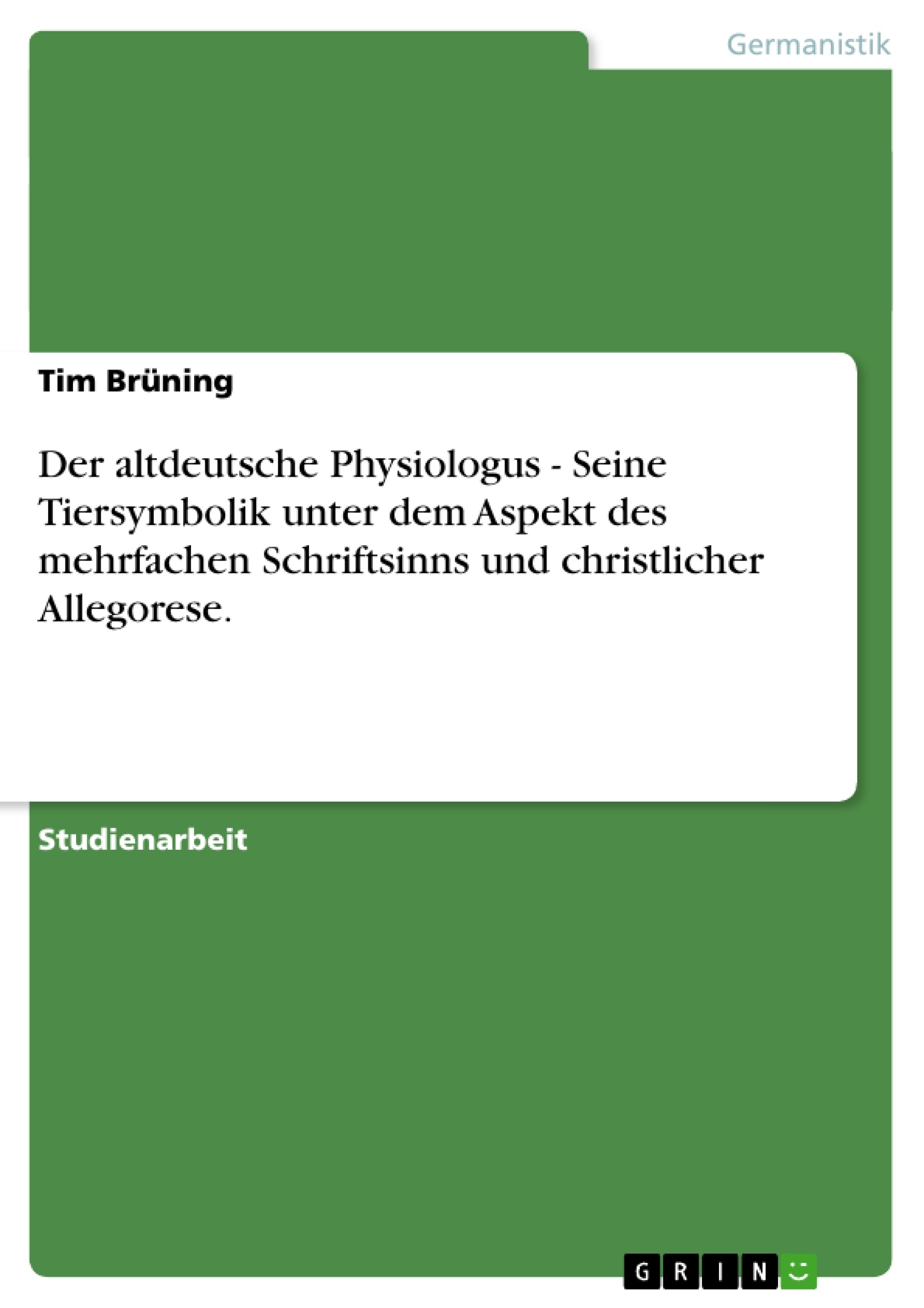„Gewiss eine der merkwürdigsten Erscheinungen der gesamten Literatur ist das Buch, das wir unter dem Namen »Physiologus« kennen […]“1 – das bemerkt schon Friedrich Lauchert über jenes Werk, das im Zentrum der folgenden Untersuchung steht. Tatsächlich wird man sich des Eindruckes nicht erwehren können, dass diese Schrift eine Sonderstellung in der Literaturgeschichte beansprucht, sobald das Augenmerk auf ihre Wirkungsgeschichte2, ihre über viele Jahrhunderte fortdauernde Tradierung sowie die zahlreichen handschriftlichen Sonderfassungen gerichtet wird. So ist um kaum ein anderes Werk hinsichtlich seiner Quellenfragen eine so umfassende und bisweilen kontroverse Diskussion geführt worden, ohne dass heute von einer wirklich gesicherten Erkenntnis über Entstehungszeit, Abfassungsort und Gestalt des Archetypus gesprochen werden kann. Obgleich die oftmals in der Forschungsliteratur für den Physiologus angewandte Diminutivkennzeichnung „Büchlein“3 verwunderlich anmuten mag, so kann es nicht über den unbestrittenen Autoritätsrang hinwegtäuschen, dessen es sich im Mittelalter rühmen konnte, denn neben der Bibel galt es als wesentliche Quelle der patristischen Dingexegese und besaß einen lang anhaltenden Vorbildeinfluss auf die Naturlehre des Mittelalters. Was genau sich hinter diesem Physiologus, dessen Bezeichnung aus dem griechischen Wort Fusiologoz (physiológos = Naturforscher, Naturkundiger)4 abgeleitet wird, verbirgt und von welcher Beschaffenheit das Buch ist, soll in der vorliegenden Arbeit untersucht werden. Die Arbeit soll zunächst über die Entstehungsgeschichte und die allgemeinen Charakteristika der unterschiedlichen Physiologus-Schriften informieren, bevor sie den altdeutschen Physiologus – vor allem die Millstätter Reimfassung in ihrer kritischen Transkription, in der sie von Friedrich Maurer herausgegeben wurde5, fokussiert. In einem weiteren Themenkomplex sind dann die Grundlagen über den geistigen Sinn des Wortes im Mittelalter zu vermitteln, bevor ich mich der Millstätter Reimfassung in speziellem Bezug auf ihre Symbolik widmen werde. In Kapitel 5 sind schließlich in nuce der zu bestimmende Belehrungsanspruch des Physiologus im Mittelalter und eine kurze Zusammenfassung zu geben. Die Auflistung der Fußnoten erfolgt – der Übersichtlichkeit halber vor dem abschließenden Quellenverzeichnis.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur Charakteristik des Physiologus
- 2.1. Allgemeine Informationen und Entstehungsgeschichte
- 2.2. Der altdeutsche Physiologus
- 3. Der mehrfache Schriftsinn in der Bibelhermeneutik
- 3.1. Charakteristik und Funktionsweise der Schriftsinne
- 3.2. Bedeutung der Schriftsinne für den Physiologus
- 4. Tierbeschreibungen im altdeutschen Physiologus exemplifiziert an vier Darstellungen
- 4.1. Allgemeine Bemerkungen
- 4.2. Der Löwe
- 4.3. Die Schlange
- 4.4. Der Elefant
- 4.5. Der Ibis
- 5. Belehrungsanspruch der „Naturkundigen-Schrift“ und kurze Gesamtbeurteilung des Physiologus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den altdeutschen Physiologus, insbesondere die Millstätter Reimfassung, unter Berücksichtigung seiner Entstehungsgeschichte, seiner mehrschichtigen Symbolik und seines Einflusses auf die mittelalterliche Naturlehre. Das Ziel ist es, die Besonderheiten dieser Schrift im Kontext der mittelalterlichen Bibelhermeneutik und des mehrfachen Schriftsinns zu beleuchten.
- Entstehungsgeschichte und Charakteristika des Physiologus
- Der mehrfache Schriftsinn in der mittelalterlichen Bibelinterpretation
- Tierdarstellungen und ihre christliche Symbolik im altdeutschen Physiologus
- Der Belehrungsanspruch des Physiologus im Mittelalter
- Der Physiologus als Quelle der mittelalterlichen Naturlehre
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und hebt die Besonderheit des Physiologus als literarisches Werk hervor. Sie betont die langjährige Tradierung, die zahlreichen Handschriften und die kontroversen Diskussionen um seine Entstehung und seinen Ursprung. Die Einleitung skizziert den Forschungsansatz der Arbeit, der die Entstehungsgeschichte, die Charakteristika, die Symbolik und den Belehrungsanspruch des altdeutschen Physiologus untersuchen wird, mit Fokus auf die Millstätter Reimfassung.
2. Zur Charakteristik des Physiologus: Dieses Kapitel beleuchtet die allgemeinen Informationen und die Entstehungsgeschichte des Physiologus. Es diskutiert die unterschiedlichen Interpretationen des Titels „Physiologus“ und die Debatte um die Anonymität des Autors/Bearbeiters. Es wird auf die naturwissenschaftliche Grundlage des Werks und die spätere Hinzufügung der christlich-symbolischen Dimension eingegangen. Das Kapitel behandelt auch die Herausforderungen der Datierung und Lokalisierung der Entstehung des griechischen Archetypus, mit Verweis auf die Forschung von Lauchert, Henkel und anderen, die Alexandria im 2. Jahrhundert als wahrscheinlichsten Entstehungsort identifizieren.
3. Der mehrfache Schriftsinn in der Bibelhermeneutik: Dieses Kapitel behandelt die Funktionsweise und Bedeutung des mehrfachen Schriftsinns in der mittelalterlichen Bibelinterpretation. Es legt dar, wie die verschiedenen Ebenen der Bedeutung (literaler, allegorischer, moralischer und anagogischer Sinn) im Physiologus zum Tragen kommen und wie diese Hermeneutik das Verständnis der Tierbeschreibungen prägt. Es wird die methodologische Grundlage für die Interpretation der Tiersymbolik im Physiologus gelegt.
4. Tierbeschreibungen im altdeutschen Physiologus exemplifiziert an vier Darstellungen: Dieses Kapitel analysiert exemplarisch die Beschreibungen verschiedener Tiere im altdeutschen Physiologus. Es untersucht die jeweilige naturgeschichtliche Darstellung, die entsprechende Bibelstelle und die darauf aufbauende typologische Deutung. Die Analyse der ausgewählten Tiere soll die spezifischen Interpretationsmuster und die Verknüpfung von Naturbeschreibung und christlicher Symbolik veranschaulichen, und die Interpretationsmethode verdeutlichen.
5. Belehrungsanspruch der „Naturkundigen-Schrift“ und kurze Gesamtbeurteilung des Physiologus: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und beleuchtet den Belehrungsanspruch des Physiologus im Mittelalter. Es diskutiert die Bedeutung des Werks als Quelle der Naturlehre und seiner Bedeutung als bedeutende Quelle der patristischen Dingexegese. Die Bedeutung des Werkes als Autorität wird im Kontext des mittelalterlichen Wissenschaftsverständnisses eingeordnet.
Schlüsselwörter
Physiologus, altdeutscher Physiologus, Millstätter Reimfassung, Tiersymbolik, christliche Allegorese, mehrfacher Schriftsinn, Bibelhermeneutik, mittelalterliche Naturlehre, patristische Exegese, Alexandria.
Häufig gestellte Fragen zum altdeutschen Physiologus
Was ist der altdeutsche Physiologus und worum geht es in dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den altdeutschen Physiologus, insbesondere die Millstätter Reimfassung. Der Fokus liegt auf der Entstehungsgeschichte, der mehrschichtigen Symbolik und dem Einfluss auf die mittelalterliche Naturlehre. Die Arbeit beleuchtet die Besonderheiten dieser Schrift im Kontext der mittelalterlichen Bibelhermeneutik und des mehrfachen Schriftsinns.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein und beschreibt den Forschungsansatz. Kapitel 2 (Charakteristik des Physiologus) beleuchtet die Entstehungsgeschichte und allgemeine Informationen. Kapitel 3 (Mehrfacher Schriftsinn) behandelt die Bedeutung des mehrfachen Schriftsinns in der Bibelinterpretation und seine Relevanz für den Physiologus. Kapitel 4 (Tierbeschreibungen) analysiert exemplarisch Tierbeschreibungen und deren christliche Symbolik. Kapitel 5 (Belehrungsanspruch) fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert den Belehrungsanspruch und die Bedeutung des Physiologus im Mittelalter.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Besonderheiten des altdeutschen Physiologus im Kontext der mittelalterlichen Bibelhermeneutik und des mehrfachen Schriftsinns zu beleuchten. Sie untersucht die Entstehungsgeschichte, die Charakteristika, die Symbolik und den Belehrungsanspruch, insbesondere der Millstätter Reimfassung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Entstehungsgeschichte und Charakteristika des Physiologus; der mehrfache Schriftsinn in der mittelalterlichen Bibelinterpretation; Tierdarstellungen und ihre christliche Symbolik; der Belehrungsanspruch des Physiologus; und der Physiologus als Quelle der mittelalterlichen Naturlehre.
Welche Tiere werden exemplarisch in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert exemplarisch die Beschreibungen des Löwen, der Schlange, des Elefanten und des Ibis im altdeutschen Physiologus.
Was ist der mehrfache Schriftsinn und welche Rolle spielt er im Physiologus?
Der mehrfache Schriftsinn (literaler, allegorischer, moralischer und anagogischer Sinn) ist eine Methode der mittelalterlichen Bibelinterpretation. Die Arbeit zeigt, wie diese verschiedenen Bedeutungsebenen im Physiologus zum Tragen kommen und das Verständnis der Tierbeschreibungen prägen.
Welche Bedeutung hatte der Physiologus im Mittelalter?
Der Physiologus war im Mittelalter eine bedeutende Quelle der Naturlehre und der patristischen Dingexegese. Die Arbeit diskutiert seine Bedeutung als Autorität im Kontext des mittelalterlichen Wissenschaftsverständnisses und seines Belehrungsanspruchs.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Physiologus, altdeutscher Physiologus, Millstätter Reimfassung, Tiersymbolik, christliche Allegorese, mehrfacher Schriftsinn, Bibelhermeneutik, mittelalterliche Naturlehre, patristische Exegese, Alexandria.
Wo und wann entstand der Physiologus (laut der Arbeit)?
Die Arbeit diskutiert die Herausforderungen der Datierung und Lokalisierung des griechischen Archetypus und verweist auf Forschungsergebnisse, die Alexandria im 2. Jahrhundert als wahrscheinlichsten Entstehungsort identifizieren.
- Quote paper
- Tim Brüning (Author), 2004, Der altdeutsche Physiologus - Seine Tiersymbolik unter dem Aspekt des mehrfachen Schriftsinns und christlicher Allegorese., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22210