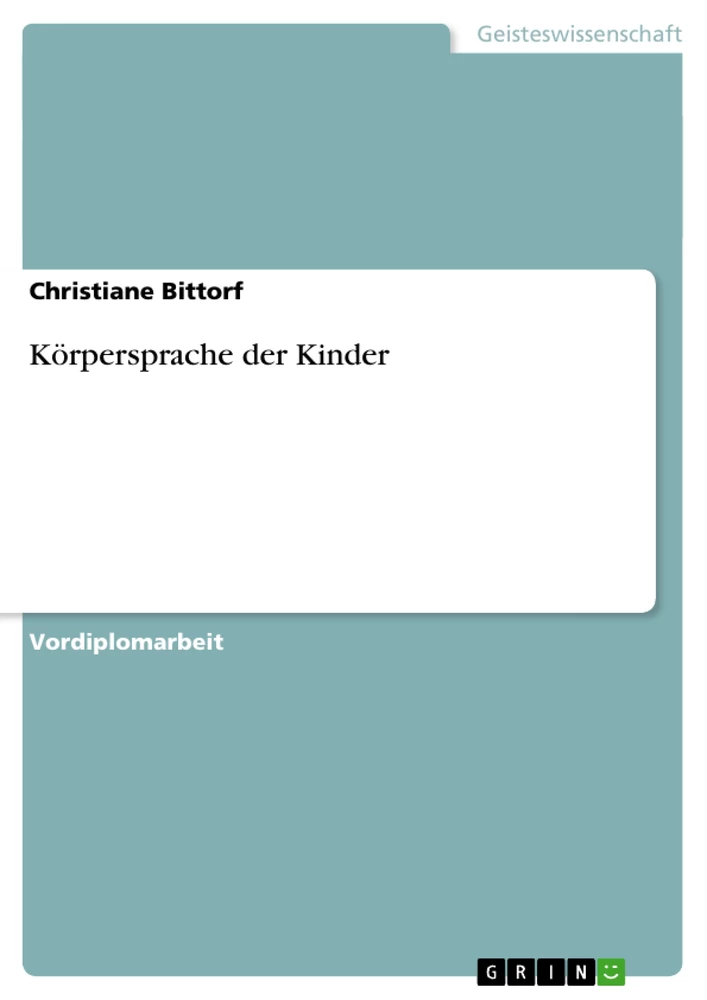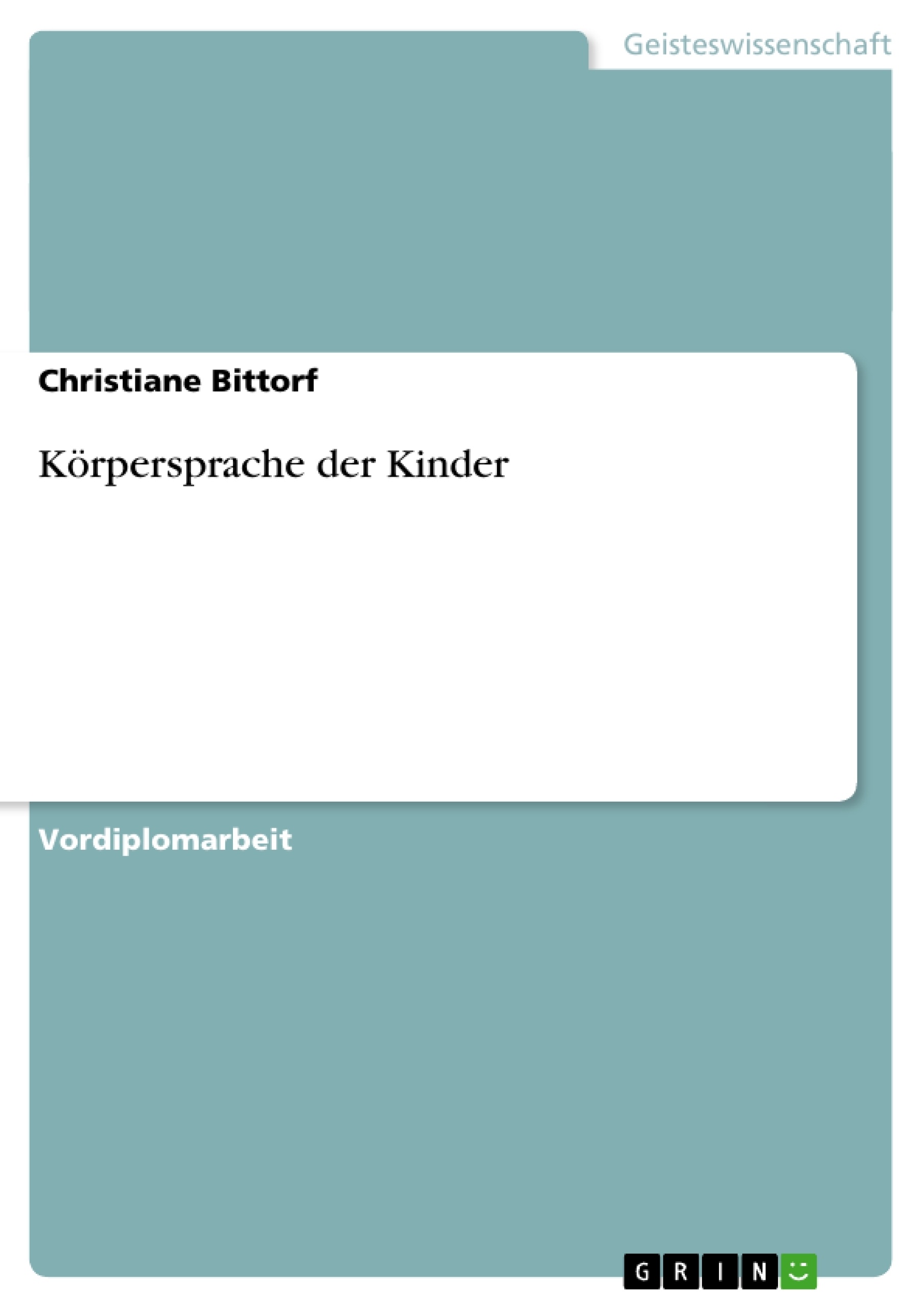. Einleitung
Was ist Körpersprache?
„So wie einer ist, so bewegt er sich. So wie einer sich beweg, so ist er.“ 1
Körpersprache ist eine angeborene (genetisch übernommene) und anerzogene (Sozialisationsbedingte), sowie erlernte (ganzheitliche) Bewegung. Sie ist eine ganzheitliche Augenblicksleistung mit unwiderlegbarem und unwiederholbarem analogen Zeichenmaterial. (Sie ist immer Gegenwart, nicht Zukunft oder Vergangenheit) Körpersprache ist Metakommunikation. (Kommunikation über Kommunikation). Sie kann Informationen unmittelbar betonen und verstärken, abschwächen, verändern oder aufheben. 2 Körpersprache ist das bedeutendste nonverbale Kommunikationssystem. Sie ist das wichtigste Ausdrucksmittel des Menschen. Das älteste Codesystem der Menschheit. (Der menschliche Körper hat sich seit ca. 400.000 Jahren kaum mehr verändert.) Es hatte immer die Funktion, menschliche Beziehungen zu regulieren und Machtstrukturen und soziale Ordnung zu festigen. Die Körpersprache ist für die soziale Repräsentanz und Interpretation eines Menschen bedeutender als die Sprache. Körpersprache „übersetzt“ Gedanken und Gefühle zeitgleich. Ein Beispiel: Noch bevor der Mund sagt: “Mir geht es gut“, drückt dies der Körper schon aus. Daher kann Körpersprache nicht lügen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Stufen der Entwicklung
- Im Mutterleib
- Die pränatale Phase (Vor der Geburt)
- Nach der Geburt
- Das Säuglingsalter
- Das Gehirn und seine beiden Gehirnhemisphären
- Angenehme und Unangenehme Empfindungen
- Frühkindliche Bewegung als Ausdruck von Körpersprache
- Das Kleinkindalter
- Entfernung auf Blickweite
- Erwünschte und Unerwünschte Hilfestellungen
- Die angeborene Angst
- Territorialverhalten
- Der Einzelgänger und die Gruppe
- Die Schulzeit
- Die gemalten Buchstaben und die Geschriebenen
- Achtung: Körpersprache
- Zuviel verlangt (Zu schwer für junge Schultern)
- Sechs Gesichtsausdrücke des Menschen
- Zusammenfassung
- Literatur und Materialien
- Im Mutterleib
- Entwicklung der Körpersprache in verschiedenen Lebensphasen
- Bedeutung der pränatalen Entwicklung für die Körpersprache
- Die Rolle der Körpersprache in der Kommunikation und Interaktion von Kindern
- Zusammenhang zwischen Körpersprache und kognitiver, emotionaler und sozialer Entwicklung
- Die Bedeutung der Körpersprache für das Verständnis von kindlichen Bedürfnissen und Emotionen
- Einleitung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Körpersprache und erklärt deren Bedeutung als nonverbale Kommunikation. Es werden die wichtigsten Aspekte der Körpersprache, wie die genetische Prägung, die Sozialisation und die ganzheitliche Bewegung, erläutert. Die Einleitung betont die Wichtigkeit der Körpersprache für die menschliche Kommunikation und soziale Interaktion.
- Die Stufen der Entwicklung: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der Körpersprache von der pränatalen Phase bis zur Schulzeit. Es wird die Bedeutung der verschiedenen Lebensphasen für die Entwicklung der nonverbalen Kommunikation hervorgehoben und die spezifischen Merkmale der Körpersprache in jeder Phase beleuchtet. Es werden beispielsweise die Schaukelbewegung im Mutterleib, die Entwicklung der frühkindlichen Bewegung und die Bedeutung der Körpersprache für das soziale Bewusstsein in der Schulzeit behandelt.
- Im Mutterleib: Das Kapitel konzentriert sich auf die pränatale Phase und erklärt die Bedeutung der Bewegungen des Kindes im Mutterleib für die spätere Entwicklung der Körpersprache. Es wird die Bedeutung der Schaukelbewegung im Mutterleib und deren Bedeutung für die Entwicklung nach der Geburt erläutert.
- Nach der Geburt: Dieser Abschnitt beschreibt die ersten Schritte des Kindes nach der Geburt und die sich daraus ergebenden neuen Herausforderungen in der Kommunikation und Interaktion.
- Das Säuglingsalter: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Entwicklung der Körpersprache im Säuglingsalter. Es wird die Bedeutung des Gehirns, die Entwicklung der Sinneswahrnehmung und die Bedeutung der frühkindlichen Bewegung für die Entwicklung der Körpersprache erläutert.
- Das Kleinkindalter: Das Kapitel behandelt die Entwicklung der Körpersprache im Kleinkindalter. Es wird die Bedeutung der räumlichen Wahrnehmung, die Entwicklung von Bedürfnissen und die Bedeutung der sozialen Interaktion für die Entwicklung der Körpersprache erklärt.
- Die Schulzeit: Dieses Kapitel fokussiert auf die Entwicklung der Körpersprache im Schulalter. Es wird die Bedeutung des sozialen Bewusstseins, die Entwicklung der Kommunikation und die Bedeutung der Interaktion mit Gleichaltrigen für die Entwicklung der Körpersprache erklärt.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Vordiplomarbeit befasst sich mit der Körpersprache von Kindern und analysiert die Entwicklung dieser nonverbalen Kommunikation in verschiedenen Lebensphasen. Das Ziel ist, ein tieferes Verständnis für die Entwicklung der Körpersprache von der pränatalen Phase bis zur Schulzeit zu gewinnen und die Bedeutung der Körpersprache für die kindliche Entwicklung zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Körpersprache, nonverbale Kommunikation, Entwicklung, Kind, pränatale Phase, Säuglingsalter, Kleinkindalter, Schulzeit, soziale Interaktion, Bewegung, Wahrnehmung, Emotionen, Bedürfnisse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Definition von Körpersprache?
Körpersprache ist ein nonverbales Kommunikationssystem, das angeborene, erlernte und sozialisationsbedingte Bewegungen umfasst. Sie gilt als „Metakommunikation“ über die gesprochene Sprache.
Warum kann Körpersprache „nicht lügen“?
Körpersprache übersetzt Gefühle und Gedanken oft schneller und unmittelbarer als das gesprochene Wort, wodurch sie unbewusste Reaktionen zeigt, bevor wir sie verbal kontrollieren können.
Welche Rolle spielt die pränatale Phase für die Körpersprache?
Bereits im Mutterleib entwickeln Kinder Bewegungsmuster (z. B. Schaukeln), die die Basis für die spätere motorische und nonverbale Ausdrucksfähigkeit bilden.
Wie zeigt sich Körpersprache im Kleinkindalter?
Im Kleinkindalter äußert sich Körpersprache durch Territorialverhalten, Distanzregulierung (Blickweite) und nonverbale Signale für Hilfebedarf oder Ablehnung.
Gibt es universelle Gesichtsausdrücke?
Ja, es gibt sechs grundlegende Gesichtsausdrücke (z. B. Freude, Angst, Wut), die kulturübergreifend ähnlich interpretiert werden und zentrale Emotionen ausdrücken.
- Quote paper
- Christiane Bittorf (Author), 2002, Körpersprache der Kinder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22402