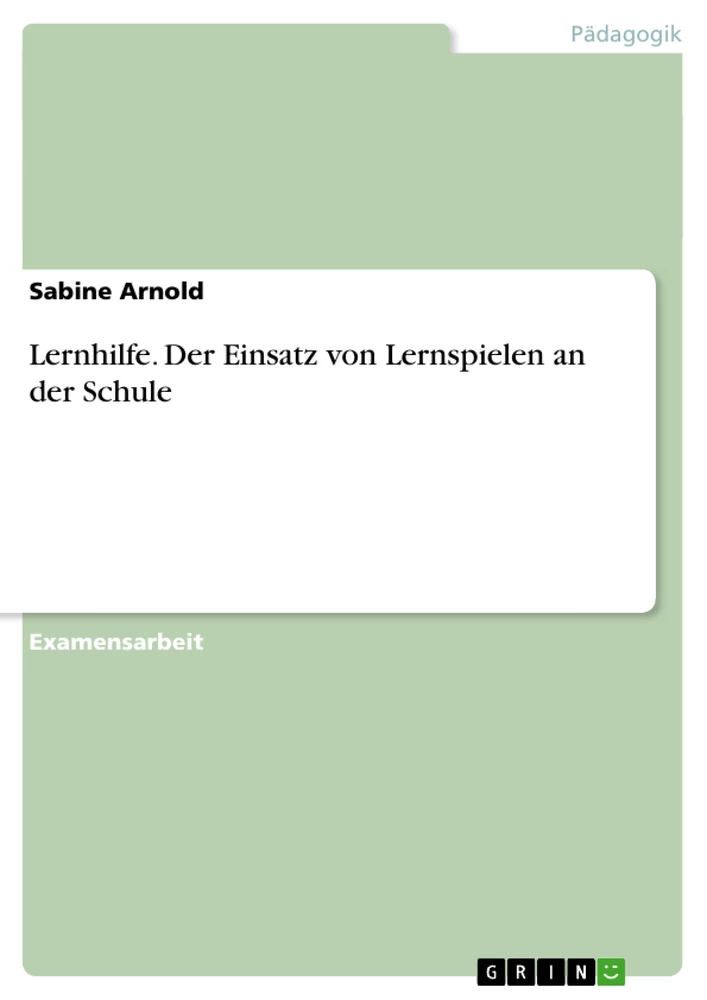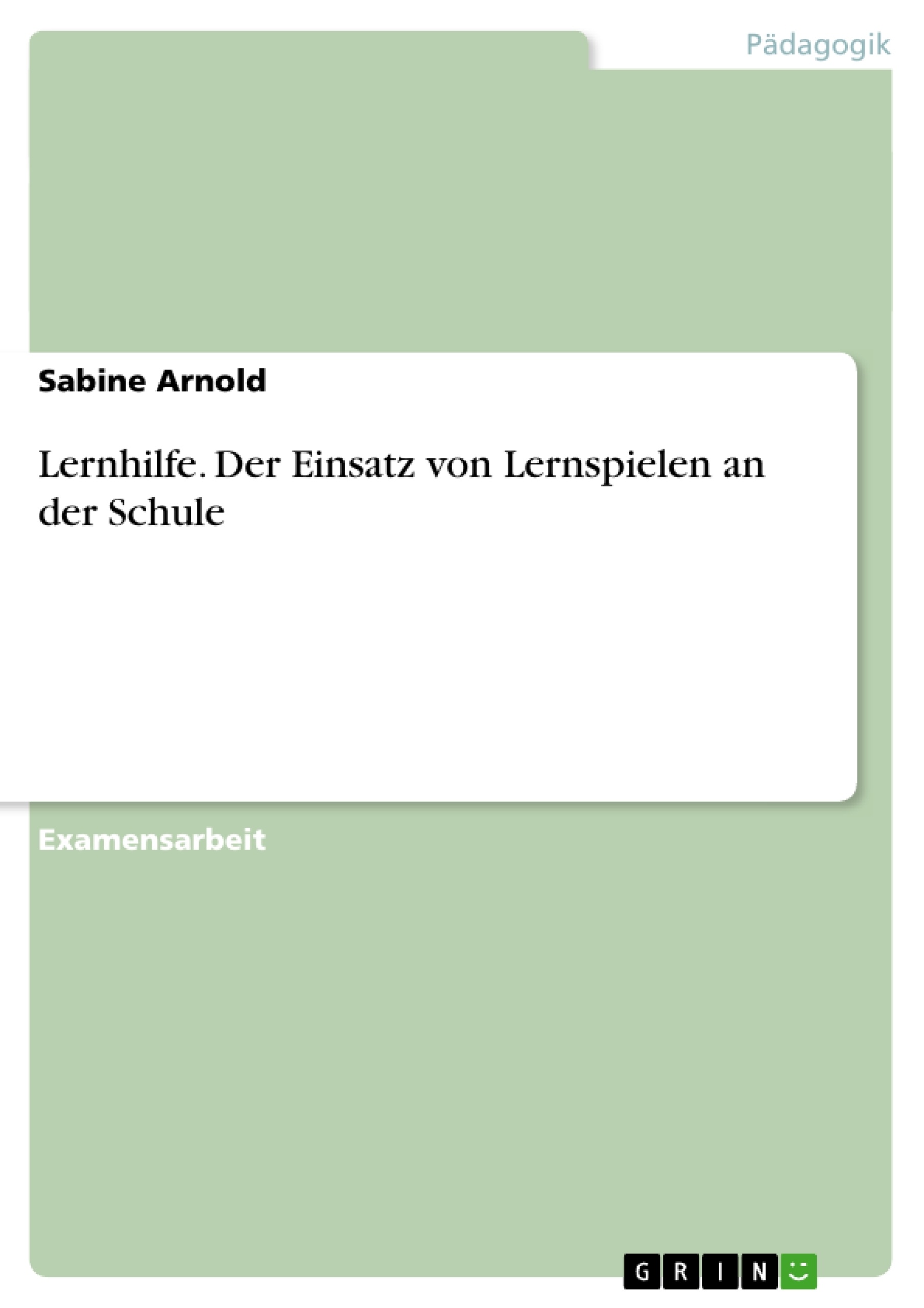Spielen ist eine Form des Lernens, die eine Ausbildung von Lernprozessen auf kindgerechter Ebene gestaltet. Der Aspekt der Eigenaktivität von Kindern im Spiel stellt einen wichtigen Gegenpol zu deren relativ passiven Rolle bei der Wissensvermittlung im Unterricht dar. Im Gegensatz zur Unterrichtssituation rücken die Schüler im Lernspiel in den Vordergrund. Ihr aktives Handeln kann die Ausbildung von Lernprozessen ermöglichen, die ihr Gefühlsleben, ihre Lernmotivation und ihre kognitiven Fähigkeiten positiv beeinflussen.
Für Lernhilfeschulen ist ein Rückgriff auf die unzähligen, im Handel erhältlichen Lernspielangebote zu verschiedensten Themenbereichen oft nicht ausreichend. Vorgefertigte Lernspiele sind in der Regel so allgemein ausgerichtet, dass sie den spezifischen Bedürfnissen einer individuellen Schülergruppe mit ihren jeweiligen Defiziten nicht in genügendem Maße gerecht werden können.
Aus diesem Grunde ist es die Grundlage dieses Buches, wichtige Kriterien herauszuarbeiten, die ein Lernspiel definieren sollten und in diesem Sinne Anregungen für Lehrer und Lehrerinnen an der Schule für Lernhilfe zur Gestaltung einer auf die jeweiligen Bedürfnisse der Klasse zugeschnittenen spielerischen Umwelt zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lernbehinderte Kinder
- Die Schule für Lernhilfe als Teilbereich der Sonderschule
- Die Lernbehinderung
- Der Zusammenhang von Lernbehinderungen und Verhaltensauffälligkeiten
- Die Verhaltensauffälligkeit
- Allgemeine Ursachen von Lernbehinderungen
- Endogene Ursachen
- Exogene Ursachen
- Häufige Erscheinungsbilder und Ursachen von Lernbehinderungen im Einzelnen und ihre Bedeutung für den schulischen Unterricht
- Das wahrnehmungsgestörte Kind
- Das lese- und rechtschreibschwache Kind
- Das rechenschwache Kind
- Das sprach- und sprechbeeinträchtigte Kind
- Das antriebsschwache Kind
- Das unkonzentrierte Kind
- Das insuffiziente Kind
- Das ängstliche Kind
- Das aggressive Kind
- Der Begriff des Spiels und seine Bedeutung für das Lernen
- Spiel im Wandel der Zeit
- Wesensmerkmale der Spieltätigkeit
- Die individuelle Wirklichkeit
- Die zeitliche Unbegrenztheit
- Die Spannung
- Die inneren Grenzen
- Die Zeitlosigkeit
- Klassifikationsversuche des Spiels
- Das Verhältnis von Spielen und Lernen
- Spiel und kognitive Entwicklung
- Das Lernspiel
- Begriffsbestimmung des Lernspiels
- Das Lernspiel - didaktisches Arbeitsmittel oder didaktisches Spielmittel?
- Abgrenzung zum Spielzeug
- Das Lernspiel und seine Berechtigung für den pädagogischen Einsatz
- Anforderungen an das Lernspiel im Unterricht
- Der Einsatz von Lernspielen an der Schule für Lernhilfe
- Förderung lernbehinderter Kinder durch Lernspiele
- Förderungsmöglichkeiten im Bereich der kognitiven Lernziele
- Vermittlung, Übung und Festigung von grundlegenden Kenntnissen und Fähigkeiten
- Erprobung von gelerntem Wissen und Ausbildung logischer Denkprozesse
- Einführung neuer Lerninhalte
- Förderungsmöglichkeiten in speziellen Defizitbereichen
- Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit
- Förderung des Sozialverhaltens und der sozialen Integration
- Kreativitätsaufbau
- Flexibilitätsentwicklung
- Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit
- Konzentrations- und Aufmerksamkeitstraining
- Motivationssteigerung und positive Einstellung zum Unterricht
- Selbstbestimmungsförderung
- Abbau von Ängsten und Minderwertigkeitsgefühlen
- Aggressionsabbau
- Möglichkeiten der Differenzierung durch Lernspiele
- Geeignete Lernspielformen für den Unterricht mit lernbehinderten Kindern
- Regelspiele
- Rollenspiele
- Simulationsspiele
- Bewegungsspiele
- Sprachspiele
- Die Charakteristika von Lernbehinderungen und deren Auswirkungen auf den schulischen Unterricht
- Der didaktische Wert von Lernspielen und ihre spezifischen Einsatzmöglichkeiten in der Lernhilfe
- Die Entwicklung und Förderung von kognitiven und sozialen Kompetenzen bei lernbehinderten Kindern durch Lernspiele
- Die Auswahl und Gestaltung geeigneter Lernspielformen für den Unterricht mit lernbehinderten Kindern
- Die Bedeutung der Spielpädagogik und ihrer Anwendung in der Praxis der Lernhilfe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Einsatz von Lernspielen an der Schule für Lernhilfe. Sie untersucht die Bedeutung des Spiels für das Lernen und analysiert, wie Lernspiele zur Förderung lernbehinderter Kinder eingesetzt werden können.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Hintergrund des Themas und die Relevanz des Themas "Einsatz von Lernspielen an der Schule für Lernhilfe" beleuchtet. Kapitel 2 bietet einen Überblick über lernbehinderte Kinder und die Schule für Lernhilfe als Teilbereich der Sonderschule. Es werden verschiedene Erscheinungsbilder und Ursachen von Lernbehinderungen betrachtet, die für den schulischen Unterricht relevant sind.
Kapitel 3 widmet sich dem Begriff des Spiels und seiner Bedeutung für das Lernen. Es werden Wesensmerkmale der Spieltätigkeit und verschiedene Klassifikationsversuche des Spiels erläutert.
Kapitel 4 beleuchtet das Lernspiel, seine Begriffsbestimmung und seine Berechtigung für den pädagogischen Einsatz. Es werden Anforderungen an das Lernspiel im Unterricht sowie die Förderungsmöglichkeiten für lernbehinderte Kinder durch Lernspiele betrachtet.
Kapitel 5 schließlich stellt verschiedene geeignete Lernspielformen für den Unterricht mit lernbehinderten Kindern vor, darunter Regelspiele, Rollenspiele, Simulationsspiele, Bewegungsspiele und Sprachspiele.
Schlüsselwörter
Lernbehinderung, Schule für Lernhilfe, Lernspiel, Spielpädagogik, kognitive Entwicklung, soziale Integration, Unterrichtsgestaltung, Differenzierung.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Lernspiele für lernbehinderte Kinder wichtig?
Spielen ermöglicht Eigenaktivität und Motivation, was einen wichtigen Gegenpol zur passiven Rolle im klassischen Unterricht darstellt und kognitive sowie soziale Prozesse fördert.
Welche Defizite können durch Lernspiele adressiert werden?
Lernspiele können gezielt bei Wahrnehmungsstörungen, Lese-Rechtschreib-Schwäche, Rechenschwäche sowie bei Konzentrationsmangel und Ängsten helfen.
Warum reichen vorgefertigte Lernspiele oft nicht aus?
Handelsübliche Spiele sind oft zu allgemein. Lehrer an Förderschulen müssen Spiele oft an die spezifischen Bedürfnisse und Defizite ihrer individuellen Schülergruppe anpassen.
Welche Spielformen eignen sich für den Unterricht?
Besonders geeignet sind Regelspiele, Rollenspiele, Simulationsspiele, Bewegungsspiele und Sprachspiele, da sie unterschiedliche Förderziele abdecken.
Wie fördern Lernspiele das Sozialverhalten?
Durch das gemeinsame Spielen werden soziale Integration, Kommunikationsfähigkeit und der Abbau von Aggressionen innerhalb der Klassengemeinschaft trainiert.
- Arbeit zitieren
- Sabine Arnold (Autor:in), 1999, Lernhilfe. Der Einsatz von Lernspielen an der Schule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22504