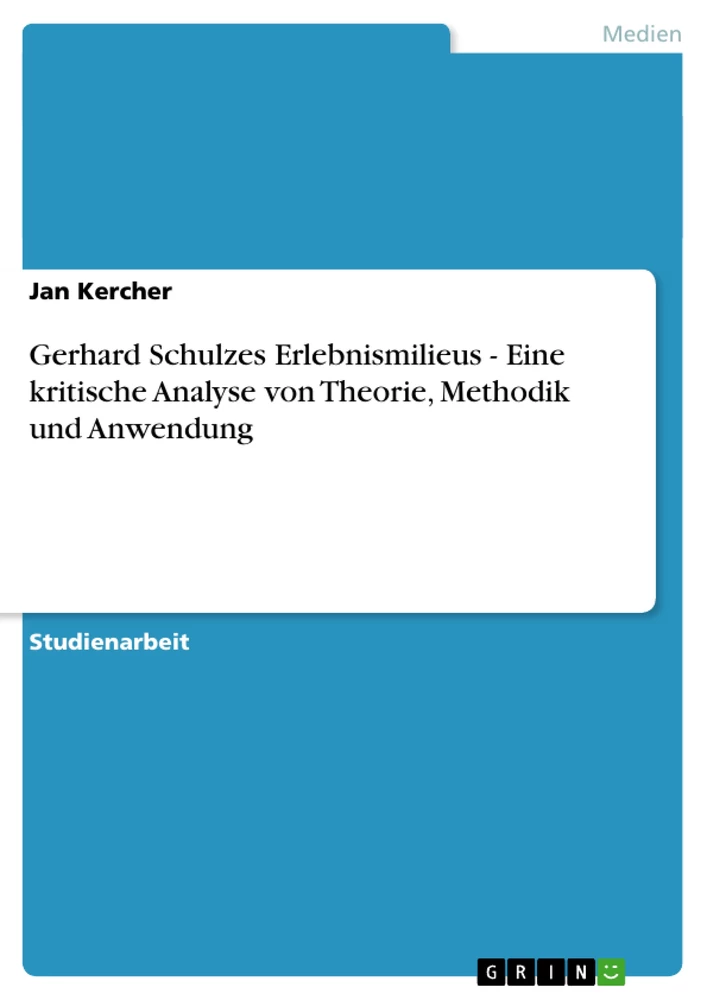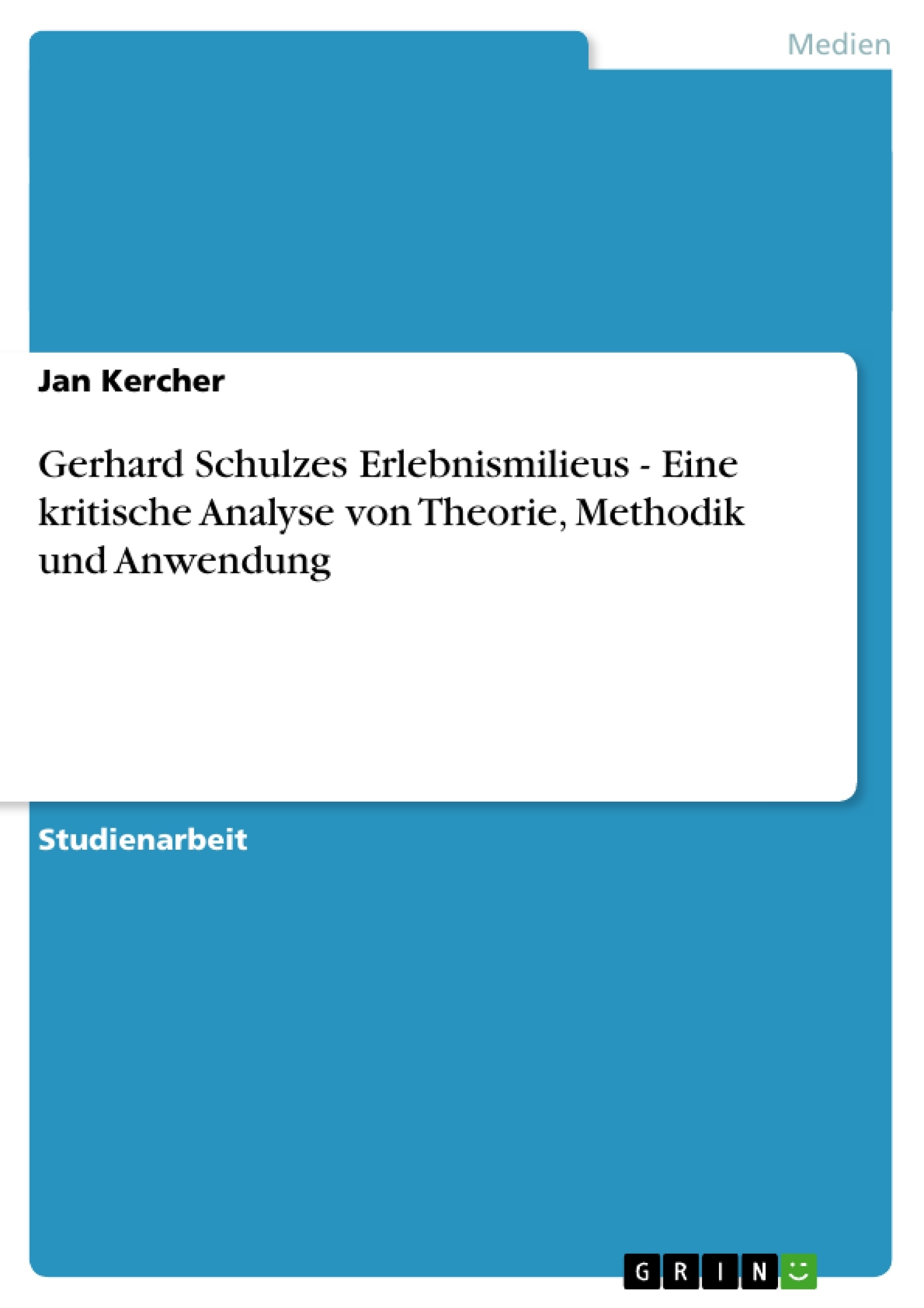Hungersnot und Existenzangst, wie sie bis Mitte des letzten Jahrhundert auch in Deutschland noch vorkamen, erscheinen uns heute nicht mehr real. Solche Zustände werden allenfalls noch mit weit entfernten Ländern in der „Dritten Welt“ verbunden. Auch wenn die Zeiten des deutschen Wirtschaftswunders vorbei sind und die Folgen der deutschen Vereinigung und die allgemeine Wirtschaftslage momentan zu Sparmaßnahmen in vielen Bereichen zwingen mögen, kann man für Deutschland auch heute noch von einer Wohlstandsgesellschaft, wenn nicht sogar von einer Überflussgesellschaft sprechen. Seit den 60er Jahren war – aufgrund dieser veränderten Lebensverhältnisse – in den Sozialwissenschaften immer häufiger von Begriffen wie „Wertewandel“ oder „Individualisierung“ zu lesen. Dem Wandel der wirtschaftlichen Verhältnisse folgte laut dieser neuen Erkenntnisse ein Wandel der individuellen Handlungsweisen. Für viele, v.a. jüngere Menschen, ging es nun nicht mehr um bloße Existenzsicherung. Das Wirtschaftswunder und der damit neu gewonnene Wohlstand hatten für eine Verschiebung der Bedürfnisse der jüngeren Generation weg von materialistischen Werten hin zu immaterialistischen Werten wie Gleichberechtigung, Umweltschutz, Völkerverständigung u.ä. geführt. Gleichzeitig bedeutete der Zuwachs an Freizeit, Geld und Bildung für viele auch einen Zuwachs an Wahlmöglichkeiten in Bezug auf ihre Lebensplanung. Der soziale Hintergrund schien immer weniger als Erklärungsvariable für das spätere Leben eines Menschen herhalten zu können.
Die noch bis in die 70er Jahre hinein dominierenden Klassen- und Schichttheorien, die „traditionelle“ Sozialstrukturanalyse der Soziologie, wurden deshalb zunehmend in Frage gestellt. Gerhard Schulzes zu Beginn der 90er Jahre erschienene Arbeit „Die Erlebnisgesellschaft „radikalisiert die Abkehr von der Vorstellung vertikaler, im wesentlichen am sozialen Status festzumachender Ungleichheit und begreift Alter, Bildung und Lebensstil als zentrale Strukturierungselemente, aus deren Kombination sich fünf soziale Milieus ergeben.
Diese Arbeit soll überprüfen, inwieweit Schulzes Modell heute noch als Basis moderner psychographischer Zielgruppenmodelle dienen kann. Hierzu soll zunächst ein kurzer Überblick über Schulzes theoretische Annahmen und Entwürfe vermittelt werden, um diese im Anschluss anhand aktueller Umsetzungen bzw. Rekonstruktionen in Markt- und Sozialforschung beurteilen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie: Die Erlebnisgesellschaft
- Der Wandel zur Erlebnisgesellschaft
- Soziale Milieus
- Bedeutung von Zeichen
- Stil und alltagsästhetische Schemata
- Bildung und Beschreibung der sozialen Milieus
- Methodik: Ansätze zur empirische Rekonstruktionen der Erlebnismilieus
- Kritik der methodischen Vorgehensweise von Gerhard Schulze
- Empirische Rekonstruktion durch Peter H. Hartmann
- Empirische Rekonstruktion durch Olaf Wenzel
- Anwendung: Die Erlebnismilieus in der VerbraucherAnalyse
- Methodische Vorgehensweise
- Produktbeispiel: Programmzeitschriften
- Zusammenfassung
- Methodische Bewertung der empirischen Rekonstruktionen und der Anwendung in der Verbraucheranalyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, inwieweit Gerhard Schulzes Modell der „Erlebnisgesellschaft“ heute noch als Grundlage moderner psychographischer Zielgruppenmodelle dienen kann. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse von Schulzes theoretischen Annahmen und Entwürfen sowie deren Bewertung anhand aktueller Umsetzungen und Rekonstruktionen in der Markt- und Sozialforschung.
- Der Wandel von der Knappheitsgesellschaft zur Erlebnisgesellschaft
- Die Bedeutung von Lebensstil und sozialen Milieus
- Methodische Ansätze zur Rekonstruktion von Erlebnismilieus
- Die Anwendung von Schulzes Modell in der Verbraucheranalyse
- Kritik an Schulzes Modell und dessen Relevanz für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit beleuchtet den Wandel der deutschen Gesellschaft hin zu einer Wohlstands- und Überflussgesellschaft, der mit einem Wertewandel und der zunehmenden Bedeutung von Individualisierung einherging. Die klassische Sozialstrukturanalyse wird in Frage gestellt und neue Ansätze, wie die Lebensstilforschung, gewinnen an Bedeutung.
- Theorie: Die Erlebnisgesellschaft: In diesem Kapitel werden Schulzes theoretische Konzepte zur „Erlebnisgesellschaft“ und den „Erlebnismilieus“ vorgestellt. Der Fokus liegt auf der Analyse des Wandels von der Knappheitsgesellschaft hin zur Erlebnisgesellschaft und den damit verbundenen Veränderungen in der Sozialstruktur. Der Autor argumentiert, dass die „Erlebnisgesellschaft“ durch eine Vermehrung von Möglichkeiten geprägt ist, die zu einer neuen Orientierung von Individuen und Gruppen führt.
- Methodik: Ansätze zur empirische Rekonstruktionen der Erlebnismilieus: Dieses Kapitel beleuchtet die methodischen Ansätze zur empirischen Rekonstruktion der Erlebnismilieus und analysiert die kritischen Punkte in Schulzes methodischem Vorgehen. Es werden aktuelle Rekonstruktionen von Peter H. Hartmann und Olaf Wenzel vorgestellt und ihre Ansätze im Vergleich zu Schulzes Modell diskutiert.
- Anwendung: Die Erlebnismilieus in der VerbraucherAnalyse: Dieser Teil befasst sich mit der Anwendung von Schulzes Modell in der Verbraucheranalyse und präsentiert ein konkretes Produktbeispiel. Es werden die methodischen Vorgehensweisen und die Interpretation der Ergebnisse im Kontext der „Erlebnisgesellschaft“ dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie die Erlebnisgesellschaft, soziale Milieus, Lebensstilforschung, psychographische Zielgruppenmodelle, Verbraucheranalyse und methodische Ansätze zur Rekonstruktion von Erlebnismilieus.
Häufig gestellte Fragen
Was kennzeichnet Gerhard Schulzes "Erlebnisgesellschaft"?
Schulze beschreibt den Wandel von einer Knappheitsgesellschaft zu einer Überflussgesellschaft, in der nicht mehr die Existenzsicherung, sondern die Suche nach Erlebnissen und die Gestaltung des Lebensstils im Vordergrund stehen.
Welche fünf sozialen Milieus definiert Schulze?
Schulze kombiniert Alter, Bildung und Lebensstil, woraus sich fünf spezifische Milieus ergeben (z.B. Niveaumilieu, Integrationsmilieu, Selbstverwirklichungsmilieu, Unterhaltungsmilieu und Harmoniemilieu).
Warum wird die klassische Schichttheorie heute oft kritisiert?
Kritiker argumentieren, dass der soziale Status allein das Handeln der Menschen nicht mehr ausreichend erklärt. Individualisierung und Wahlmöglichkeiten führen dazu, dass psychographische Merkmale und Lebensstile wichtiger werden.
Wie werden Erlebnismilieus in der Marktforschung empirisch rekonstruiert?
Forscher wie Hartmann oder Wenzel nutzen statistische Verfahren und Umfragen (z.B. Verbraucheranalysen), um die theoretischen Milieus in realen Datensätzen abzubilden und für Produktmarketing nutzbar zu machen.
Ist das Modell der Erlebnisgesellschaft heute noch aktuell?
Die Arbeit unterzieht das Modell einer kritischen Prüfung und untersucht, inwieweit es als Basis für moderne Zielgruppenmodelle in einer sich ständig wandelnden Gesellschaft noch tragfähig ist.
- Quote paper
- Jan Kercher (Author), 2003, Gerhard Schulzes Erlebnismilieus - Eine kritische Analyse von Theorie, Methodik und Anwendung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22534