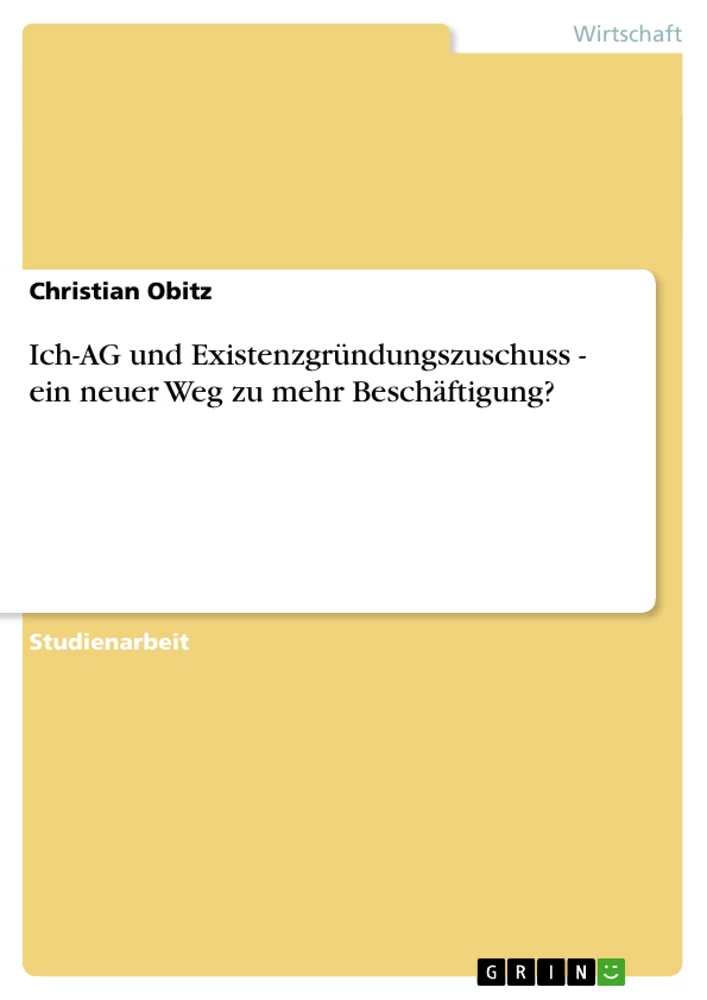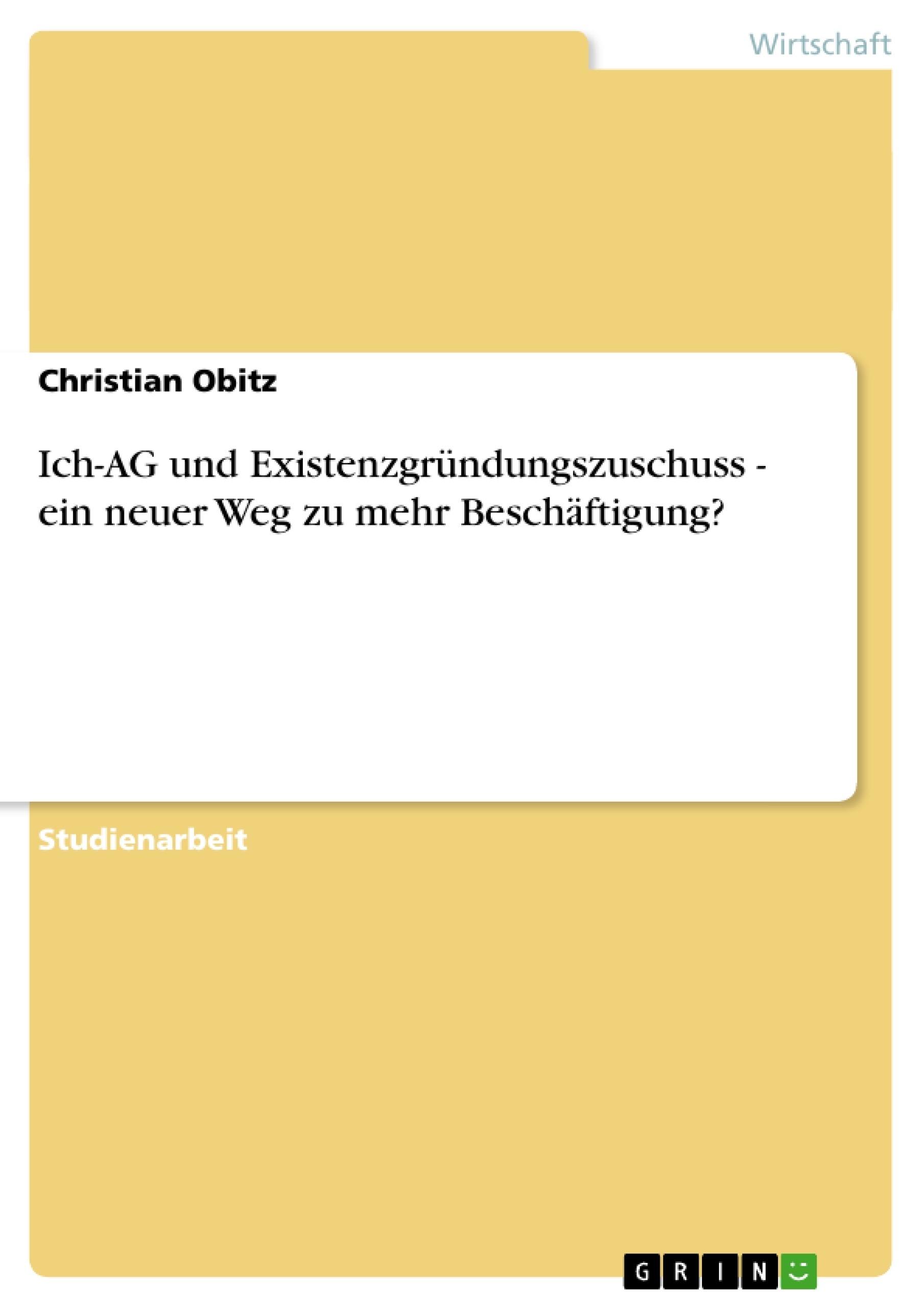[...] Am 16.08.2002 wurde der Abschlussbericht der 15 Kommissionsmitglieder
an Bundeskanzler Dr. Gerhard Schröder übergeben. In diesem Abschlussbericht sind
13 sogenannte „Innovationsmodule“ enthalten, deren Umsetzung zu einem starken
Abbau der Arbeitslosigkeit führen sollte. Das neunte der 13 Reformmodule enthält unter dem Titel „Neue Beschäftigung und
Abbau von Schwarzarbeit durch „Ich-AG“ und „Familien-AG“ mit vollwertiger
Versicherung, Mini-Jobs mit Pauschalabgabe und Abzugsfähigkeit von privaten
Dienstleistungen“ unter anderem Vorschläge zur Unterstützung von
Existenzgründungen im Rahmen der „Ich-AG“. Diese Vorschläge wurden in
abgeänderter Version als „Existenzgründungszuschuss“ gesetzlich umgesetzt. Bei
einer Existenzgründung aus der Arbeitslosigkeit heraus soll der Unternehmer mittels
dieses Zuschusses unter Berücksichtigung einer Einkommensobergrenze für bis zu drei Jahre finanziell unterstützt und seine soziale Sicherung erhalten werden. Eine
Abwanderung in die Schattenwirtschaft soll für den selbständig Tätigen auf Grund der
Förderung weniger attraktiv werden.
Die Erwartungen an die „Ich-AG“ bzw. den Existenzgründungszuschuss liegen
gemeinsam mit den ebenfalls im Modul enthaltenen Mini-Jobs bei einem
Beschäftigungseffekt von 200.000 bis 500.000 Personen5. Im Zuge dieser Arbeit soll
neben der Darstellung der Regelungen zum Existenzgründungszuschuss untersucht
werden, in wie weit dieser eine Alternative zur Schwarzarbeit und einen Anreiz zum
Weg aus der Arbeitslosigkeit darstellt. Es geschieht eine Betrachtung alternativer
Fördermöglichkeiten, insbesondere des Überbrückungsgeldes und ein Vergleich der
Attraktivität der beiden Förderinstrumente. Zudem wird untersucht, in wie weit die
Existenzgründung überhaupt zur Senkung der Arbeitslosigkeit beitragen kann, speziell
auch im Hinblick auf die Größe der gegründeten Unternehmen, die bei der „Ich-AG“
stark begrenzt ist. Abschließend erfolgt eine Vorstellung der bisherigen Erfahrungen
und den Maßnahmen, die den Existenzgründungszuschuss begleiten sollen, wie auch
der bereits in die Wege geleiteten Änderungen.
Am Beginn dieser Arbeit soll aber eine kurze Einführung in die aktuellen Probleme am
Arbeitsmarkt und die Problematik der Schattenwirtschaft stehen, um aufzuzeigen,
warum Reformen nötig sind und Förderungsmaßnahmen zur selbständigen
Beschäftigung sinnvoll sein können.
5 Bericht der Kommission „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“, S. 276
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Anlass zu Reformen
- 2.1. Arbeitslosigkeit in Deutschland
- 2.2. Schattenwirtschaft
- 3. Selbständigkeit als Ziel der Arbeitsmarktpolitik
- 3.1. Faktoren für den Trend zur Selbständigkeit
- 4. Der Existenzgründungszuschuss
- 4.1. Die Kommission „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“
- 4.2. Gesetzliche Regelungen zum Existenzgründungszuschuss
- 4.3. In Kraft treten und Regelungen der Gesetze
- 4.4. Steuern
- 4.5. Sozialversicherung
- 4.6. Vorteile durch die Förderung
- 4.7. Änderungen zu den ursprünglichen Planungen der Hartz-Kommission
- 5. Selbständigkeit und Existenzgründungszuschuss im Vergleich mit anderen Einkommensarten
- 5.1. Existenzgründung - Arbeitslosigkeit
- 5.2. Vergleich Existenzgründungszuschuss - Arbeitslosengeld und -hilfe
- 5.3. Existenzgründungszuschuss - nicht-selbständige Beschäftigung
- 5.4. Existenzgründungszuschuss - Schwarzarbeit
- 5.5. Niedrigere Einkommen als Zielgruppe - Schwarzarbeit bleibt attraktiv
- 6. Auswirkungen von Existenzgründungen
- 6.1. Erhöhung der Beschäftigung durch Existenzgründung und Selbständigkeit
- 6.2. Existenzgründung - Wege zu mehr Beschäftigung?
- 6.3. Kleine Unternehmen als Arbeitsplatzmotor?
- 6.4. Welche Unternehmen überleben?
- 6.5. Existenzgründungen im Niedriglohnbereich
- 6.6. Existenzgründungszuschuss und Arbeitsmarkteffekte
- 6.7. Ende der Förderung und Bestehen im Markt
- 7. Existenzgründungszuschuss: Erwartungen, Erfahrungen und weitere Entwicklung
- 7.1. Potentielle Zahl der Bezieher
- 7.2. Bewilligungen seit Inkrafttreten
- 7.3. Neue Regelungen zur Förderung von Selbständigkeit und Existenzgründung
- 8. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss des Existenzgründungszuschusses auf den deutschen Arbeitsmarkt. Ziel ist es, die Wirksamkeit dieser Fördermaßnahme zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze zu analysieren. Dabei werden verschiedene Aspekte betrachtet, von den gesetzlichen Regelungen und den damit verbundenen Vorteilen bis hin zu einem Vergleich mit alternativen Einkommensquellen wie Arbeitslosengeld oder Schwarzarbeit.
- Wirksamkeit des Existenzgründungszuschusses bei der Arbeitslosenbekämpfung
- Vergleich des Existenzgründungszuschusses mit anderen Einkommensquellen
- Analyse der Auswirkungen von Existenzgründungen auf die Beschäftigung
- Bewertung des Existenzgründungszuschusses als Instrument der Arbeitsmarktpolitik
- Langfristige Überlebensfähigkeit von Unternehmen nach Auslaufen der Förderung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und skizziert die zentrale Forschungsfrage: Kann der Existenzgründungszuschuss einen Beitrag zur Senkung der Arbeitslosigkeit leisten? Sie legt den Fokus auf die Bedeutung von Selbständigkeit als arbeitsmarktpolitisches Instrument und kündigt die Struktur der folgenden Kapitel an.
2. Anlass zu Reformen: Dieses Kapitel beschreibt den Hintergrund der Reformbemühungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Es beleuchtet die hohe Arbeitslosenquote, insbesondere den Anteil gering qualifizierter Arbeitsloser, und die Bedeutung der Schattenwirtschaft als Problemfaktor. Diese Darstellung dient als Grundlage für die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Förderung von Selbständigkeit und Existenzgründungen.
3. Selbständigkeit als Ziel der Arbeitsmarktpolitik: Hier werden die Faktoren analysiert, die den Trend zur Selbständigkeit beeinflussen. Es werden sowohl wirtschaftliche Faktoren wie die Entwicklung des Dienstleistungssektors und Outsourcing als auch soziologische Aspekte wie der Imagewandel der Selbständigkeit und die Flexibilität dieser Beschäftigungsform beleuchtet. Die Kapitel verdeutlicht die Rolle der staatlichen Förderung in diesem Zusammenhang.
4. Der Existenzgründungszuschuss: Dieses Kapitel beschreibt detailliert den Existenzgründungszuschuss, seine gesetzlichen Regelungen, seine steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Konsequenzen und die Vorteile, die er Gründern bietet. Es analysiert auch die Unterschiede zu den ursprünglichen Plänen der Hartz-Kommission und die Änderungen, die im Laufe der Zeit vorgenommen wurden. Es bildet das Kernstück der Arbeit, indem es die Funktionsweise des Förderprogramms erläutert.
5. Selbständigkeit und Existenzgründungszuschuss im Vergleich mit anderen Einkommensarten: Dieses Kapitel vergleicht den Existenzgründungszuschuss mit anderen Einkommensformen wie Arbeitslosengeld, regulärer Beschäftigung und Schwarzarbeit. Es analysiert die Vor- und Nachteile jeder Option und beleuchtet die Attraktivität von Schwarzarbeit im Vergleich zur Selbständigkeit, insbesondere für Niedriglohnsegmente. Der Vergleich hebt die komplexen Entscheidungsfaktoren für Arbeitslose hervor.
6. Auswirkungen von Existenzgründungen: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen von Existenzgründungen auf den Arbeitsmarkt. Es analysiert die Frage, ob durch Existenzgründungen tatsächlich neue Arbeitsplätze geschaffen werden oder ob lediglich eine Substitution stattfindet. Weitere Themen sind die Überlebensfähigkeit von kleinen Unternehmen und die Rolle von Existenzgründungen im Niedriglohnbereich. Der Fokus liegt auf der empirischen Analyse der Beschäftigungseffekte.
7. Existenzgründungszuschuss: Erwartungen, Erfahrungen und weitere Entwicklung: Das Kapitel fasst die Erfahrungen mit dem Existenzgründungszuschuss zusammen, bewertet dessen bisherige Wirksamkeit und diskutiert mögliche zukünftige Entwicklungen und Anpassungen des Förderprogramms. Es beinhaltet eine Analyse der Bewilligungszahlen und beleuchtet die Rolle weiterer wirtschaftspolitischer Maßnahmen, die Selbständigkeit fördern.
Schlüsselwörter
Existenzgründungszuschuss, Selbständigkeit, Arbeitslosigkeit, Arbeitsmarktpolitik, Beschäftigung, Schwarzarbeit, kleine Unternehmen, Förderprogramme, Wirtschaftspolitik, Hartz IV.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Existenzgründungszuschuss
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Einfluss des Existenzgründungszuschusses auf den deutschen Arbeitsmarkt. Sie untersucht die Wirksamkeit dieser Fördermaßnahme zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Schaffung neuer Arbeitsplätze.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Aspekte des Existenzgründungszuschusses, darunter die gesetzlichen Regelungen, die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Konsequenzen, die Vorteile für Gründer, einen Vergleich mit alternativen Einkommensquellen (Arbeitslosengeld, Schwarzarbeit), die Auswirkungen von Existenzgründungen auf die Beschäftigung und die Langzeitüberlebensfähigkeit geförderter Unternehmen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Wirksamkeit des Existenzgründungszuschusses bei der Arbeitslosenbekämpfung zu bewerten, ihn mit anderen Einkommensquellen zu vergleichen, die Auswirkungen von Existenzgründungen auf die Beschäftigung zu analysieren und seine Rolle als Instrument der Arbeitsmarktpolitik einzuschätzen. Ein weiterer Fokus liegt auf der Langzeitüberlebensfähigkeit von Unternehmen nach Auslaufen der Förderung.
Welche Themenschwerpunkte werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Wirksamkeit des Existenzgründungszuschusses bei der Arbeitslosenbekämpfung, vergleicht ihn mit anderen Einkommensquellen (Arbeitslosengeld, reguläre Beschäftigung, Schwarzarbeit), analysiert die Auswirkungen von Existenzgründungen auf die Beschäftigung und bewertet den Zuschuss als Instrument der Arbeitsmarktpolitik. Die Langzeitüberlebensfähigkeit geförderter Unternehmen wird ebenfalls analysiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in acht Kapitel gegliedert: Einleitung, Anlass zu Reformen, Selbständigkeit als Ziel der Arbeitsmarktpolitik, Der Existenzgründungszuschuss, Selbständigkeit und Existenzgründungszuschuss im Vergleich mit anderen Einkommensarten, Auswirkungen von Existenzgründungen, Existenzgründungszuschuss: Erwartungen, Erfahrungen und weitere Entwicklung und Resümee. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas.
Welche Kapitel geben detaillierte Informationen zum Existenzgründungszuschuss?
Kapitel 4 ("Der Existenzgründungszuschuss") beschreibt detailliert die gesetzlichen Regelungen, steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Konsequenzen und Vorteile des Zuschusses. Kapitel 5 ("Selbständigkeit und Existenzgründungszuschuss im Vergleich mit anderen Einkommensarten") vergleicht den Zuschuss mit anderen Einkommensformen und beleuchtet die Attraktivität von Schwarzarbeit im Vergleich.
Wie werden die Auswirkungen von Existenzgründungen bewertet?
Kapitel 6 ("Auswirkungen von Existenzgründungen") untersucht die Auswirkungen von Existenzgründungen auf den Arbeitsmarkt, analysiert die Schaffung neuer Arbeitsplätze im Vergleich zu Substitutionseffekten, die Überlebensfähigkeit kleiner Unternehmen und die Rolle von Existenzgründungen im Niedriglohnbereich.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Resümee (Kapitel 8) fasst die Ergebnisse zusammen und bewertet die Wirksamkeit des Existenzgründungszuschusses. Es berücksichtigt dabei auch die Erfahrungen und mögliche zukünftige Entwicklungen des Förderprogramms.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Existenzgründungszuschuss, Selbständigkeit, Arbeitslosigkeit, Arbeitsmarktpolitik, Beschäftigung, Schwarzarbeit, kleine Unternehmen, Förderprogramme, Wirtschaftspolitik, Hartz IV.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik und Wirtschaftsförderung befassen, sowie für politische Entscheidungsträger, die an der Gestaltung von Förderprogrammen beteiligt sind. Auch für Existenzgründer und Personen, die sich für die Themen Arbeitslosigkeit und Selbständigkeit interessieren, kann diese Arbeit aufschlussreich sein.
- Quote paper
- Christian Obitz (Author), 2003, Ich-AG und Existenzgründungszuschuss - ein neuer Weg zu mehr Beschäftigung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22538