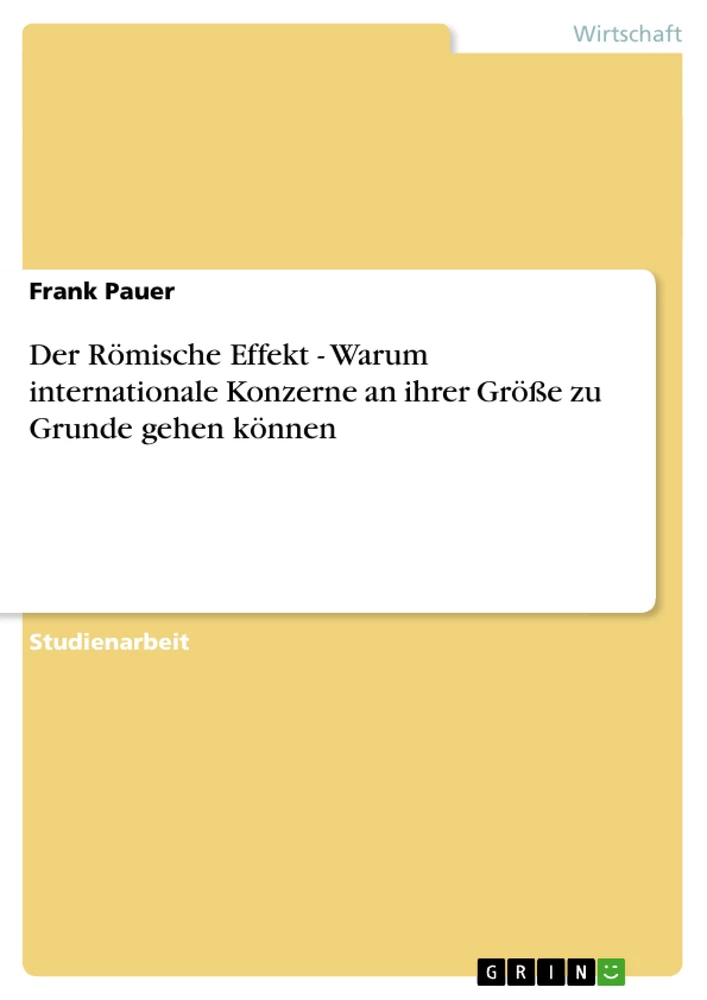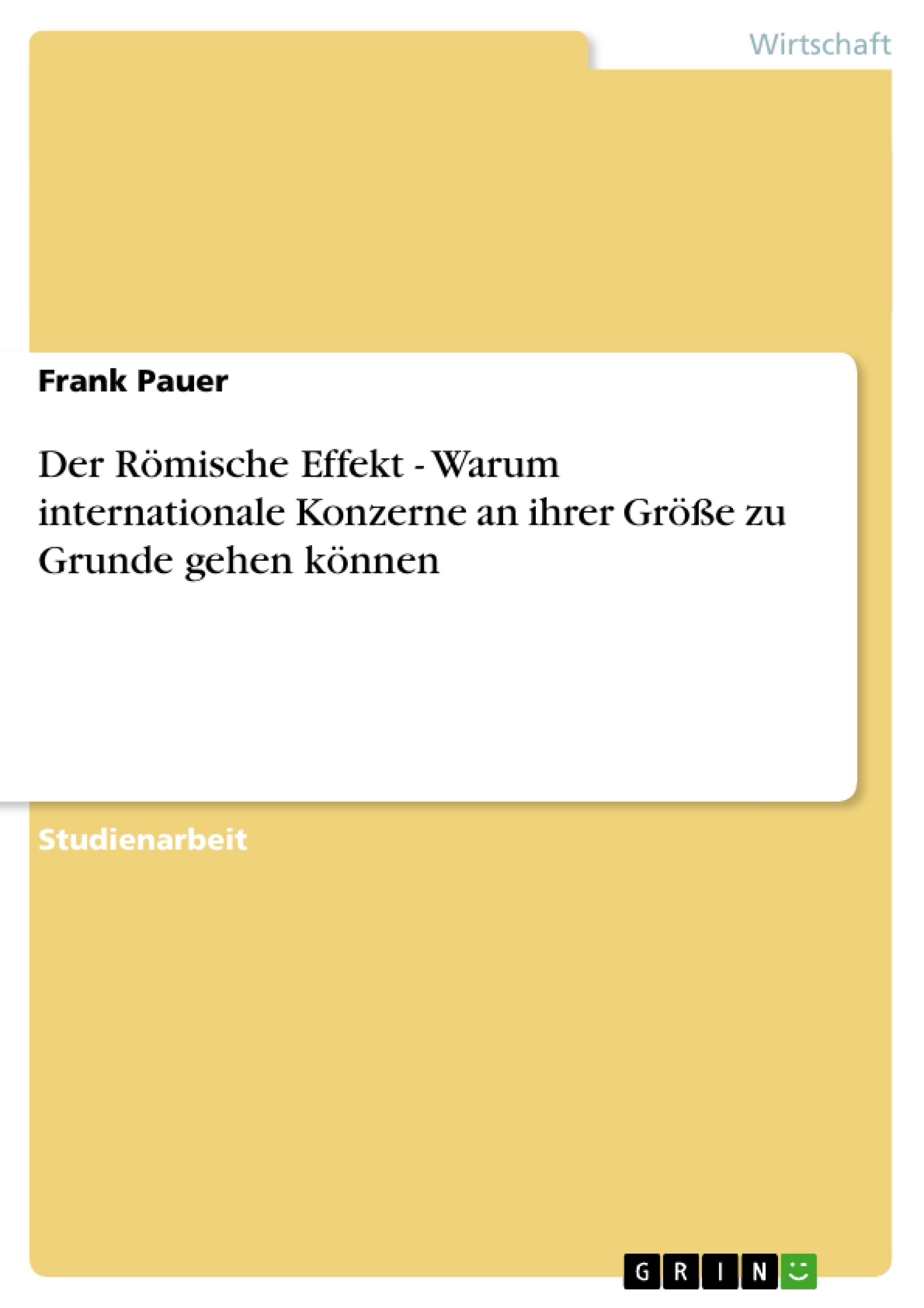Die Größe eines Unternehmens wird heutzutage vielfach gleichgesetzt mit seinem
Erfolg. Gerade zu Beginn des Börsenbooms um 1999 vernachlässigten
Kapitalanleger und Analysten die altbewährten Erfolgskennzahlen wie Kapital- und
Umsatzrendite oder Kurs-Gewinn-Verhältnis (ein Grund dafür mag gewesen sein,
dass viele der hochgelobten Unternehmen überhaupt keine Gewinne
erwirtschafteten). Ein Großteil der Anleger verteilte sein Geld nach dem Prinzip
„Zukunftshoffnung“. Nicht mehr die aktuelle Situation eines Unternehmens sondern
nur noch sein Zukunftspotential spielten bei der Auswahl einer geeigneten
Kapitalanlage eine Rolle.1 Die aufgrund ihres Zukunftspotentials positiv bewerteten
Unternehmen lassen sich dabei in zwei große Gruppen einteilen:
1. Die sogenannten „dot-com Unternehmen“, denen aufgrund ihrer technischen
Innovationen (zum Beispiel Biotechnologie) oder Geschäftstätigkeit im Internet
(zum Beispiel Internet-Suchmaschinen) hohe Wachstumsraten und Umsätze
in der Zukunft a ttestiert wurden
2. Traditionelle Unternehmen der sogenannten „old economy“, deren Ziel es war,
durch eine expansive Fusionspolitik an marktbeherrschender Größe zu
gewinnen
Gehörte man in Zeiten des Börsenbooms zu einer dieser Gruppen, war es recht
wahrscheinlich, dass der Börsenkurs in teilweise rational nicht mehr zu
rechtfertigende Höhen schnellte.
Nachdem der überhitzte Börsenmarkt 2001 zusammenbrach, erkannte man, dass ein
„.com“ als Namenszusatz noch lange nicht ausreicht, um Gewinne zu generieren
oder einen nachhaltigen Unternehmenswert zu schaffen. Anleger und Analysten
erkannten, dass es eines erfolgreichen Geschäftsmodells bedurfte und dass die
altbewährten Kennzahlen auch auf diese neue Form der Unternehmen anzuwenden sind um das angelegte Kapital nicht zu verlieren. Seitdem ist ein „.com“ eher ein
Nach- als ein Vorteil auf dem Börsenmarkt.
Anders die aggressiv wachsenden Unternehmen der „old economy“, deren
Börsenkurse während des Booms aufgrund des vermeintlichen Zukunftspotentials
ihrer angestrebten Größe ebenfalls in die Höhe schnellten. Obwohl auch diese Kurse
nach dem Platzen der Börsenblase größtenteils haltlos in die Tiefe stürzten und
Milliarden Euro Anlegerkapital vernichteten, wird das Streben nach Größe auf dem
Aktienmarkt immer noch positiv bewertet. Regelmäßig werden Akquisitionen großer
Unternehmen mit einem Anstieg des Aktienkurses belohnt. [...]
1 Vgl. T. Copeland u.a. (2000), S. 7f.
Inhaltsverzeichnis
- Unternehmensgröße im aktuellen Kontext.
- Das Römische Reich
- Der Aufstieg und Untergang des Römischen Reiches
- Gründe für den Untergang des Römischen Reiches
- Unternehmensrisiko „Größe“
- Parallelen zwischen dem Untergang des Römischen Reiches und aggressiver Unternehmensexpansion
- Der „Römische Effekt“ am Beispiel der Motorola Inc.
- Die Entwicklung der Motorola Inc zu einem internationalen Konzern.
- Die Auswirkungen des „Römischen Effektes“.
- Problemerkennung und Maßnahmen gegen den „Römischen Effekt“
- Anwendbarkeit des „Römischen Effektes“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text untersucht die Gefahren von übermäßigem Wachstum und expansiver Unternehmenspolitik am Beispiel des Römischen Reiches. Es wird untersucht, wie die Expansion des Reiches zu seiner schlussendlichen Instabilität und seinem Untergang führte.
- Die Parallelen zwischen dem Untergang des Römischen Reiches und aggressiver Unternehmensexpansion
- Der „Römische Effekt“ und seine Auswirkungen auf Unternehmen
- Die Bedeutung von Risikomanagement im Kontext von Unternehmenswachstum
- Die Folgen von zu großer Größe und Komplexität für die Organisation und Verwaltung eines Unternehmens
- Die Herausforderungen der Entscheidungsfindung in großen, komplexen Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Unternehmensgröße im aktuellen Kontext und stellt die Problematik von übermäßigem Wachstum in den Vordergrund. Im zweiten Kapitel wird das Römische Reich als Beispiel für die Gefahren von übermäßiger Expansion herangezogen. Der Aufstieg und Untergang des Reiches werden beleuchtet und die Ursachen für seinen Untergang werden analysiert. Das dritte Kapitel widmet sich dem „Römischen Effekt“ und zeigt, wie dieser sich auf Unternehmen auswirken kann. Das Beispiel der Motorola Inc. wird herangezogen, um die negativen Auswirkungen von übermäßigem Wachstum zu verdeutlichen. Abschließend wird die Anwendbarkeit des „Römischen Effektes“ auf Unternehmen in verschiedenen Branchen diskutiert.
Schlüsselwörter
Unternehmensgröße, Expansion, Römisches Reich, Untergang, „Römischer Effekt“, Motorola Inc., Risikomanagement, Komplexität, Entscheidungsfindung, Unternehmensstruktur, Management
Häufig gestellte Fragen
Was beschreibt der "Römische Effekt" bei Unternehmen?
Der Römische Effekt beschreibt das Phänomen, dass internationale Konzerne durch übermäßige Expansion und Größe an Instabilität und Komplexität scheitern können, ähnlich wie das Römische Reich.
Welche Parallelen gibt es zum Untergang des Römischen Reiches?
Wie das Römische Reich können auch Unternehmen durch zu aggressive Expansion ihre Verwaltungsstrukturen überfordern und die Kontrolle über weit entfernte "Provinzen" oder Geschäftsbereiche verlieren.
Warum wird Größe oft fälschlicherweise mit Erfolg gleichgesetzt?
Besonders während des Börsenbooms wurde Zukunftspotenzial über aktuelle Rentabilität gestellt, was dazu führte, dass rein expansive Fusionspolitik von Anlegern belohnt wurde.
Wie wirkte sich der Römische Effekt auf Motorola Inc. aus?
Motorola dient als Beispiel für einen Konzern, dessen Größe zu Problemen in der Entscheidungsfindung und Organisation führte, was spezifische Gegenmaßnahmen erforderte.
Warum ist Risikomanagement bei Unternehmenswachstum so wichtig?
Ohne effektives Management der Komplexität führt Wachstum nicht zu Wertschöpfung, sondern zur Vernichtung von Anlegerkapital durch ineffiziente Strukturen.
- Arbeit zitieren
- Frank Pauer (Autor:in), 2004, Der Römische Effekt - Warum internationale Konzerne an ihrer Größe zu Grunde gehen können, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22580