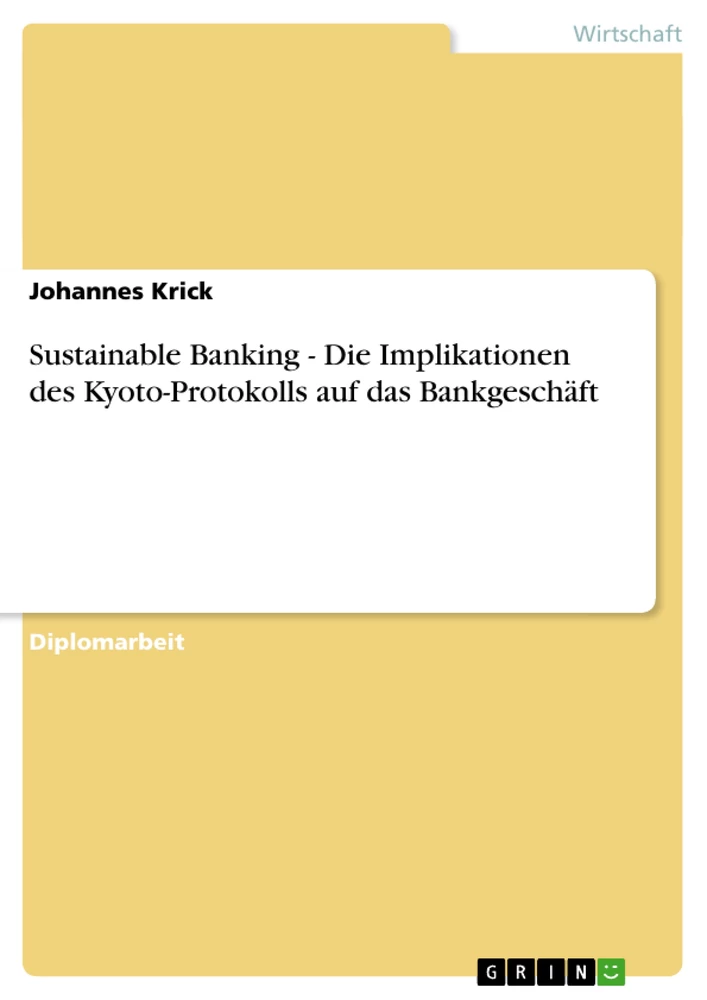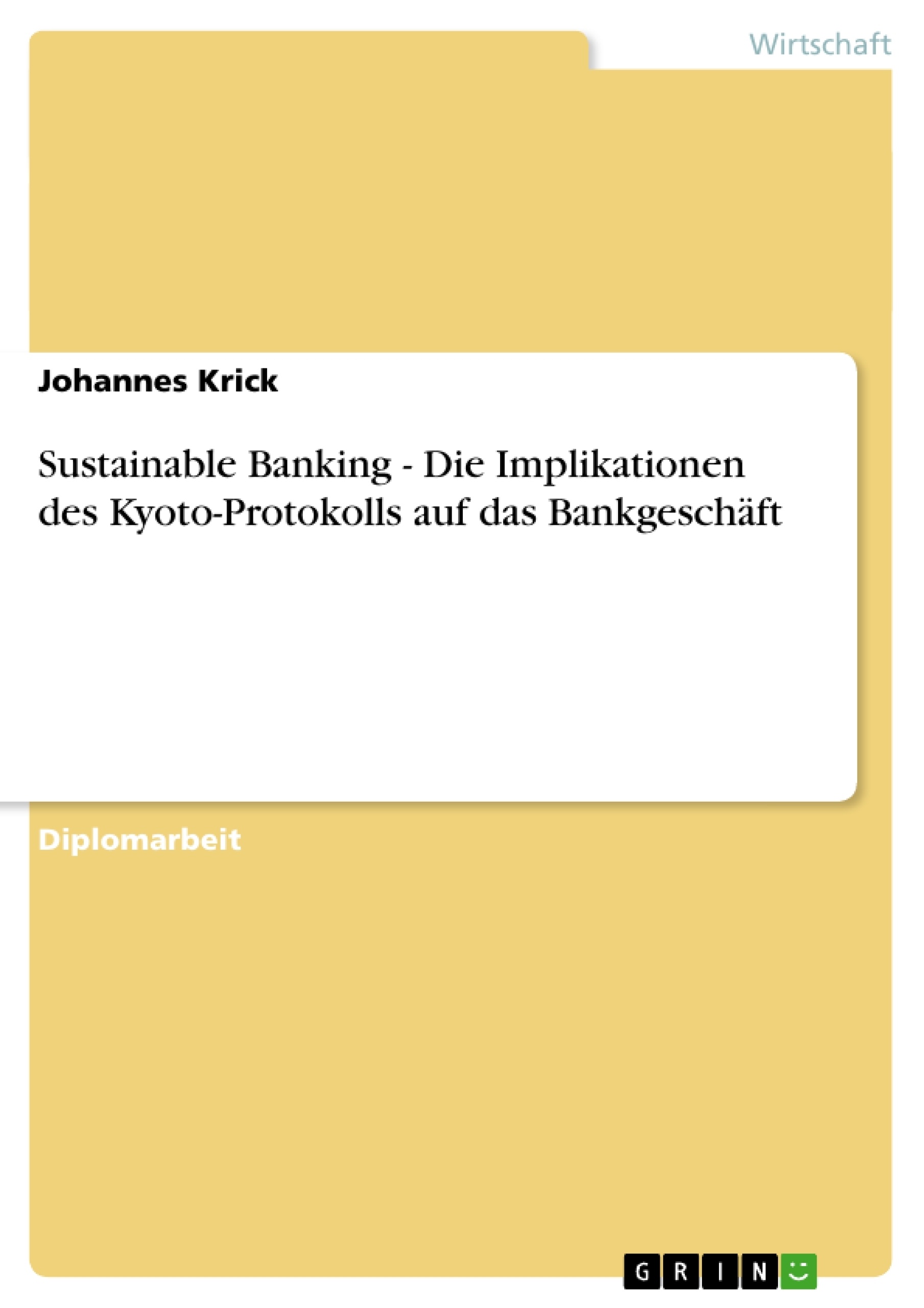Im Jahr 2002 waren dreißig Jahre vergangen seit der „Club of Rome“ die Studie „Limits to Growth“ („Die Grenzen des Wachstums“) veröffentlichte, die als „Urstudie“ zur nachhaltigen Entwicklung gilt. Durch sie wurde erstmals das Bewusstsein in der breiten Öffentlichkeit über die Endlichkeit der natürlichen Ressourcen geweckt. Die Studie besagt, dass bis spätestens zum Jahr 2100 alle nichterneuerbaren Ressourcen der Erde aufgebraucht sein werden und das Wachstum an seine Grenzen stoßen wird, wenn nicht ein Umdenken im Umgang mit der Natur erfolgt.
Die Erkenntnis, dass Ökonomie und Ökologie untrennbar miteinander verbunden sind, ist unbestreitbar. Jede ökonomische Tätigkeit von der Produktion von Waren über Dienstleistungen bis hin zum Konsum impliziert eine Nutzung der Umwelt. Beispielsweise werden Rohstoffe für die Produktion aus der Natur entnommen, Flächen dienen als Standort wirtschaftlicher Aktivitäten und aus ökonomischer Tätigkeit entstehende Rest- und Schadstoffe werden an die Natur abgegeben. Entsprechend dieser Erkenntnis erklärten die Industrieländer beim Umweltgipfel von Rio de Janeiro im Jahr 1992 eine nachhaltige Entwicklung zu ihrem Leitbild und verpflichteten sich eine besondere Verantwortung für den Umweltschutz zu übernehmen.
Da ein Unternehmen kein isoliertes Objekt darstellt, sondern integrierter Bestandteil der Gesellschaft ist und unter Beobachtung der Öffentlichkeit steht, kann es sich gesellschaftspolitischen Entwicklungen nicht entziehen und muss sich den Herausforderungen einer veränderten unternehmerischen Umwelt stellen.
Eine solche Herausforderung stellt der globale Klimaschutz dar, welcher als eines der wichtigsten und drängendsten Probleme des 21 Jahrhunderts gilt. Der Weltgipfel von Johannisburg im Sommer 2002 sowie der einstimmige Beschluss der EU-Umweltminister über die Einführung eines EU-weiten Handels mit Treibhausgasemissionen vom 09. Dezember 2002 rücken den Klimaschutz aktuell wieder in das Interesse der Öffentlichkeit. Der EU-weite Emissionshandel ist eine Maßnahme im Rahmen des Europäischen Klimaschutzprogramms zur Erreichung der durch das Kyoto-Protokoll eingegangenen Klimaschutzverpflichtungen. Auch das KP selbst sieht einen internationalen Handel mit Emissionsrechten neben zwei weiteren Mechanismen zur kosteneffizienten Erreichung des Klimaschutzziels vor. Diese Mechanismen eröffnen unternehmerische Potentiale, bergen Chancen und Risiken.
Inhaltsverzeichnis
-
- DREIBIG JAHRE „SUSTAINABLE DEVELOPMENT“
- KLIMASCHUTZ – HANDLUNGSFELD EINER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG
-
- DER KLIMAWANDEL ALS ENTSTEHUNGSGRUND DES KYOTO-PROTOKOLLS
- DIE FLEXIBLEN MECHANISMEN DES KYOTO-PROTOKOLLS
- INTERNATIONAL EMISSION TRADING
- JOINT IMPLEMENTATION UND CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM
- Joint Implementation
- Clean Development Mechanism
- Zusammenfassung
- KLIMAPOLITIK, AUSGELÖST DURCH DAS KYOTO-PROTOKOLL
-
- VERFLECHTUNGEN VON ÖKONOMIE UND ÖKOLOGIE ALS GRUNDLAGE FÜR DIE IMPLIKATIONEN VON BANKEN UND UMWELT
- DER EINFLUSS DER BANKEN AUF DIE UMWELT
- „EARLY-MOVER“ ODER „WAIT-UND-SEE” ALS MÖGLICHE STRATEGIEN DER BANKEN IM KLIMASCHUTZ
-
- DER HANDEL MIT EMISSIONSRECHTEN
- DEFINITION UND ARTEN VON UMWELTZERTIFIKATEN
- ERTRAGSPOTENTIALE UND AUFGABEN DER BANKEN
- PROJEKTFINANZIERUNG IM RAHMEN VON JI UND CDM
- BESONDERHEITEN DES INSTRUMENTS PROJEKTFINANZIERUNG
- AUFGABEN DER BANKEN IM RAHMEN EINER JI/CDM- PROJEKTFINANZIERUNG
- Prüfung der Rahmenbedingungen
- Prüfung der Wirtschaftlichkeit des Projekts
- Differenz der CO2-Vermeidungskosten zwischen Industrie- und Entwicklungsländern als Grundlage für die Wirtschaftlichkeit des Projekts
- Bestimmung der Emissionsvermeidungskosten
- Identifikation der speziellen Risiken im Rahmen von JI/CDM- Projektfinanzierungen
- Maßnahmen zum Management der Risiken
- ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT
- ASSET MANAGEMENT (CARBON FONDS)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit den Implikationen des Kyoto-Protokolls auf das Bankgeschäft. Sie analysiert die Auswirkungen des Protokolls auf die Bankenbranche und untersucht, welche neuen Geschäftsfelder sich durch die flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls für Banken eröffnen.
- Die Bedeutung des Kyoto-Protokolls als Rahmenbedingung für nachhaltige Entwicklung
- Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wirtschaft und die Rolle der Banken im Klimaschutz
- Die flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls als Grundlage neuer Geschäftsfelder für Banken
- Die Bedeutung von Projektfinanzierung und Emissionshandel für Banken
- Risiken und Chancen der Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in das Bankgeschäft
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel liefert eine Einführung in den Begriff der nachhaltigen Entwicklung und beleuchtet die Bedeutung des Klimaschutzes als Handlungsfeld.
- Das zweite Kapitel fokussiert auf das Kyoto-Protokoll als Ausgangspunkt und Rahmenbedingung der Untersuchung. Es behandelt den Klimawandel als Entstehungsgrund des Protokolls sowie die flexiblen Mechanismen des Protokolls wie International Emission Trading, Joint Implementation und den Clean Development Mechanism.
- Das dritte Kapitel untersucht die Verflechtungen von Ökonomie und Ökologie und analysiert den Einfluss der Banken auf die Umwelt. Zudem werden mögliche Strategien der Banken im Klimaschutz diskutiert.
- Das vierte Kapitel befasst sich mit den flexiblen Kyoto-Mechanismen als Grundlage neuer Geschäftsfelder für Banken. Es behandelt den Handel mit Emissionsrechten sowie die Projektfinanzierung im Rahmen von Joint Implementation und dem Clean Development Mechanism.
Schlüsselwörter
Sustainable Banking, Kyoto-Protokoll, Klimaschutz, Emissionshandel, Projektfinanzierung, Clean Development Mechanism, Joint Implementation, Umweltzertifikate, Carbon Fonds, Nachhaltige Entwicklung, Banken und Umwelt
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Sustainable Banking"?
Sustainable Banking bezeichnet die Integration von ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsaspekten in das Kerngeschäft von Banken, wie Kreditvergabe und Investment.
Welche Auswirkungen hat das Kyoto-Protokoll auf Banken?
Es schafft neue Geschäftsfelder, insbesondere im Handel mit Emissionsrechten und in der Projektfinanzierung von Klimaschutzmaßnahmen (JI und CDM).
Was sind Joint Implementation (JI) und Clean Development Mechanism (CDM)?
Dies sind flexible Mechanismen des Kyoto-Protokolls, die es Unternehmen ermöglichen, durch Klimaprojekte im Ausland Emissionsgutschriften zu erwerben.
Welche Rolle spielen Banken beim Emissionshandel?
Banken agieren als Intermediäre, bieten Handelsplattformen an, verwalten Zertifikate-Portfolios und entwickeln Finanzprodukte wie Carbon Fonds.
Was sind die Risiken bei JI/CDM-Projektfinanzierungen?
Zu den Risiken gehören politische Instabilität in den Zielländern, technische Ausfälle der Anlagen und die Unsicherheit über die tatsächliche Anerkennung der erzielten Emissionsminderungen.
- Arbeit zitieren
- Johannes Krick (Autor:in), 2003, Sustainable Banking - Die Implikationen des Kyoto-Protokolls auf das Bankgeschäft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22616