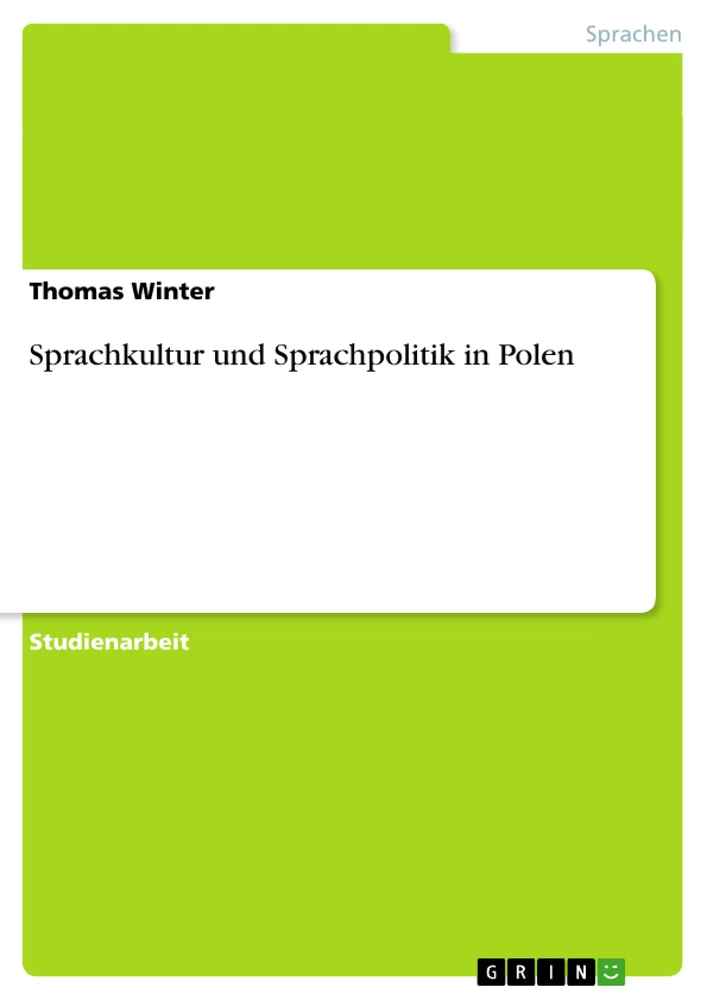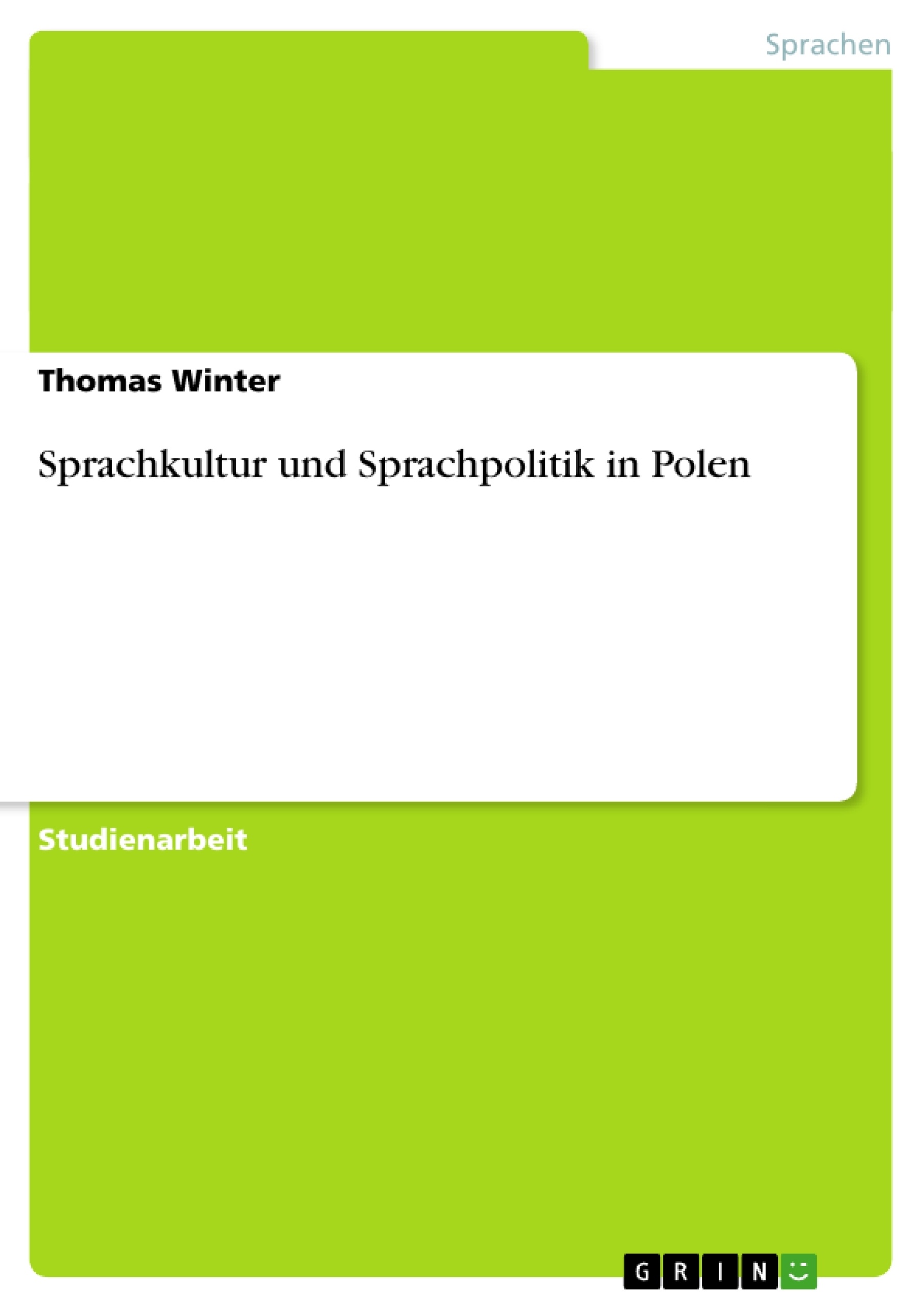Fernab von Nationalismus und Deutsch- oder sonstiger „Tümelei“ wird von Sprachwissenschaftlern, Journalisten und schnell wachsenden „Sprachvereinen“ in den letzten Jahren eine zunehmende Gefährdung der sprachlichen Vielfalt beklagt. Besonders in den hochentwickelten Industriestaaten scheinen die zunehmende Vernetzung und die steigende Mobilität der Bevölkerung, die unterschiedliche Bewertung von Dialekten und Standardsprachen sowie der wachsende Einfluß des Englischen als Lingua franca dazu zu führen, dass sprachliche Unterschiede immer weiter nivelliert werden. Während schon lange in verschiedenen Ländern Warnungen zu hören sind, dass die dialektale Vielfalt zugunsten der jeweiligen übergeordneten Standardsprache schwindet, wird mittlerweile auch deren Bestand von bestimmten Kreisen nicht mehr als völlig gesichert betrachtet.
Insbesondere der stetig wachsende Einfluß der englischen Sprache ruft immer mehr Widerspruch hervor. Denn neben der Funktion als „Brücke“ zwischen Sprechern verschiedener Sprachen dringt das Englische über Mischformen („Denglisch“, „Franglais“, „Spanglish“) und zunehmend auch in Reinform in die Kommunikation zwischen Sprechern ein, die eigentlich dieselbe (andere) Sprache sprechen.
Auch in Polen wird über den Zustand der Sprache und die Notwendigkeit zum Schutz derselben diskutiert. Gegenstand dieser Arbeit ist nicht nur der Einfluß von Fremdsprachen auf das Polnische, sondern auch das neue Verhältnis von Standard und Dialekten in Folge des Zweiten Weltkrieges, die Sonderfälle "Kaschubisch" und "Schlesisch" sowie politische Bestrebungen zum Schutze der polnischen Sprache.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Zum Verhältnis von Dialekten und Standardsprache
- 1.1. Der Stadt-Land-Gegensatz
- 1.2. Die „Neuen Mischdialekte“
- 2. Die Sonderfälle „Schlesisch“ und „Kaschubisch“
- 2.1. Das Schlesische
- 2.2. Das Kaschubische
- 3. Die Entwicklung des Hochpolnischen in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts
- 4. Das öffentliche Interesse an der Sprache
- 5. Sprachpolitik in Polen
- 1. Zum Verhältnis von Dialekten und Standardsprache
- III. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Sprachkultur und Sprachpolitik in Polen, mit besonderem Fokus auf das Verhältnis zwischen polnischen Dialekten und der Standardsprache. Die Analyse beleuchtet die Entwicklungen im 20. Jahrhundert und die Auswirkungen gesellschaftlicher Veränderungen auf die sprachliche Vielfalt.
- Das Verhältnis zwischen Dialekten und Standardpolnisch
- Die Entwicklung der Standardsprache im 20. Jahrhundert
- Die „Neuen Mischdialekte“ in den ehemals deutschen Gebieten
- Der Status von Schlesisch und Kaschubisch
- Sprachpolitik und öffentliches Interesse an der Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor: die Gefährdung sprachlicher Vielfalt in hochentwickelten Industrienationen, insbesondere durch die Nivellierung sprachlicher Unterschiede und den wachsenden Einfluss des Englischen. Der Fokus liegt auf Polen, wo die Sprachkultur, die Sprachpolitik und das Verhältnis zwischen Standardsprache und Dialekten untersucht werden.
II. Hauptteil: Der Hauptteil untersucht das Verhältnis von Dialekten und Standardsprache in Polen. Kapitel 1.1 beleuchtet den traditionellen Stadt-Land-Gegensatz, wobei vor dem Zweiten Weltkrieg in Städten Standardpolnisch und auf dem Land Dialekte gesprochen wurden. Nach dem Krieg führte der Bevölkerungszuwachs zu einer „Bilingualität“ der Landbevölkerung und einem Einfluss der Dialekte auf das städtische Standardpolnisch. Ein "Substandard", eine Mischung aus Standardpolnisch und dialektalen Elementen, entstand sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum. Kapitel 1.2 behandelt die "Neuen Mischdialekte" in den ehemals deutschen Gebieten Polens, die durch den Bevölkerungsaustausch nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind und bisher kaum wissenschaftlich untersucht wurden. Kapitel 2 diskutiert den kontroversen Status von Schlesisch und Kaschubisch als eigenständige Sprachen oder polnische Dialekte, wobei Kriterien der Prager Schule zur Beurteilung herangezogen werden.
Schlüsselwörter
Sprachkultur, Sprachpolitik, Polen, Dialekte, Standardsprache, Hochpolnisch, Schlesisch, Kaschubisch, Sprachliche Vielfalt, „Neuen Mischdialekte“, Stadt-Land-Gegensatz, Soziolinguistik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sprachkultur und Sprachpolitik in Polen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Sprachkultur und Sprachpolitik in Polen, insbesondere das Verhältnis zwischen polnischen Dialekten und der Standardsprache. Der Fokus liegt auf den Entwicklungen im 20. Jahrhundert und den Auswirkungen gesellschaftlicher Veränderungen auf die sprachliche Vielfalt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Das Verhältnis zwischen Dialekten und Standardpolnisch; die Entwicklung der Standardsprache im 20. Jahrhundert; die „Neuen Mischdialekte“ in den ehemals deutschen Gebieten; der Status von Schlesisch und Kaschubisch; Sprachpolitik und öffentliches Interesse an der Sprache.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. Der Hauptteil untersucht das Verhältnis von Dialekten und Standardsprache in Polen, inklusive der „Neuen Mischdialekte“ in den ehemals deutschen Gebieten und dem Status von Schlesisch und Kaschubisch. Die Einleitung stellt die Thematik und die Relevanz des Themas vor, der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen.
Was wird unter „Neuen Mischdialekten“ verstanden?
Die „Neuen Mischdialekte“ sind in den ehemals deutschen Gebieten Polens entstanden, infolge des Bevölkerungsaustausches nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie stellen eine Mischung aus Standardpolnisch und dialektalen Elementen dar und sind bisher kaum wissenschaftlich untersucht worden.
Welchen Status haben Schlesisch und Kaschubisch?
Der Status von Schlesisch und Kaschubisch als eigenständige Sprachen oder polnische Dialekte ist kontrovers. Die Arbeit diskutiert diesen Aspekt unter Heranziehung von Kriterien der Prager Schule.
Wie beschreibt die Arbeit den Stadt-Land-Gegensatz in Bezug auf die Sprache?
Vor dem Zweiten Weltkrieg wurde in Städten Standardpolnisch und auf dem Land vorwiegend Dialekte gesprochen. Nach dem Krieg führte der Bevölkerungszuwachs zu einer „Bilingualität“ der Landbevölkerung und einem Einfluss der Dialekte auf das städtische Standardpolnisch. Es entstand ein „Substandard“, eine Mischung aus Standardpolnisch und dialektalen Elementen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sprachkultur, Sprachpolitik, Polen, Dialekte, Standardsprache, Hochpolnisch, Schlesisch, Kaschubisch, Sprachliche Vielfalt, „Neuen Mischdialekte“, Stadt-Land-Gegensatz, Soziolinguistik.
- Quote paper
- Thomas Winter (Author), 2004, Sprachkultur und Sprachpolitik in Polen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22676