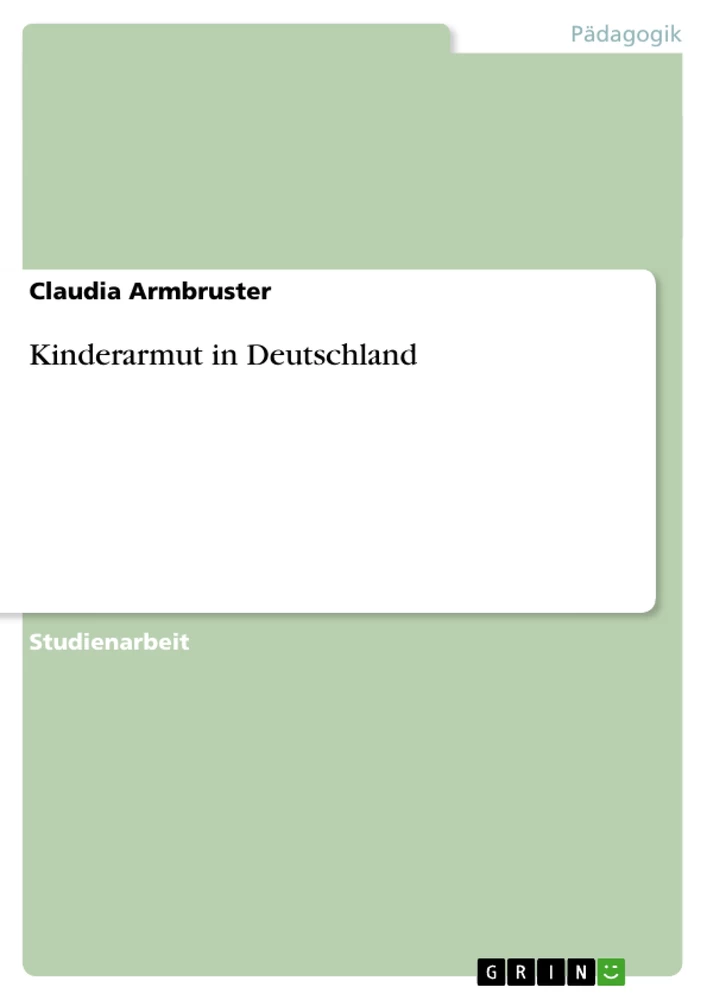Kinder- und Jugendarmut ist nicht nur ein Problem in den unterentwickelten Ländern
der Welt. In Deutschland stieg die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die in relativer
Armut leben, in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich an.
Die Gründe und Auswirkungen der Kinderarmut sind dabei sehr verschieden und
mehrdimensional. Ziel dieser Hausarbeit ist es zunächst die Begriffe Armut und
Kinderkosten zu definieren, um dann zu untersuchen, in welchem Ausmaß deutsche
Kinder von Armut betroffen sind und welche Gruppen besonders gefährdet sind, welche
Bedeutung die Mehrdimensionalität in der Kinderarmutsforschung hat und welche
Folgen aus der Armutssituation für die Entwicklung von Kindern resultieren.
Abschließend werden dann Empfehlungen und Forderungen zur Bekämpfung von
Kinderarmut aufgezeigt. „Armut ist kein individuelles, sondern ein gesellschaftliches Problem, das
sozialpolitisch gelöst werden muss und sozialpädagogisch begleitet werden kann.
Armut bedeutet vielmehr eine allgemeine Unterversorgung mit wichtigen Gütern als
Folge einer ungleichen Verteilung ökonomischer Ressourcen und gesellschaftlicher
Lebenslagen.“1
Unter dem Begriff Armut versteht man ganz allgemein eine „wirtschaftliche Situation,
in der es Einzelnen oder ganzen Bevölkerungsgruppen nicht möglich ist, sich ihren
Lebensbedarf (Existenzminimum) aus eigenen Kräften zu beschaffen.“2
Kinderarmut ist ein eigenes Phänomen, das sich von der Eltern- und Erwachsenenarmut
erheblich im Ausmaß und der Qualität unterscheidet, da Kinder besondere Bedürfnisse
und Handlungsziele haben.
Der Begriff der Armut wird in zwei Kategorien unterteilt: [...]
1 Kürner 1994, S.21
2 Der Brockhaus in einem Band 1998, S.53
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Definitionen der Begriffe Armut und Kinderkosten
2.1 Armut allgemein
2.1.1 Absolute und relative Armut
2.2. Kinderkosten
2.2.1 Kinderkostenrechnungen
3. Kinderarmut
3.1 Ausmaß und Auftreten von Kinderarmut
3.2 Mehrdimensionale Aspekte der Kinderarmut
3.3 Auswirkungen der Armut auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
4. Empfehlungen und Forderungen zur Bekämpfung der Kinderarmut
5. Schluss
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Kinder- und Jugendarmut ist nicht nur ein Problem in den unterentwickelten Ländern der Welt. In Deutschland stieg die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die in relativer Armut leben, in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich an.
Die Gründe und Auswirkungen der Kinderarmut sind dabei sehr verschieden und mehrdimensional. Ziel dieser Hausarbeit ist es zunächst die Begriffe Armut und Kinderkosten zu definieren, um dann zu untersuchen, in welchem Ausmaß deutsche Kinder von Armut betroffen sind und welche Gruppen besonders gefährdet sind, welche Bedeutung die Mehrdimensionalität in der Kinderarmutsforschung hat und welche Folgen aus der Armutssituation für die Entwicklung von Kindern resultieren.
Abschließend werden dann Empfehlungen und Forderungen zur Bekämpfung von Kinderarmut aufgezeigt.
2. Definitionen der Begriffe Armut und Kinderkosten
2.1 Armut allgemein
„Armut ist kein individuelles, sondern ein gesellschaftliches Problem, das sozialpolitisch gelöst werden muss und sozialpädagogisch begleitet werden kann. Armut bedeutet vielmehr eine allgemeine Unterversorgung mit wichtigen Gütern als Folge einer ungleichen Verteilung ökonomischer Ressourcen und gesellschaftlicher Lebenslagen.“[1]
Unter dem Begriff Armut versteht man ganz allgemein eine „wirtschaftliche Situation, in der es Einzelnen oder ganzen Bevölkerungsgruppen nicht möglich ist, sich ihren Lebensbedarf (Existenzminimum) aus eigenen Kräften zu beschaffen.“[2]
Kinderarmut ist ein eigenes Phänomen, das sich von der Eltern- und Erwachsenenarmut erheblich im Ausmaß und der Qualität unterscheidet, da Kinder besondere Bedürfnisse und Handlungsziele haben.
Der Begriff der Armut wird in zwei Kategorien unterteilt:
2.1.1 Absolute und relative Armut
Bei absoluter Armut handelt es sich um eine Mangelsituation. Den betroffenen Menschen fehlt es an den Grundvoraussetzungen zur Erhaltung der Gesundheit und der physischen Funktionsfähigkeit, wie es noch in den meisten Ländern der Dritten oder Vierten Welt der Fall ist. Dabei wird die physische Existenz des Menschen durch einen akuten Mangel an Nahrung, Kleidung oder Hygiene bedroht.[3]
In modernen, industriell entwickelten Gesellschaften, wie in der Bundesrepublik Deutschland, existiert normalerweise keine absolute sondern eine relative Armut.
Bei relativer Armut wird das soziokulturelle Existenzminimum deutlich unterschritten. Bei den betroffenen Menschen geht es nicht um das physische Überleben, sondern um die Frage eines menschenwürdigen Lebens. Die Armutsgrenze wird also durch ein soziokulturelles Existenzminimum markiert. Dabei sind Personen oder Gruppen wie Familien von relativer Armut betroffen, wenn sie einen Mangel an materiellen, kulturellen und sozialen Mitteln erleiden und damit von einer Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Staat, in dem sie leben, als annehmbares Minimum angesehen wird. In diesem Sinne ist Armut sowohl vom historischen Zeitabschnitt sowie der Gesellschaftsstruktur abhängig. Zudem wird sie durch gesellschaftliche und politische Meinungen bestimmt.[4]
2.2 Kinderkosten
Unter dem Begriff Kinderkosten sind alle Kosten zusammengefasst, die ein Kind verursacht. Zum einen sind damit die Kosten der Grundversorgung (Ernährung, Kleidung, etc.), der Betreuung, der Erziehung und der Bildung von Kindern gemeint, die zum Teil von den Eltern, zum Teil von der Allgemeinheit getragen werden.
Zum anderen gehören auch die Ausgaben für musische Bildung, sportliche Betätigung und gesundheitliche Vorsorge dazu.
Aber nicht nur die in Haushaltsrechnungen berücksichtigten Kosten, die Eltern für ihre Kinder leisten sind miteinzubeziehen., sondern auch, dass durch die Sorge für Kinder Erwerbs- und Einkommenschancen sowie trotz der Anrechnung von Erziehungsjahren in der Rentenversicherung die Altersversorgung gemindert werden.
Allerdings wird den Eltern auch ein Teil der Kinderkosten wieder durch Steuerfreibeträge, Kindergeld, Erziehungsgeld und kindbezogene Wohngeldzahlungen erstattet.
2.2.1 Kinderkostenrechnungen
Eine exakte Berechnung der Kinderkosten ist fast nicht möglich, da es keine allgemeingültigen Richtlinien gibt, die vorschreiben, welche Kostenfaktoren einbezogen werden sollen und wie ihr Wert einzustufen ist.[5]
„Um eine Vorstellung von diesen Kosten zu erhalten, kann man zum einen auf Bedarfsätze zurückgreifen, die de Zahlungen der Sozialhilfe zugrunde liegen“[6] oder Wirtschaftsrechnungen der Haushalte heranziehen.
Bei den Sozialhilfesätzen gibt es festgelegte Regelsätze, die allerdings je nach Alter der Kinder und Bundesland, in dem sie aufwachsen, variieren.
Die bei den Wirtschaftsrechnungen der Haushalte „ermittelten tatsächlichen Ausgaben pro Kind und Monat schwanken ebenfalls je nach Haushaltstyp, Haushaltsgröße und Einkommensschicht der Eltern sowie nach dem Alter des Kindes.“[7]
Zudem müssen auch regionale Unterschiede innerhalb der Länder sowie „familien- und entwicklungsphasenspezifische Schwankungen in den Ausgaben für Kinder“[8] berücksichtigt werden.
[...]
[1] Kürner 1994, S.21
[2] Der Brockhaus in einem Band 1998, S.53
[3] vgl. Giddens 1999, S.306
[4] vgl. Geißler: In: Informationen zur politischen Bildung Nr. 269/2000, S.24
[5] vgl. Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (im Folgenden BM Familie) 1998, S. 86
[6] ebd
[7] ebd
[8] ebd
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen absoluter und relativer Armut?
Absolute Armut bedroht die physische Existenz (Mangel an Nahrung, Kleidung), während relative Armut das Unterschreiten des soziokulturellen Existenzminimums einer Gesellschaft beschreibt.
Wie wird Kinderarmut in Deutschland definiert?
In Deutschland spricht man meist von relativer Armut, bei der Kinder von einer Lebensweise ausgeschlossen sind, die als annehmbares Minimum gilt.
Welche Kostenfaktoren zählen zu den "Kinderkosten"?
Dazu gehören die Grundversorgung (Ernährung, Kleidung), Betreuung, Erziehung, Bildung sowie Kosten für Sport, Kultur und Gesundheit.
Was sind die Folgen von Armut für die Entwicklung von Kindern?
Armut hat mehrdimensionale Auswirkungen auf die Gesundheit, die Bildungschancen und die soziale Teilhabe von Kindern und Jugendlichen.
Wie kann Kinderarmut bekämpft werden?
Die Arbeit empfiehlt sozialpolitische Lösungen zur Umverteilung ökonomischer Ressourcen sowie eine verstärkte sozialpädagogische Begleitung.
- Quote paper
- Claudia Armbruster (Author), 2003, Kinderarmut in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22690