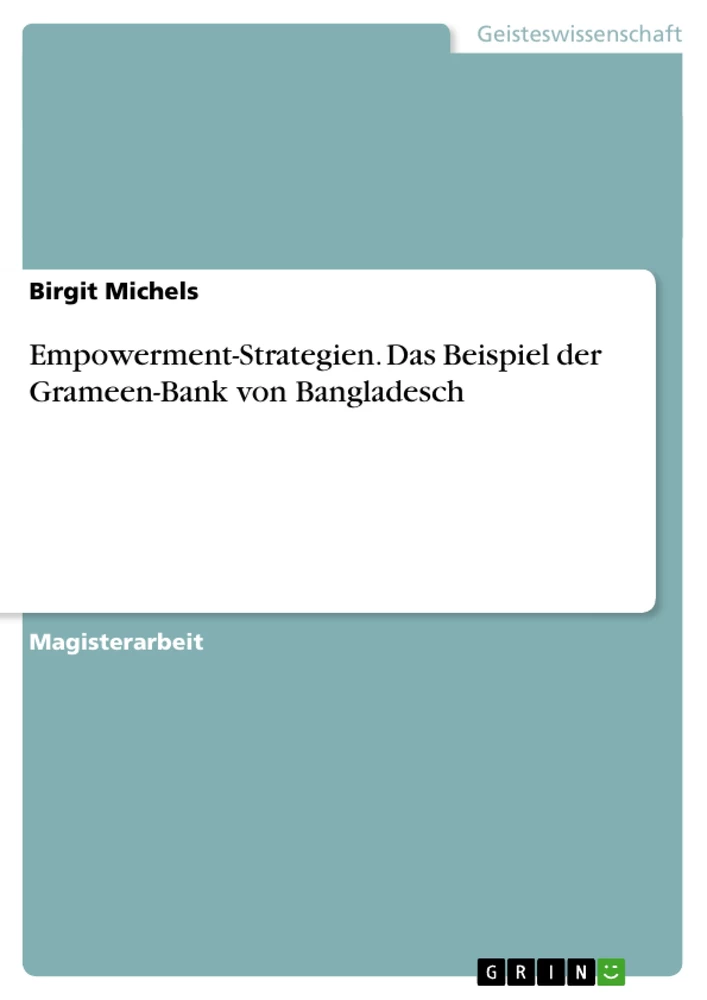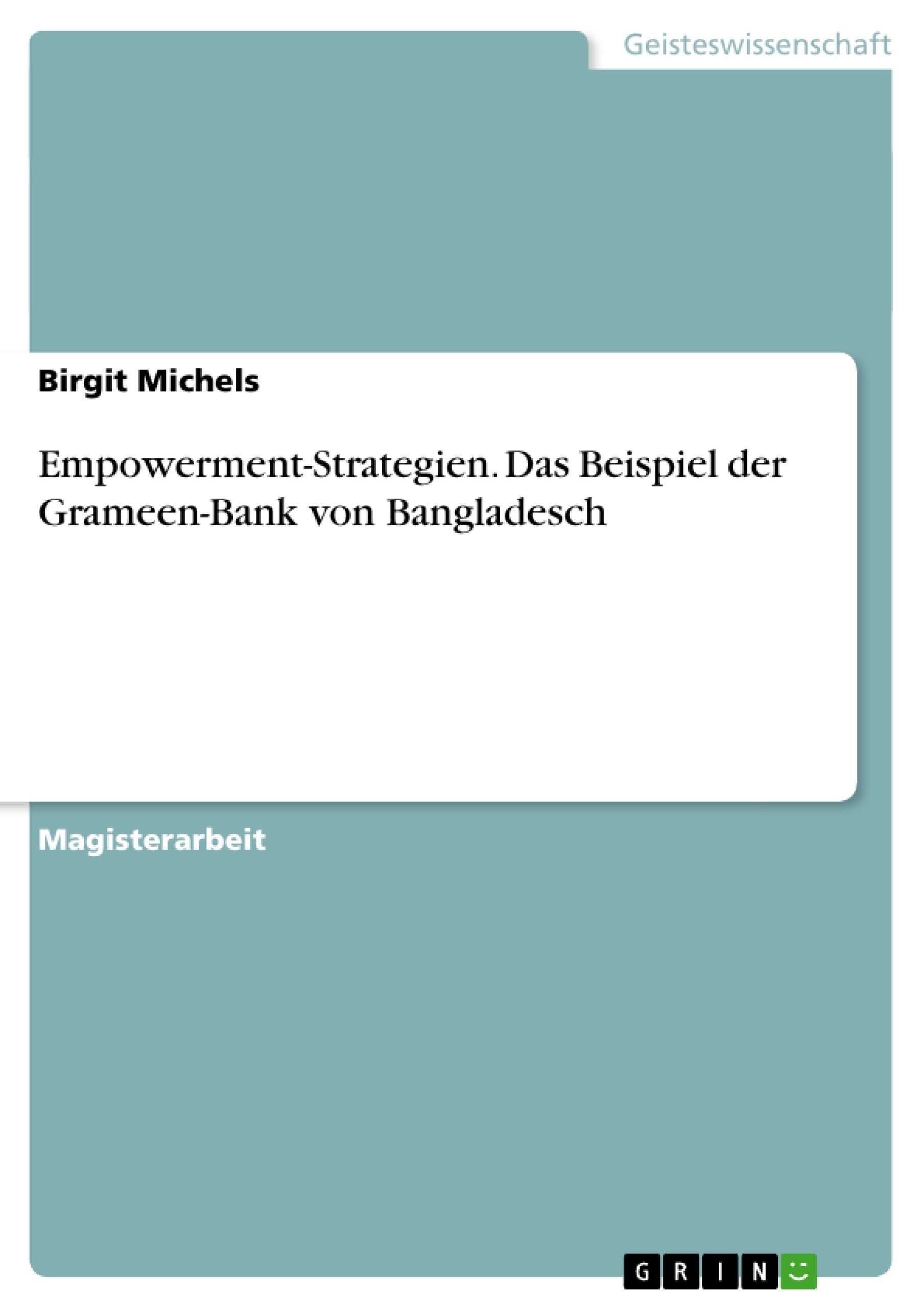Als eine der prominentesten Institutionen, die das Empowerment von Frauen als explizites Projektziel formuliert, gilt die Grameen-Bank (wörtl. übersetzt: Dorf-Bank) von Bangladesch. Das Konzept dieser Bank beruht auf der Erkenntnis, dass Kapitalmangel und die damit einhergehende Ressourcenknappheit zu den Hauptproblemen armer Menschen gehören, deren einziges Kapital ihre Arbeitskraft darstellt.
Mit der Bereitstellung dieses fehlenden Kapitals in Form eines ausgeklügelten Systems der Mikrokredit-Vergabe an Frauen unterhalb der Armutsgrenze will die Bank die Grundlage für eine aktive Selbsthilfe schaffen, auf welcher sich Empowerment, sowohl auf individueller, als auch auf struktureller
Ebene, herausbildet.
Ziel der vorliegenden Untersuchung ist, darzustellen, wie mit einer relativ kleinen, sehr begrenzten Maßnahme, nämlich der Mikrokredit-Vergabe an Frauen, im Entwicklungsland Bangladesch ein Empowerment-Mechanismus in Gang gesetzt wird. Die Darstellung des prozesshaften Charakters von Empowerment steht dabei im Mittelpunkt des Interesses, d.h. Frauen-Empowerment wird als das Ergebnis
einer komplexen, von vielen Faktoren abhängigen Wirkungskette betrachtet. Aus wechselnden Blickwinkeln wird analysiert, unter welchen sozio-kulturellen Prämissen und auf welchen einander zum Teil reziprok bedingenden Ebenen gesellschaftlichen Zusammenlebens dieser Prozess abläuft. Es ist ein Anliegen dieser Untersuchung, den Blick zu schärfen für die mit der Kreditallokation zusammenhängenden
Mechanismen des Wandels, und herauszufinden, wie die Grameen-Mitgliedschaft die Situation der Frauen direkt oder indirekt beeinflusst.
Zudem wird untersucht, ob aus dem Kreditprogramm der Grameen-Bank gesamtgesellschaftliche Effekte entstehen, und ob solche Effekte das Potential für eine langsame Umstrukturierung bestehender Herrschaftsverhältnisse in Bangladesch beinhalten. Eine Kernfrage lautet also: Inwieweit gehen von der Mikrokreditvergabe Impulse aus, die den Kreditnehmerinnen eine schrittweise Überwindung von
struktureller Unterdrückung und Fremdbestimmung ermöglichen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Thema und Abgrenzung
- 1.1. Ziel der Untersuchung
- 1.2. Aufbau und Inhalt der Untersuchung
- 2. Eine gender-sensible Betrachtung des Bedeutungsfeldes 'Empowerment'
- 2.1. Strukturelle Determinanten von Disempowerment
- 2.2. Zur Zentralität des Machtdiskurses im Empowerment-Ansatz
- 2.3. Das Idealmodell eines Empowerment-Prozesses
- 3. Untersuchung von Mikrokrediten der Grameen-Bank als Instrument des Frauen-Empowerments
- 3.1. Zwischen Tradition und Neubeginn: Veränderungspotentiale der gesellschaftlichen Position von Frauen in Bangladesch
- 3.1.1. Rahmenbedingungen: Lebensalltag bengalischer Frauen
- 3.1.2. Zur Relativität normativer Ansprüche
- 3.2. Projektverlauf und Hintergründe der Grameen-Bank
- 3.3. Evaluierungen zur Grameen-Bank
- 3.3.1. Herangehensweisen von Evaluierungen mit Empowerment bejahendem Ergebnis
- 3.3.2. Herangehensweisen von Evaluierungen mit Empowerment verneinendem Ergebnis
- 3.3.3. Ursachen für heterogene Ergebnisse im Forschungsdiskurs
- 4. Die Empowerment-Wirkungskette dargestellt am Beispiel von Mikrokrediten der Grameen-Bank
- 4.1. Die Visibilisierung des ‘unsichtbaren Geschlechts’ als Auslöser einer Wirkungskette
- 4.1.1. Die erste Hürde: Motive für das aktive Heraustreten aus Marginalisierung und Fremdbestimmung
- 4.1.2. Mehr als bloße Kreditsicherheit: Die Erzeugung eines Wir-Gefühls in den Frauenspargruppen
- 4.1.3. Die Bedeutung von Vorbildern und Innovatoren
- 4.2. Wandel der Wahrnehmung: Prozesse soziokultureller Aufwertung
- 4.2.1. Partizipation als selbstwertdienlicher Mechanismus
- 4.2.2. Von der Hausfrau zur Familien-Ernährerin: Auswirkungen auf das haushaltsinterne Machtgefüge
- 4.2.3. Anerkennung oder Duldung? Zur Außenwahrnehmung und Akzeptanz von Kreditnehmerinnen in der bengalischen Gesellschaft
- 4.3. Neue Horizonte: Allokation von Krediten als erstmalige Chance einer eigenständigen Lebensgestaltung
- 4.3.1. Die Bedeutung eines Bewusstseins für monetäre Mechanismen als Grundlage für individuelle Lebensplanung
- 4.3.2. Beseitigung formaler Barrieren: Die Erschließung überindividueller Handlungsoptionen
- 4.3.3. Handlungsfelder zwischen Kapitalvermehrung und -konvertierung
- 4.4. Empowerment - Chance zur Überwindung des klassischen Determinismus oder Schaffung von Frauen-Nischen?
- 4.5. Schwierigkeiten und Barrieren im Empowerment-Konzept der Grameen-Bank
- 4.6. Investitionen in die Zukunft: Zu Nachhaltigkeit und Perspektiven gesellschaftlichen Wandels
- 5. Fazit und Ausblick: Multidimensionales Erklärungsmodell zur Erklärung von Empowerment
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die Empowerment-Strategien der Grameen-Bank in Bangladesch und analysiert die Auswirkungen von Mikrokrediten auf die Lebensbedingungen und Handlungsmöglichkeiten von Frauen. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss von Mikrokrediten auf die soziale und wirtschaftliche Situation von Frauen, die Herausforderungen und Chancen des Empowerment-Ansatzes und die Bedeutung von soziokulturellen Faktoren für die nachhaltige Veränderung von Frauenleben.
- Frauen-Empowerment in Entwicklungsländern
- Mikrokredite als Instrument des Empowerments
- Die Rolle der Grameen-Bank in der Förderung von Frauen
- Soziokulturelle Faktoren und ihre Auswirkungen auf Empowerment
- Nachhaltigkeit von Empowerment-Strategien
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Frauenempowerment-Strategien in Entwicklungsländern ein und grenzt die Untersuchung ab. Es werden die Zielsetzung und der Aufbau der Magisterarbeit erläutert. Das zweite Kapitel befasst sich mit einer gender-sensiblen Betrachtung des Begriffs "Empowerment". Dabei werden die strukturellen Determinanten von Disempowerment, die Bedeutung des Machtdiskurses und das Idealmodell eines Empowerment-Prozesses analysiert. Kapitel drei untersucht Mikrokredite der Grameen-Bank als Instrument des Frauen-Empowerments in Bangladesch. Es analysiert die gesellschaftliche Position von Frauen in Bangladesch, den Projektverlauf und die Hintergründe der Grameen-Bank sowie die Evaluierungen ihrer Arbeit. Kapitel vier beleuchtet die Empowerment-Wirkungskette, die durch Mikrokredite der Grameen-Bank ausgelöst wird. Es untersucht die Motive für das aktive Heraustreten von Frauen aus Marginalisierung und Fremdbestimmung, die Entstehung eines Wir-Gefühls in Frauenspargruppen sowie die Bedeutung von Vorbildern und Innovatoren. Das Kapitel analysiert außerdem den Wandel der Wahrnehmung von Frauen in der Gesellschaft, die Auswirkungen auf das haushaltsinterne Machtgefüge und die Akzeptanz von Kreditnehmerinnen in der bengalischen Gesellschaft. Weiterhin werden die neuen Möglichkeiten, die durch die Allokation von Krediten entstehen, untersucht.
Schlüsselwörter
Frauen-Empowerment, Mikrokredite, Grameen-Bank, Bangladesch, Gender, Soziokulturelle Faktoren, Nachhaltigkeit, Entwicklung, Handlungsoptionen, Marginalisierung, Fremdbestimmung, Partizipation, Machtgefüge, Lebensbedingungen, gesellschaftliche Position.
- Citar trabajo
- Birgit Michels (Autor), 2003, Empowerment-Strategien. Das Beispiel der Grameen-Bank von Bangladesch, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22750