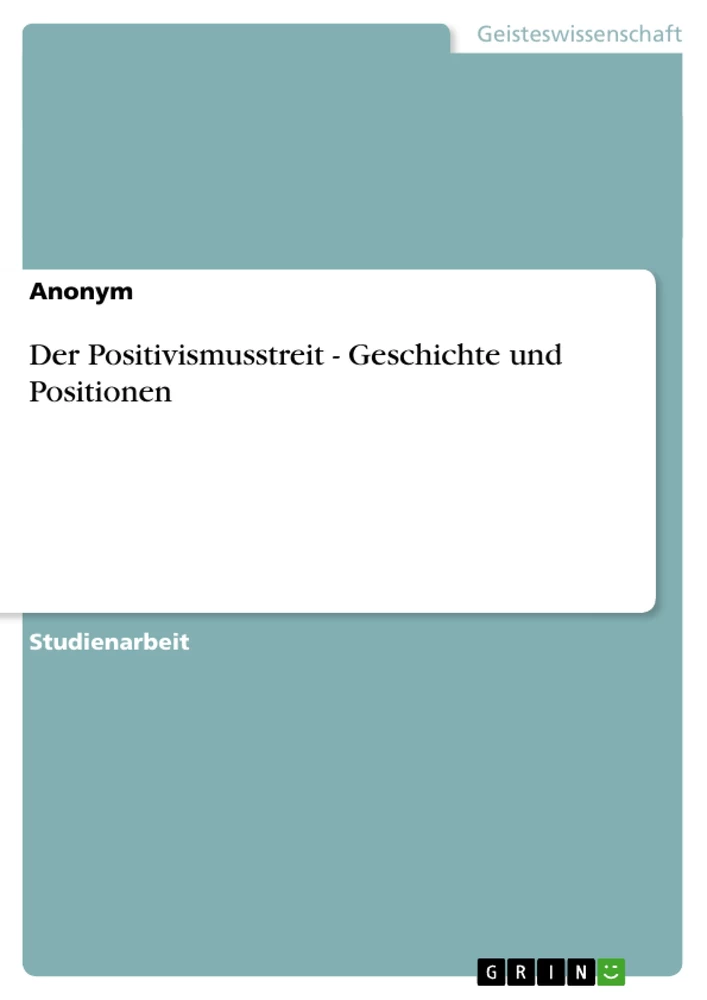Als Positivismusstreit wird die Auseinandersetzung um die Methoden der
Soziologie zwischen der Kritischen Theorie und dem Kritischen
Rationalismus bezeichnet.
Auf dem Tübinger Soziologentag 1961, maßgeblich mitorganisiert von Ralf
Dahrendorf3, wurde das Hauptreferat von Karl R. Popper (1902-1994),
Begründer des Kritischen Rationalismus, gehalten, worauf Theodor
Wiesengrund Adorno (1903- 1969), neben u.a. Max Horkheimer (1895-
1973), Felix Weill (1898- 1975), Herbert Marcuse (1898- 1979), Friedrich
Pollock (1894- 1970) Vertreter der Kritischen Theorie (wegen des Sitzes
ihres Instituts für Sozialforschung in Frankfurt- ausgenommen die NSZeit,
in der das Institut in die USA emigrierte- auch Frankfurter Schule
genannt) mit seinem Koreferat antwortete. Thema der Referate war die
Logik der Sozialwissenschaften. Obwohl von einigen Autoren bemerkt
wird, die Gegensätze zwischen Adorno und Popper seien durch die
Referate nicht klar genug dargestellt worden4, zeigten sie doch die
Widersprüche zwischen den beiden Schulen auf und führten zu einer
intensiven methodischen Diskussion innerhalb der Sozialwissenschaften,
die entscheidend mitgeprägt wurde von der nachfolgenden
Auseinandersetzung zwischen Jürgen Habermas, damals
wissenschaftlicher Mitarbeiter von Adorno, und Hans Albert, Vertreter des
Kritischen Rationalismus.
Der Begriff Positivismusstreit entstammt dem Vorwurf der Kritischen
Theorie gegenüber dem Kritischen Rationalismus, dessen Vertreter
betrieben eine Form des Positivismus.
Als Positivismus wird die Lehre bezeichnet, die den Gegenstand der
Wissenschaft auf empirisch Wahrnehmbares reduziert. Metaphysische
oder gar theologische Interpretationen der Welt werden verworfen. Der
Positivismus sieht seine Aufgabe in der Systematisierung des sinnlich
Erfahrbaren und der Suche nach seinen Gesetzen. Als Begründer des
Positivismus gilt Auguste Comte (1798- 1857), der den Übergang von der
sozialen Physik zur Soziologie markiert und somit auch als Begründer der Soziologie gelten kann. [...]
3 Vgl. Dahms 1994, S. 323f.
4 Vgl. Dahrendorf in: Adorno u.a. 1969, S. 145 und Dahms 1994, S. 341
Inhaltsverzeichnis
- 1. Historisches zum Positivismus- und Werturteilsstreit
- 2. Das Wissenschaftsverständnis der Kritischen Theorie
- 3. Das Wissenschaftsverständnis des Kritischen Rationalismus
- 4. Die Tübinger Referate
- 4.1 Karl Popper
- 4.2 Theodor W. Adorno
- 5. Habermas- Albert
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den sogenannten Positivismusstreit, eine wichtige Debatte in der Soziologie, die sich um die Methoden und das Verständnis der Sozialwissenschaften dreht. Sie untersucht die Positionen der Kritischen Theorie und des Kritischen Rationalismus und beleuchtet die zentralen Themen und Debattenpunkte, die diese beiden Denkrichtungen prägen.
- Wissenschaftsverständnis der Kritischen Theorie vs. des Kritischen Rationalismus
- Methoden und Ansätze in der Sozialforschung
- Werturteilsfreiheit und die Rolle von Werten in der wissenschaftlichen Analyse
- Das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis
- Der Einfluss des Positivismus auf die Entwicklung der Sozialwissenschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Historisches zum Positivismus- und Werturteilsstreit Dieses Kapitel führt in die Geschichte des Positivismusstreits ein. Es erläutert die Kontroversen, die zwischen der Kritischen Theorie und dem Kritischen Rationalismus entstanden sind, und verfolgt deren Wurzeln bis zum Werturteilsstreit des frühen 20. Jahrhunderts.
Kapitel 2: Das Wissenschaftsverständnis der Kritischen Theorie Dieses Kapitel beschreibt das Wissenschaftsverständnis der Kritischen Theorie, die sich kritisch mit den herrschenden Machtstrukturen und den Folgen der kapitalistischen Gesellschaft auseinandersetzt. Es beleuchtet die wichtigsten Vertreter der Kritischen Theorie und deren Kritik an den traditionellen Methoden der Sozialwissenschaften.
Kapitel 3: Das Wissenschaftsverständnis des Kritischen Rationalismus Dieses Kapitel stellt das Wissenschaftsverständnis des Kritischen Rationalismus vor, das sich auf die Falsifizierbarkeit von Theorien und auf den wissenschaftlichen Fortschritt durch Kritik und rationalen Diskurs konzentriert. Es beleuchtet die wichtigsten Vertreter des Kritischen Rationalismus und ihre wissenschaftstheoretischen Positionen.
Kapitel 4: Die Tübinger Referate Dieses Kapitel analysiert die beiden Hauptreferate des Tübinger Soziologentags 1961, die von Karl Popper und Theodor W. Adorno gehalten wurden. Es untersucht die jeweiligen Argumente der beiden Kontrahenten und zeigt die zentralen Punkte des wissenschaftstheoretischen Streits auf.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen und Konzepte dieser Arbeit lassen sich mit Begriffen wie Kritische Theorie, Kritischer Rationalismus, Positivismus, Werturteilsstreit, Sozialwissenschaften, Methodenstreit, Falsifizierbarkeit, Gesellschaftstheorie, Frankfurter Schule, Wiener Kreis, Tübingen Soziologentag 1961, Karl Popper, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Hans Albert, Jürgen Habermas beschreiben.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2002, Der Positivismusstreit - Geschichte und Positionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22756