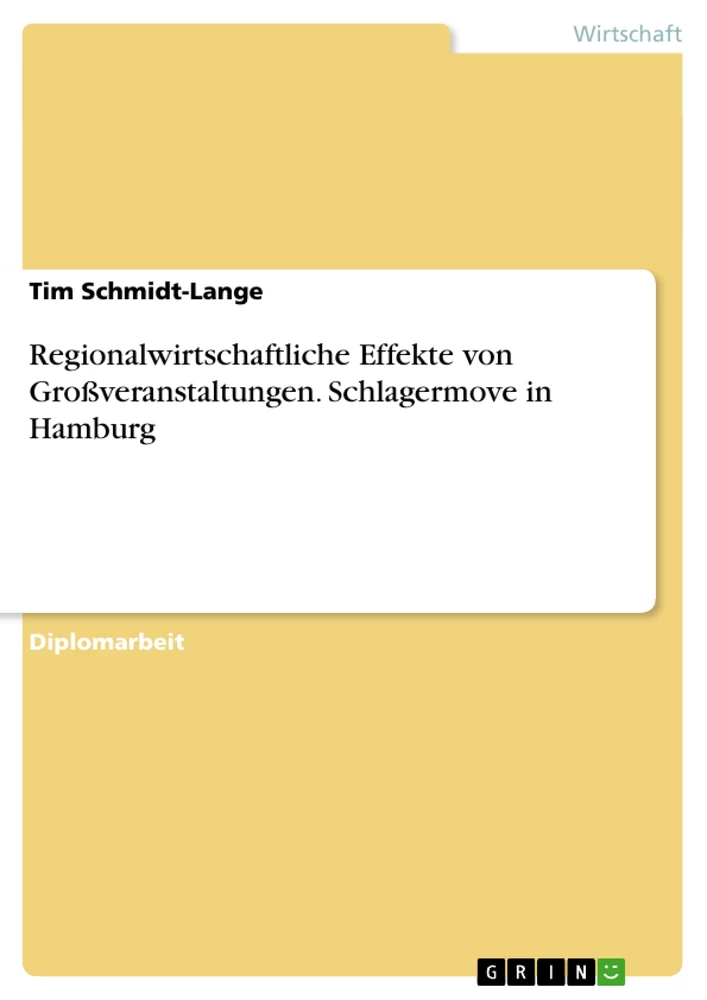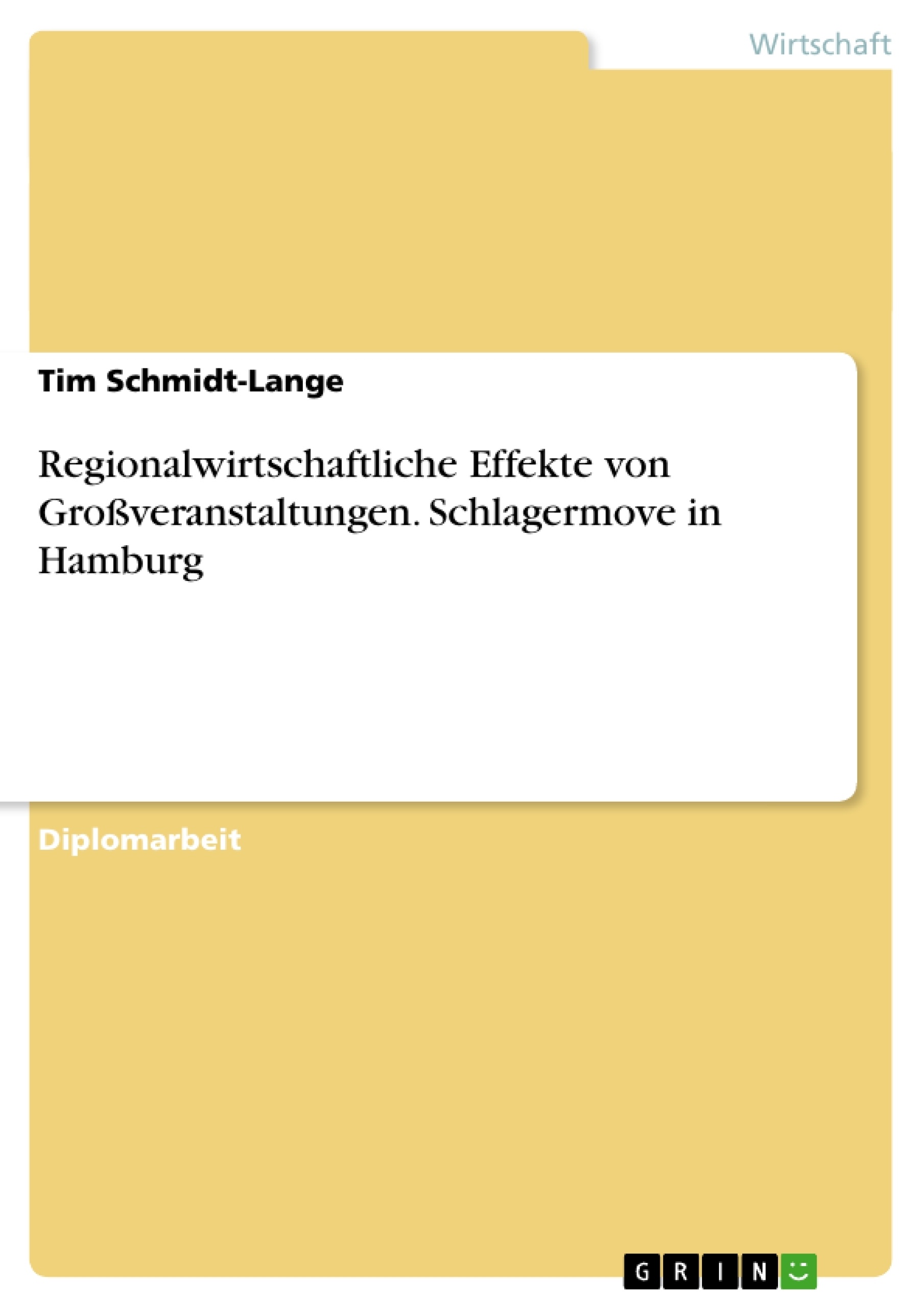Der Besuch von Großveranstaltungen unterschiedlichster Art stellt für weite Teile der
Bevölkerung eine attraktive Form der Freizeitbeschäftigung dar. Dabei werden die
Besucher immer anspruchsvoller und verlangen nach stets neuen und innovativen
Veranstaltungen. Längst vermag der traditionelle Jahrmarkt oder das klassische
Theaterstück kaum noch jemanden vom Hocker zu reißen. Vor diesem Hintergrund
entsteht, insbesondere in der jüngeren Vergangenheit, eine Vielzahl neuer Veranstaltungsformen
mit verschiedensten Inhalten, Größenordnungen, Zeiträumen oder Zielgruppen.
So wartet heute fast jede Kleinstadt mit eigenen Kulturwochen, Sport-Events
oder Erlebnistagen auf. Größere Städte veranstalten eigene Festspiele oder profitieren
von Großereignissen wie Marathonläufen, Musikparaden oder Fußballspielen der
Bundesliga. So wird die Großveranstaltung, das Event, von Kommunalpolitikern zunehmend
als Mittel der Regionalentwicklung benutzt um die Stadt weiterhin attraktiv zu
halten – sowohl nach innen (für die Residenten) als auch nach außen (für auswärtige
Besucher) (Häußermann/Siebel 1993: 17). Wie groß die Hoffnungen sind, die an die
Ausrichtung von Großveranstaltungen geknüpft sind, zeigt der enorme Akquirierungsund
Entwicklungsaufwand, der in den letzten Jahren von vielen Kommunen im Umfeld
von Großveranstaltungen betrieben wurde (Kruse 1991: 178f.). Die Berliner Bewerbung
zur Ausrichtung der olympischen Spiele 2000 verschlang Millionen. Die Weltausstellung
EXPO 2000 kostete nicht nur die Stadt Hannover sondern auch die Bundeskassen
Milliarden. Olympia 2012 lässt Leipzig und ganz Ostdeutschland auf neue
wirtschaftliche Impulse hoffen. Schon sprechen Kritiker von einer „Festivalisierung der
Stadtpolitik“ (Häußermann/Siebel 1993). Aber auch weniger langfristig angelegte
Großveranstaltungen sollen den Städten zu kontinuierlichem Besucherandrang und
neuen Gästegruppen verhelfen. Die Berliner Loveparade gilt gemeinhin als Musterbeispiel
dafür, wie außergewöhnliche Events das Image einer Stadt positiv verändern
können. Gerade bei solchen kurzzeitigen Veranstaltungen treten aber neben den
kommunalen auch privatwirtschaftliche Veranstalter in Konkurrenz um die spendierfreudigen
Massen der Freizeitkonsumenten. Entsprechend unüberschaubar ist auch
hier die Fülle von Angeboten wie Großkonzerten, Gastronomiefesten oder Themenpartys.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen
- Literaturüberblick: Großveranstaltungen und ihre regionalen Effekte
- Großveranstaltungen
- Großveranstaltung oder Event - eine Begriffsklärung
- Geschichte von Großveranstaltungen
- Großveranstaltungen der deutschen Gegenwart
- Regionale Effekte von Großveranstaltungen
- Tangible Nutzen für die Region
- Intangible Nutzen für die Region
- Tangible und intangible Kosten für die Region
- Möglichkeiten und Grenzen zur Erfassung der Effekte
- Großveranstaltungen
- Der Schlagermove - „Ein Festival der Liebe“
- Entstehung und Entwicklung (1997 bis 2002)
- Rahmenbedingungen im Untersuchungsjahr
- Methoden der empirischen Untersuchung
- Besucherbefragung
- Experteninterviews
- Sekundärliteratur- und Internetrecherche
- Ergebnisse der empirischen Untersuchung
- Grundlegende Ergebnisse
- Gesamtbesucherzahl und Erfassungsgrad
- Zufriedenheit der Besucher
- Geschlecht und Alter
- Herkunft
- Anreise
- Besuchsgrund der auswärtigen Besucher
- Erstbesucher oder Wiederholungsbesucher
- Aufenthaltsdauer und Übernachtung der auswärtigen Besucher
- Regionalwirtschaftliche Ergebnisse: Tangible Nutzen
- Direkte Effekte
- Indirekte Effekte
- Induzierte Effekte
- Fiskalische Effekte
- Regionalwirtschaftliche Ergebnisse: Intangible Nutzen
- Medienresonanz und erhöhte Aufmerksamkeit
- Image
- Weitere Nutzen
- Regionalwirtschaftliche Ergebnisse: Tangible und intangible Kosten
- Regionalwirtschaftliche Ergebnisse: Übersicht und Vergleich
- Grundlegende Ergebnisse
- Fazit und Handlungsempfehlungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die regionalwirtschaftlichen Effekte von Großveranstaltungen anhand des Beispiels des Schlagermove in Hamburg. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der tangiblen und intangiblen Nutzen und Kosten der Veranstaltung für die Region. Die Arbeit soll einen Beitrag leisten zum Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen Großveranstaltungen und regionaler Entwicklung.
- Regionale Auswirkungen von Großveranstaltungen
- Analyse von tangiblen und intangiblen Effekten
- Wertschöpfungsanalyse und Beschäftigungseffekte
- Image und Medienresonanz als intangible Nutzen
- Kosten für die Region und deren Abwägung mit dem Nutzen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz von Großveranstaltungen für die Regionalentwicklung und die Problemstellung der Arbeit erläutert. Im Anschluss erfolgt ein Literaturüberblick zu Großveranstaltungen und ihren regionalen Effekten, wobei die verschiedenen Nutzen und Kosten sowie die Möglichkeiten und Grenzen ihrer Erfassung beleuchtet werden. Kapitel 3 widmet sich dem Schlagermove als Fallbeispiel und beschreibt Entstehung, Entwicklung und Rahmenbedingungen der Veranstaltung. In Kapitel 4 werden die Methoden der empirischen Untersuchung vorgestellt, die aus einer Besucherbefragung, Experteninterviews und einer Sekundärliteratur- und Internetrecherche bestehen. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung, wobei sowohl grundlegende Ergebnisse zur Besucherstruktur und -zufriedenheit als auch die regionalwirtschaftlichen Effekte im Detail beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Großveranstaltungen, Regionalentwicklung, regionalwirtschaftliche Effekte, Schlagermove, Hamburg, Tourismus, Wertschöpfung, Beschäftigungseffekte, Image, Medienresonanz, Kosten-Nutzen-Analyse.
- Arbeit zitieren
- Tim Schmidt-Lange (Autor:in), 2004, Regionalwirtschaftliche Effekte von Großveranstaltungen. Schlagermove in Hamburg, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22797