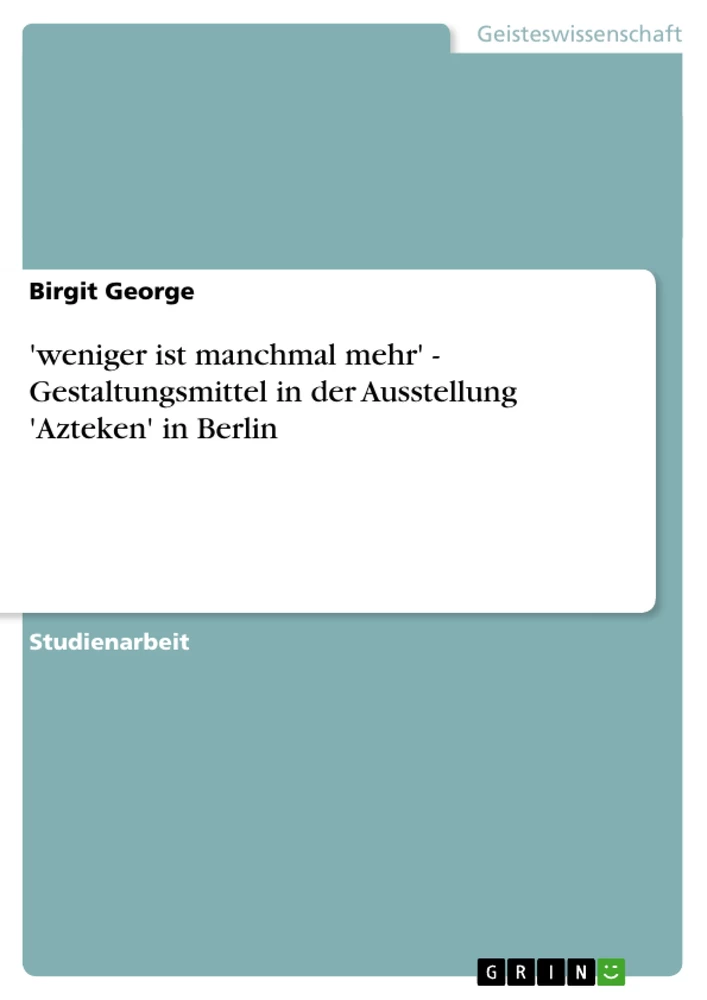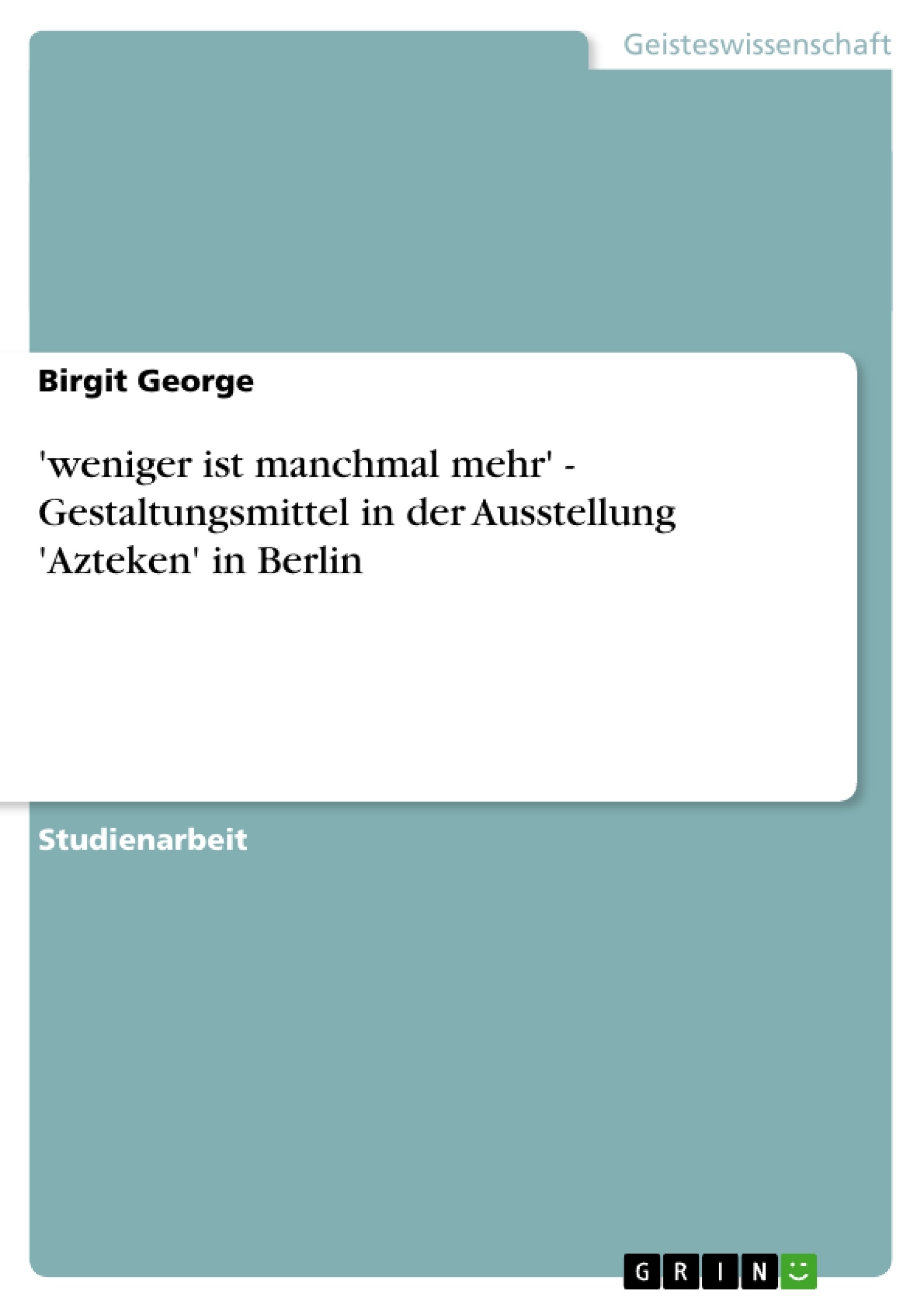Die „Azteken“-Ausstellung fiel mir durch frappante Plakatwerbung und einen Leitartikel der
Zeitschrift „Der Spiegel“ im Mai 2003 auf, der zwar sehr populär aufgemacht war und mehr
über die Azteken an sich informierte, aber auch neugierig auf diese Ausstellung machte.
Nach meinem Besuch in der Ausstellung war ich einerseits fasziniert von den
Exponaten, andererseits etwas enttäuscht von den wenig verwendeten modernen Medien als
Gestaltungsmittel. Ich hätte mir mehr davon gewünscht, allerdings ging ich auch mit der
Ansicht in die Ausstellung, dies sei eine historisch-ethnologische.
Ich wollte mich folglich mit der Frage befassen, was man hätte mehr oder anders
machen können bzw. welche anscheinend doch vielen, zurückhaltenden Gestaltungsmittel
benutzt wurden. Ich erfuhr während meiner Recherchen, dass die Konzeption dieser
Ausstellung eher auf einer künstlerischen beruht. Allerdings wird ebenso der ethnologische
Teil berücksichtigt, in Berlin auch speziell die „heimische“ Verbindung zu diesem
Themengebiet wie Berliner Forschungen oder bekannte Persönlichkeiten aus diesem
Fachbereich.
Dies veranlasste mich, einmal genauer zu schauen, was bei einer Kunstausstellung -
unter inszenatorischen Aspekt betrachtet - möglich bzw. sinnvoll ist, da das vorrangige Ziel
doch eher darin besteht, dem Besucher die Objekte an sich näher zu bringen. Der finanzielle
Rahmen und konservatorische Aspekte spielen natürlich auch eine nicht unbedeutende Rolle.
Im Folgenden werde ich dementsprechend auf die Ausstellung an sich etwas eingehen
– nur ein wenig den Inhalt betreffend - und anschließend die verwendeten inszenatorischen
Mittel genauer beleuchten, das Verhältnis zwischen Kunst und Ethnologie beachtend.
Besonders interessierten mich auch die Erwartungen und Ansichten der Besucher,
weshalb ich einige kurze, exemplarische Interviews durchführte. Aus diesem Grund möchte
ich auch all jenen danken, die mir bereitwillig Auskunft gaben, insbesondere Herrn Günter
Krüger, dem Gestalter dieser Ausstellung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Methodik
- 3. Architektur und Räumlichkeiten: Der Martin-Gropius-Bau
- 4. „Azteken“ - Die Ausstellung
- 4.1 Teil I
- 4.2 Teil II
- 4.3 Teil III
- 5. Der moderne, museale Inszenierungsbegriff
- 6. Analyse der angewandten Stilmittel in „Azteken“
- 7. Moderne versus Klassik oder: „weniger ist mehr“?
- 8. Schlußwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Inszenierung der Ausstellung „Azteken“ im Martin-Gropius-Bau in Berlin. Ziel ist es, die angewandten Gestaltungsmittel zu analysieren und deren Wirkung auf den Besucher zu beleuchten. Dabei wird der Vergleich zwischen modernen und klassischen Inszenierungsansätzen im Fokus stehen.
- Analyse der Gestaltungsmittel in der Ausstellung „Azteken“
- Vergleich zwischen modernen und klassischen musealen Inszenierungsformen
- Die Rolle der Architektur des Martin-Gropius-Baus für die Ausstellungsgestaltung
- Wirkung der Ausstellung auf die Besucher
- Die Beziehung zwischen Kunst und Ethnologie in der Ausstellungskonzeption
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Motivation der Autorin, sich mit der Ausstellung „Azteken“ auseinanderzusetzen. Ausgelöst durch eine auffällige Plakatwerbung und einen Artikel im „Spiegel“, wird die anfängliche Faszination über die Exponate mit einer leichten Enttäuschung über den sparsamen Einsatz moderner Medien kontrastiert. Die Autorin kündigt ihre Absicht an, die verwendeten Gestaltungsmittel zu analysieren und die Frage zu untersuchen, was an der Ausstellung anders oder besser hätte gestaltet werden können. Sie betont den künstlerischen Ansatz der Ausstellungskonzeption, der dennoch den ethnologischen Aspekt und die Berliner Verbindung zum Thema berücksichtigt. Die Arbeit wird die inszenatorischen Mittel beleuchten, unter Berücksichtigung des Verhältnisses von Kunst und Ethnologie, und bezieht auch die Meinungen der Besucher mit ein, die durch Kurzinterviews gewonnen wurden.
2. Methodik: Dieses Kapitel beschreibt die angewandte Methodik der Autorin. Ein zentrales Element bildet das Interview mit dem Ausstellungsdesigner Günter Krüger, dessen Zitate in kleinerer Schrift im Text erscheinen. Die Autorin hebt die Bedeutung der Aufnahme von Besuchermeinungen hervor, um Tendenzen in der Resonanz auf die Ausstellung zu erkennen. Der Mangel an eigenen Bildern der Ausstellung wird erwähnt, so dass die Autorin auf detaillierte Beschreibungen zurückgreifen muss.
3. Architektur und Räumlichkeiten: Der Martin-Gropius-Bau: Das Kapitel beschreibt die Architektur des Martin-Gropius-Baus, seine Geschichte und seine Eignung als Ausstellungsort. Es wird auf die ursprüngliche Nutzung als Kunstgewerbemuseum und die baulichen Veränderungen nach dem Zweiten Weltkrieg eingegangen. Die Beschreibung der Räumlichkeiten konzentriert sich auf die Eignung für Ausstellungen, insbesondere die großen Räume, die hohe Decken und die flexible Beleuchtung. Es wird ein Zitat von Herrn Krüger eingefügt, welches seine Einschätzung zur Eignung des Gebäudes für die Ausstellung „Azteken“ wiedergibt und die Raumfolge und Größe der Räume kommentiert.
4. „Azteken“ - Die Ausstellung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Ausstellung selbst, jedoch ohne detaillierte Beschreibungen der einzelnen Teile (4.1, 4.2, 4.3) zu liefern. Stattdessen liefert es eine zusammenfassende Beschreibung des gesamten Ausstellungsaufbaus.
5. Der moderne, museale Inszenierungsbegriff: Dieser Abschnitt befasst sich mit dem theoretischen Hintergrund des modernen musealen Inszenierungsbegriffs und dessen Einfluss auf die Gestaltung der Ausstellung "Azteken". Es werden verschiedene Aspekte der modernen Museumspräsentation untersucht, wie z.B. der Umgang mit Exponaten, die Inszenierung des Raumes und die Berücksichtigung des Publikums.
6. Analyse der angewandten Stilmittel in „Azteken“: Dieses Kapitel analysiert die konkreten Gestaltungsmittel der Ausstellung „Azteken“. Es wird detailliert auf die verwendeten Techniken und deren Wirkung eingegangen. Der Vergleich zwischen den eingesetzten Mitteln und dem modernen Inszenierungsbegriff wird angestellt.
7. Moderne versus Klassik oder: „weniger ist mehr“?: Hier wird eine Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von modernen und klassischen Gestaltungsprinzipien in der Ausstellung geführt. Das Kapitel vergleicht die in der Ausstellung „Azteken“ angewandten Methoden mit klassischen und modernen Ansätzen und diskutiert deren Vor- und Nachteile.
Schlüsselwörter
Azteken, Ausstellungsgestaltung, Martin-Gropius-Bau, Museale Inszenierung, Moderne und Klassische Gestaltungsmittel, Ethnologie, Kunst, Besucherreaktionen, Günter Krüger.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Ausstellung "Azteken" im Martin-Gropius-Bau
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Inszenierung der Ausstellung "Azteken" im Martin-Gropius-Bau in Berlin. Der Fokus liegt auf der Analyse der angewandten Gestaltungsmittel und deren Wirkung auf den Besucher, sowie dem Vergleich zwischen modernen und klassischen Inszenierungsansätzen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Analyse der Gestaltungsmittel in der Ausstellung "Azteken", den Vergleich zwischen modernen und klassischen musealen Inszenierungsformen, die Rolle der Architektur des Martin-Gropius-Baus, die Wirkung der Ausstellung auf die Besucher und die Beziehung zwischen Kunst und Ethnologie in der Ausstellungskonzeption.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Autorin führte Interviews mit dem Ausstellungsdesigner Günter Krüger und sammelte Besuchermeinungen, um die Resonanz auf die Ausstellung zu erfassen. Aufgrund des Mangels an eigenen Bildern der Ausstellung stützt sich die Analyse auf detaillierte Beschreibungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Methodik, ein Kapitel zur Architektur des Martin-Gropius-Baus, ein Kapitel zur Ausstellung "Azteken" (unterteilt in Teil I, II und III), ein Kapitel zum modernen musealen Inszenierungsbegriff, eine Analyse der angewandten Stilmittel, einen Vergleich zwischen modernen und klassischen Gestaltungsprinzipien und ein Schlusswort. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Rolle spielt die Architektur des Martin-Gropius-Baus?
Die Arbeit untersucht die Eignung des Martin-Gropius-Baus als Ausstellungsort, seine Geschichte und seine baulichen Merkmale (große Räume, hohe Decken, flexible Beleuchtung) im Hinblick auf die Inszenierung der Ausstellung "Azteken". Zitate von Herrn Krüger beleuchten seine Einschätzung der Raumfolge und -größe.
Wie wird die Ausstellung "Azteken" beschrieben?
Die Arbeit bietet eine zusammenfassende Beschreibung des gesamten Ausstellungsaufbaus, ohne detaillierte Beschreibungen der einzelnen Teile (4.1, 4.2, 4.3).
Was ist der Vergleich zwischen modernen und klassischen Gestaltungsprinzipien?
Die Arbeit vergleicht die in der Ausstellung "Azteken" angewandten Methoden mit klassischen und modernen Ansätzen und diskutiert deren Vor- und Nachteile. Die Frage "weniger ist mehr?" wird im Kontext der Ausstellung diskutiert.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit ergeben sich aus der detaillierten Analyse der angewandten Gestaltungsmittel und dem Vergleich mit modernen und klassischen Ansätzen. Die Autorin bewertet die Wirkung der Ausstellung auf den Besucher und diskutiert mögliche Verbesserungen der Gestaltung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Azteken, Ausstellungsgestaltung, Martin-Gropius-Bau, Museale Inszenierung, Moderne und Klassische Gestaltungsmittel, Ethnologie, Kunst, Besucherreaktionen, Günter Krüger.
- Citar trabajo
- Birgit George (Autor), 2003, 'weniger ist manchmal mehr' - Gestaltungsmittel in der Ausstellung 'Azteken' in Berlin, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22823