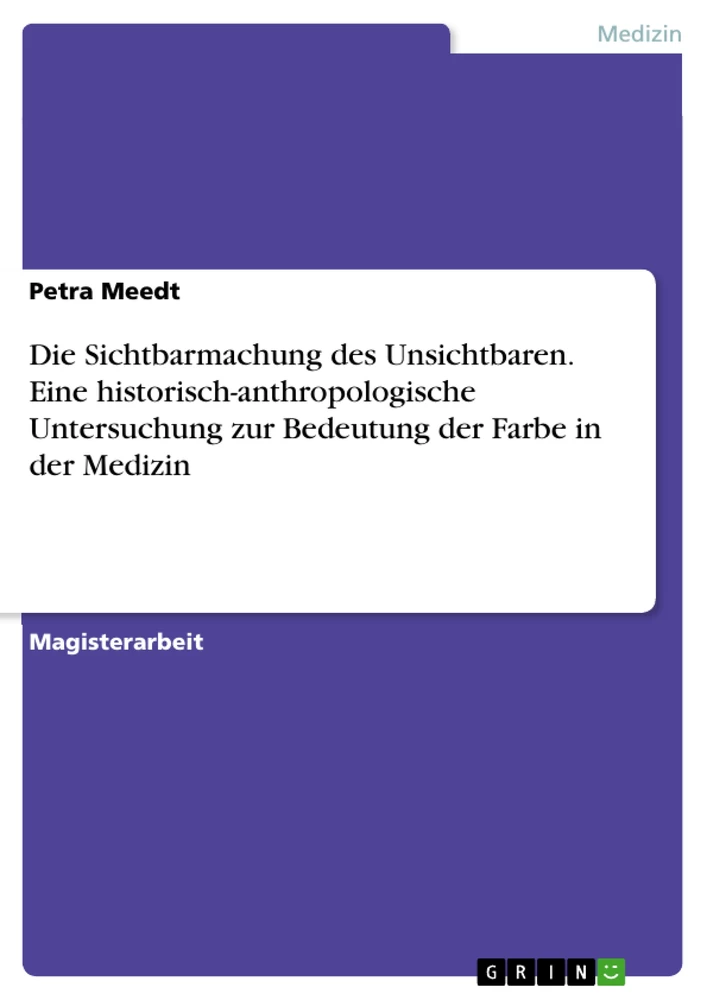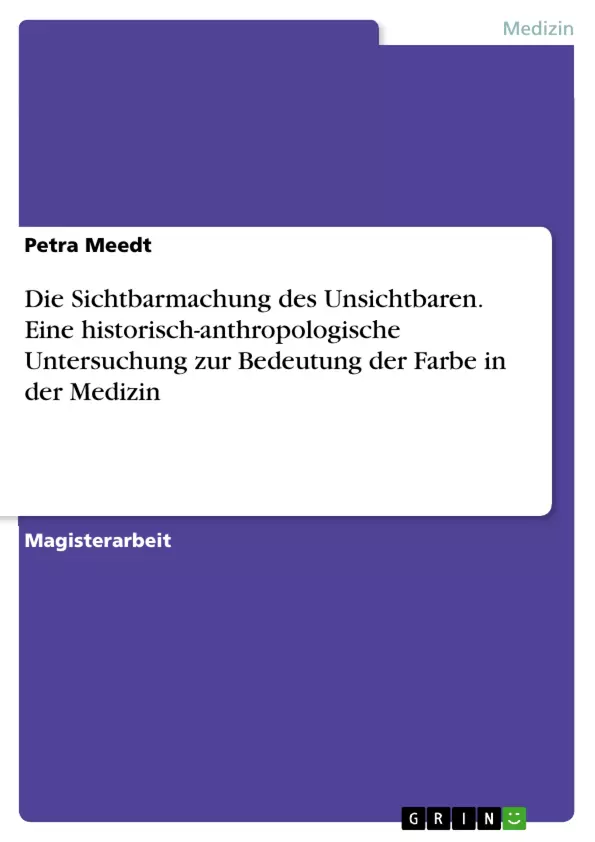Der Wecker klingelt und die roten Ziffern, die ihm aus der Zimmerecke entgegenleuchten, zeigen Herrn X an, daß es Zeit ist aufzustehen. Sein erster Weg führt ihn, wie jeden Tag, ins Badezimmer, wo er die grüne Zahnbürste aus dem Regal nimmt (die rote gehört seiner Ehefrau) und sich damit die Zähne putzt. Nach weiteren allmorgendlichen Tätigkeiten verläßt Herr X pünktlich seine Wohnung und macht sich mit seinem Auto auf den Weg zur Arbeit. Nach kurzer Autofahrt bezeichnet ihm ein blaues Schild, auf dem ein weißes "P" abgebildet ist, daß er am Ziel der Fahrt angekommen ist und hier sein Auto abstellen kann.
Gegen Nachmittag hat Herr X einen Termin in einem Teil der Stadt, der mit dem Auto nicht gut zu erreichen ist, weswegen er sich entschließt, in diesem Fall sein Auto stehen zu lassen und die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Er verläßt also seinen Arbeitsplatz und macht sich auf den Weg zur nächsten U-Bahn-Haltestelle. Bei jeder Straßenüberquerung zeigt ihm ein rotes Männchen an, daß er seinen Weg an der bezeichneten Stelle unterbrechen muß, während ein grünes Männchen ihm jeweils bedeutet, daß er seinen Weg gefahrlos weiter fortsetzen kann. Das grüne "U" auf gelbem Untergrund zeigt ihm schließlich an, daß er am ersten Etappenziel, der U-Bahn-Haltestelle, angekommen ist. Um sich weiter darüber zu orientieren, welche der zahlreichen U-Bahn-Linien ihn an das gewünschte Ziel bringen kann, wirft er einen Blick auf den Liniennetzplan und findet heraus, daß die gelbe Linie in die von ihm gewünschte Richtung fahren wird, woraufhin er den gelben Wegweisern zur bezeichneten U-Bahn-Station folgt. Er versichert sich kurz, ob die U-Bahn, die gerade auf dem Bahnsteig eingefahren ist, auch wirklich mit einem gelben Schild gekennzeichnet ist und nicht vielleicht doch in eine andere, als die von ihm gewünschte Richtung unterwegs ist, steigt ein und erreicht einige Minuten später das ersehnte Ziel.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Ansatzpunkte einer Erörterung des ,,Phänomen Farbe“.
- B.1. Physik und Farbe
- B. 1.1. Vom Zusammenhang zwischen Licht und Farbe.
- B. 1.2. Licht Wellenlänge oder Partikel?
- B. 1.3. Farbe als physikalische Größe
- B. 1.4. Das Phänomen der Streuung…
- B.2. Physiologie der Farbwahrnehmung
- B. 2.1. Theoretische Grundlagen einer Physiologie der Farbwahrnehmung
- B. 2.2. Der dioptrische Apparat.
- B. 2.2.1. Die Färbung der Linse..
- B. 2.2.2. Die Netzhaut und ihre Aufgaben…
- B. 2.3. Farbwahrnehmung im Gehirn…
- B. 2.4. Zur Evolutionstheorie der Farbwahrnehmung…
- B.3. Psychologie und die Wirkung der Farben auf den Menschen
- B. 3.1. Farbe und Gemüt – psychologische Wirkung von Farbe…
- B. 3.2. Farbe und Körper – physiologische Wirkung von Farbe
- B. 3.2.1. Raumgestaltung in Krankenhäusern…
- B. 3.2.2. Zur psychologischen Bedeutung der Färbung von Medikamenten..
- B. 3.3. Farbe und Kultur - Farbe als „kulturelles Konstrukt“
- C) Zur phänomenologischen Bedeutung von Farbe in traditionellen Medizinsystemen…
- C.1. „Traditionelle Medizinsysteme“ und Empirie.
- C.2. Farbe in der Semiotik (Zeichenlehre)
- C. 2.1. Semiotik als vorwissenschaftliche „Diagnosemethode“
- C. 2.2. Farbe als Signifikant für Krankheit und Gesundheit
- C. 2.3. Von der Semiotik zur Diagnose
- C.3. Farbe in der „Volksmedizin“…
- C.4. Farbe in der Humoralpathologie…
- C. 4.1. Zur Konzeption und Verbreitung der Humoralpathologie…
- C. 4.2. Säfte, Elemente und Farben in der galenischen Humoralpathologie..
- C. 4.3. Urindiangostik (am Beispiel der tibetischen Humoralpathologie)
- D) Zur indikatorischen Bedeutung von Farbe in der naturwissenschaftlich geprägten Medizin…
- D.1. Zur Konzeption der Naturwissenschaft Medizin…
- D.2. Zur Rolle der Farbe in der modernen Diagnostik (am Beispiel der Mikroskopie)..
- D. 2.1. Vorgeschichte: Die Entdeckung der synthetischen Farbstoffe…
- D. 2.2. Zur Bedeutung der Farben in der Entwicklung der Mikroskopie..
- D. 2.3. Farben in den bildgebenden Verfahren der modernen Diagnosik..
- D. 2.4. Blickdiagnostik als „Relikt“ einer traditionellen Anwendung von Farbe…
- D.3. Zur Bedeutung von Farbe für die Chemotherapie…
- D. 3.1. Vorgeschichte: Die Entwicklung der ersten synthethischen Heilmittel…
- D. 3.2. Die Grundlagen der Chemotherapie und ihre „farbigen Anfänge“.
- D. 3.2.1. Paul Ehrlich und die Theorie der selektiven Abtötung von Mikroben.
- D. 3.2.2. Die Stoffgruppe der Sulfonamide…
- D. 3.2.3. Moderne Arzneimittelherstellung…
- D. 4. „Randbereiche“ der naturwissenschaftlichen Medizin
- D.4.1. Zur Bedeutung von Farbe in Esoterik und alternativer Medizin…
- D.4.1.1. Exkurs: Interview mit der Auraheilerin Nina Dul..
- D.4.1.2. Erläuterung zum esoterischen Verständnis von „Farbe“.
- D.4.2. Farbe in der Homöopathie…
- D.4.3. Farbe und Ernährung..
- E) Ergebnisse der Untersuchung…
- F) Schluss…
- G) Bibliographie…
- H) Anhang…
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit befasst sich mit der Bedeutung von Farbe in der Medizin und untersucht den Zusammenhang zwischen verschiedenen Wahrnehmungen über Ursprung und Wesen von Farbe und den jeweiligen Konzeptionen und Methoden der Medizin. Ziel ist es, zu analysieren, inwieweit diese Faktoren die Anwendung von Farbe und damit ihre Bedeutung beeinflussen.
- Die Bedeutung von Farbe als Symbolsystem in der menschlichen Erfahrungswelt
- Die Rolle von Farbe in traditionellen Medizinsystemen und empirischen Ansätzen
- Die Verwendung von Farbe in der modernen naturwissenschaftlichen Medizin, insbesondere in der Diagnostik und Chemotherapie
- Die Einbindung von Farbe in esoterische und alternative medizinische Ansätze
- Der Einfluss kultureller Faktoren auf die Interpretation und Bedeutung von Farbe in der Medizin
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit anhand eines hypothetischen Alltagsbeispiels vor. Sie verdeutlicht, wie Farben als Orientierungshilfe im Alltag dienen und gleichzeitig ein wichtiges Symbolsystem darstellen. Kapitel B erörtert verschiedene wissenschaftliche Ansätze zur Erklärung des „Phänomens Farbe", angefangen von der Physik über die Physiologie der Farbwahrnehmung bis hin zur Psychologie der Farbwahrnehmung. Kapitel C untersucht die phänomenologische Bedeutung von Farbe in traditionellen Medizinsystemen und setzt dabei den Fokus auf die Semiotik und die „Volksmedizin“. Kapitel D widmet sich der indikatorischen Bedeutung von Farbe in der naturwissenschaftlich geprägten Medizin, wobei die Rolle von Farbe in der modernen Diagnostik und Chemotherapie im Vordergrund steht. Die Arbeit untersucht zudem die Bedeutung von Farbe in „Randbereichen" der naturwissenschaftlichen Medizin wie Esoterik, Homöopathie und Ernährung. Abschließend werden die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst und in einem Schlussteil reflektiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt Themen wie Farbwahrnehmung, Medizin, Symbol, Semiotik, traditionelle Medizinsysteme, naturwissenschaftliche Medizin, Diagnostik, Chemotherapie, Esoterik, Homöopathie, Farbe und Kultur.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Farbe in der medizinischen Diagnostik?
Farben dienen als Indikatoren für Gesundheit oder Krankheit, etwa bei der mikroskopischen Untersuchung von Zellen oder der Analyse von Körperflüssigkeiten.
Was ist die Humoralpathologie?
Die Humoralpathologie (Säftelehre) ordnet Körperflüssigkeiten bestimmte Farben und Elemente zu, um das Gleichgewicht des Körpers zu beurteilen.
Wie beeinflussen Farben die Raumgestaltung in Krankenhäusern?
Farben haben psychologische und physiologische Wirkungen; eine gezielte Gestaltung kann das Wohlbefinden steigern und den Heilungsprozess unterstützen.
Haben Medikamentenfarben eine Bedeutung?
Ja, die Färbung von Medikamenten kann die Erwartungshaltung des Patienten und damit die psychologische Wirkung (Placebo-Effekt) beeinflussen.
Was versteht man unter „Blickdiagnostik“?
Blickdiagnostik ist ein Relikt traditioneller Medizin, bei dem der Arzt allein durch die visuelle Wahrnehmung von Hautfarbe, Augen oder Zunge Rückschlüsse auf Krankheiten zieht.
- Arbeit zitieren
- Petra Meedt (Autor:in), 2003, Die Sichtbarmachung des Unsichtbaren. Eine historisch-anthropologische Untersuchung zur Bedeutung der Farbe in der Medizin, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22921