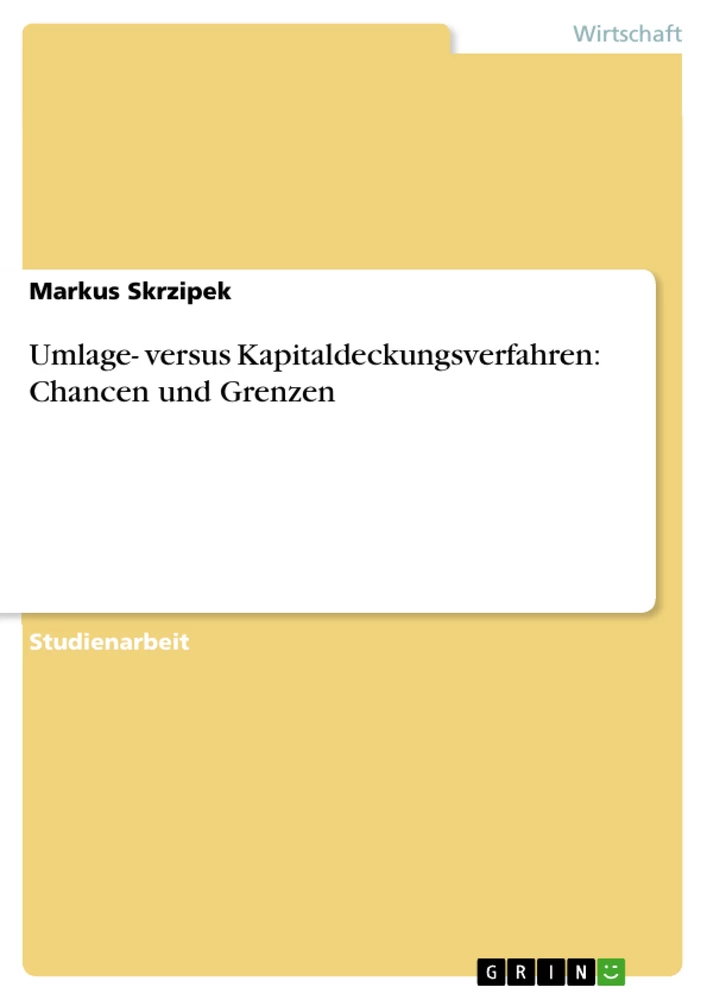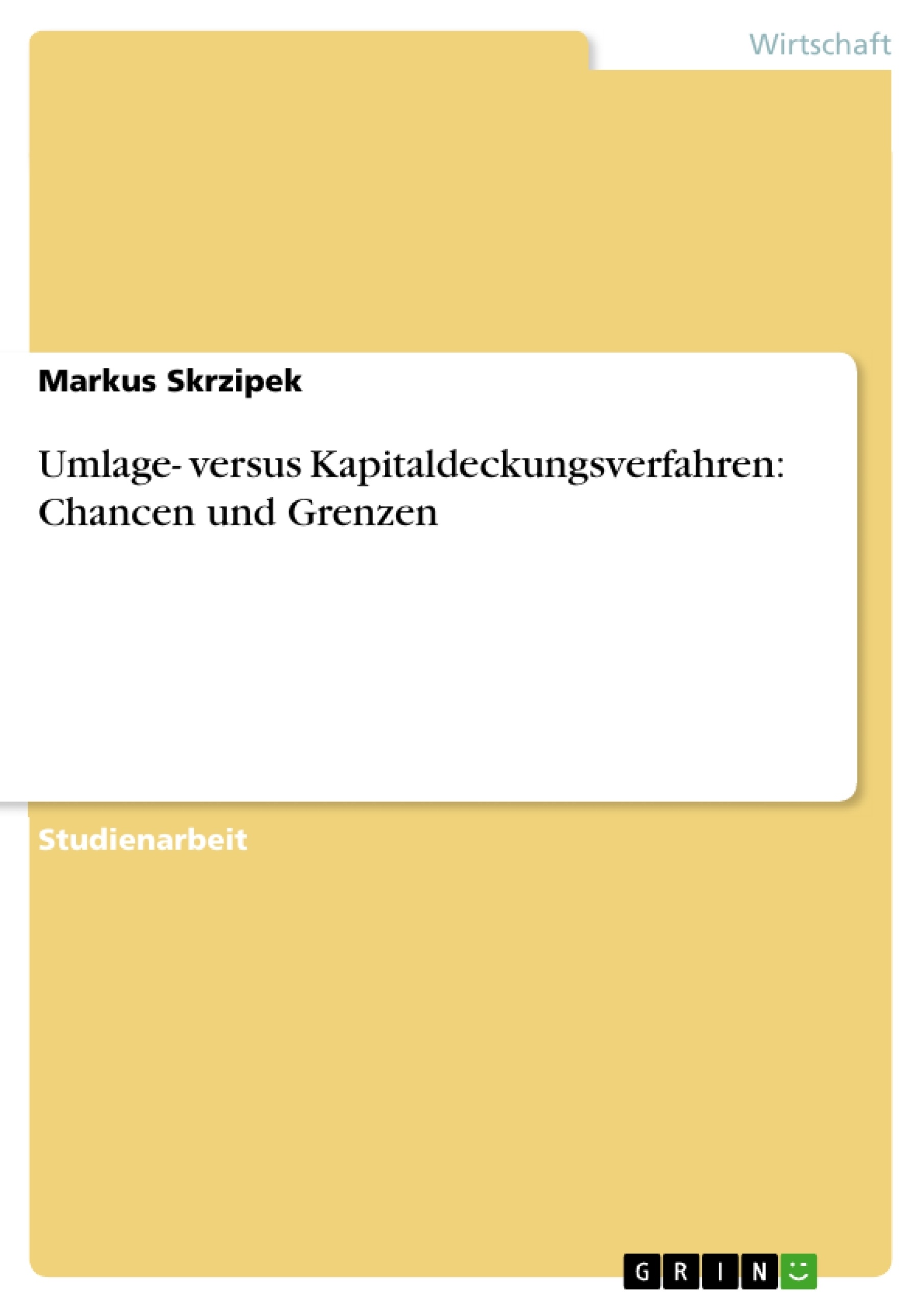Einleitung
Die Reform der sozialen Sicherungssysteme, insbesondere der gesetzlichen Rentenversicherung, wird auch in den kommenden Jahren immer wieder im Mittelpunkt der politischen und wirtschafts-wissenschaftlichen Debatte stehen. Zur Bewältigung der akuten
Probleme wurden bereits eine Reihe verschiedener Reformversuche unternommen.
Trotz unterschiedlicher Erfolge gehen weder Politiker noch Ökonomen davon aus, dass diese Schritte für eine langfristige Konsolidierung ausreichend sind. Es liegt daher die Frage nahe, ob die Probleme durch einen grundlegenden Systemwechsel besser gelöst werden können. Die ideologische Zuspitzung der Debatte auf die Systemfrage, ob und
in welchem Umfang das jetzige Umlageverfahrens durch ein kapitalgedecktes System ersetzt werden soll, hilft die Grundpositionen besser zu verstehen. Für eine komplexe
Materie, wie die der zukünftigen Gestaltung unseres Rentensystems, und der Frage, ob eine prinzipielle Abkehr vom Generationenvertrag zu bejahen sei, ist dies der Diskussion durchaus dienlich. Welche Chancen hat eine derartige Umstellung und wo sind ihre Grenzen? Die aktuellen Reformpläne von Riester können als eine Mischform beider
Verfahren angesehen werden: Einerseits wird das Umlageverfahren grundsätzlich beibehalten, andererseits wird eine private, kapitalgedeckte Zusatzversorgung als weitere Säule der Alterssicherung geschaffen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Systemtheoretische Grundlagen
- 2.1 Das Umlageverfahren
- 2.1.1 Darstellung
- 2.1.2 Chancen und Risiken
- 2.2 Das Kapitaldeckungsverfahren
- 2.2.1 Darstellung
- 2.2.2 Chancen und Risiken
- 2.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Verfahren
- 2.4 Rentabilitätsvergleiche beider Verfahren
- 2.1 Das Umlageverfahren
- 3 Der Übergang vom Umlage- zum Kapitaldeckungsverfahren
- 3.1 Hauptgründe für einen Übergang in Deutschland
- 3.2 Umstiegs- und Übergangsproblematik
- 3.2.1 Modelltheoretische Diskussion eines Pareto-Superioren Übergangs
- 3.2.2 Finanzielle Hindernisse
- 3.2.3 Problematik der politischen Durchsetzbarkeit
- 4 Möglichkeiten des Übergangs
- 4.1 Übergangsszenarien
- 4.1.1 Teilweiser Übergang
- 4.1.2 Vollständiger Übergang
- 4.2 Das Modell Chile
- 4.2.1 Entstehung und Funktionsweise
- 4.2.2 Übergangszeit und Ergebnisse
- 4.3 Ein möglicher Übergangs Vorschlag für Deutschland
- 4.1 Übergangsszenarien
- 5 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Vor- und Nachteile des Umlage- und des Kapitaldeckungsverfahrens in der gesetzlichen Rentenversicherung. Sie analysiert die Herausforderungen eines Übergangs vom Umlage- zum Kapitaldeckungsverfahren, beleuchtet wirtschaftstheoretische Aspekte und untersucht praktische Beispiele wie das chilenische Modell. Die Zielsetzung besteht darin, ein umfassendes Verständnis der Systematik beider Verfahren und der Implikationen eines Systemwechsels zu vermitteln.
- Vergleich des Umlage- und Kapitaldeckungsverfahrens
- Analyse der Herausforderungen beim Systemwechsel
- Wirtschaftstheoretische Betrachtung des Übergangs
- Bewertung des chilenischen Modells als Beispiel
- Diskussion möglicher Übergangsszenarien für Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Problematik der Rentenreform und den damit verbundenen Debatten um Umlage- und Kapitaldeckungsverfahren ein. Sie betont die Notwendigkeit einer grundlegenden Auseinandersetzung mit den jeweiligen Chancen und Grenzen beider Systeme und positioniert die Arbeit als Beitrag zu diesem Diskurs. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit, die aktuelle Debatte zu verstehen und die Vor- und Nachteile beider Systeme zu analysieren, um die zukünftige Gestaltung des Rentensystems besser zu verstehen. Die Arbeit kündigt die systematische Darstellung beider Verfahren, einen Vergleich ihrer Rentabilität und die Analyse der Übergangsproblematik an.
2 Systemtheoretische Grundlagen: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Darstellung des Umlage- und des Kapitaldeckungsverfahrens. Es erläutert die Funktionsweise des Umlageverfahrens, basierend auf dem Modell der überlappenden Generationen ("Generationenvertrag"), und untersucht dessen Chancen und Risiken, insbesondere im Hinblick auf demografische Entwicklung und politische Einflüsse. Das Kapitel analysiert parallel dazu das Kapitaldeckungsverfahren, seine marktwirtschaftliche Ausrichtung und die damit verbundenen Risiken und Chancen, einschließlich der Volatilität der Kapitalmärkte. Schließlich werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Verfahren herausgearbeitet und ein Rentabilitätsvergleich durchgeführt.
3 Der Übergang vom Umlage- zum Kapitaldeckungsverfahren: Dieses Kapitel befasst sich mit den Gründen für einen möglichen Systemwechsel in Deutschland. Es untersucht die wirtschaftstheoretischen Herausforderungen eines solchen Übergangs, insbesondere die Frage nach der Möglichkeit eines Pareto-optimalen Übergangs. Finanzielle Hindernisse und die politische Durchsetzbarkeit eines solchen Wechsels werden detailliert analysiert. Die Komplexität des Problems und die Kontroversen in der wissenschaftlichen Debatte werden deutlich gemacht.
4 Möglichkeiten des Übergangs: Das Kapitel erörtert verschiedene Szenarien für einen Übergang vom Umlage- zum Kapitaldeckungsverfahren, unter Berücksichtigung von teilweisen und vollständigen Übergängen. Es analysiert das chilenische Modell als ein Beispiel für einen erfolgreichen Systemwechsel und diskutiert die Übertragbarkeit dieses Modells auf den deutschen Kontext. Die Unterschiede zwischen den politischen und wirtschaftlichen Bedingungen Chiles und Deutschlands werden berücksichtigt, um die Herausforderungen eines deutschen Systemwechsels zu beleuchten. Es wird ein möglicher Übergangs Vorschlag für Deutschland unter differierenden Rahmenbedingungen vorgestellt.
Schlüsselwörter
Umlageverfahren, Kapitaldeckungsverfahren, Rentenversicherung, Generationenvertrag, demografischer Wandel, Systemwechsel, Übergangsproblematik, Pareto-Optimalität, Chile-Modell, finanzielle Hindernisse, politische Durchsetzbarkeit, Rentenreform.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Übergang vom Umlage- zum Kapitaldeckungsverfahren in der Rentenversicherung
Was ist der zentrale Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument analysiert den Übergang vom Umlage- zum Kapitaldeckungsverfahren in der gesetzlichen Rentenversicherung. Es vergleicht beide Systeme, untersucht die Herausforderungen eines Systemwechsels und diskutiert mögliche Übergangsszenarien, unter Berücksichtigung wirtschaftstheoretischer Aspekte und anhand von Beispielen wie dem chilenischen Modell.
Welche Verfahren werden verglichen?
Das Dokument vergleicht das Umlageverfahren und das Kapitaldeckungsverfahren der Rentenversicherung. Es beschreibt detailliert die Funktionsweise beider Systeme, ihre jeweiligen Chancen und Risiken, sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
Welche Aspekte des Umlageverfahrens werden behandelt?
Der Text beschreibt das Umlageverfahren als „Generationenvertrag“, untersucht seine Darstellung, Chancen und Risiken, berücksichtigt demografische Entwicklungen und politische Einflüsse. Die Rentabilität wird im Vergleich zum Kapitaldeckungsverfahren analysiert.
Welche Aspekte des Kapitaldeckungsverfahrens werden behandelt?
Das Kapitaldeckungsverfahren wird als marktwirtschaftlich ausgerichtetes System dargestellt. Der Text analysiert seine Funktionsweise, Chancen und Risiken (insbesondere die Volatilität der Kapitalmärkte) und vergleicht seine Rentabilität mit dem Umlageverfahren.
Warum wird der Systemwechsel diskutiert?
Der Systemwechsel wird aufgrund der Herausforderungen durch den demografischen Wandel und der damit verbundenen finanziellen Belastung des Umlageverfahrens diskutiert. Das Dokument untersucht die Hauptgründe für einen möglichen Übergang in Deutschland.
Welche Herausforderungen bei einem Systemwechsel werden angesprochen?
Die Herausforderungen umfassen die wirtschaftstheoretische Problematik eines Pareto-optimalen Übergangs, finanzielle Hindernisse und die politische Durchsetzbarkeit eines solchen Wechsels. Die Komplexität und die Kontroversen in der wissenschaftlichen Debatte werden hervorgehoben.
Welche Übergangsszenarien werden betrachtet?
Das Dokument erörtert verschiedene Übergangsszenarien, von teilweisen bis zu vollständigen Übergängen. Es analysiert das chilenische Modell als Beispiel für einen erfolgreichen Systemwechsel und diskutiert dessen Übertragbarkeit auf den deutschen Kontext unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Rahmenbedingungen.
Welche Rolle spielt das chilenische Modell?
Das chilenische Modell dient als Fallstudie, um einen erfolgreichen Systemwechsel zu veranschaulichen. Der Text analysiert dessen Entstehung, Funktionsweise, Übergangszeit und Ergebnisse, und vergleicht die Bedingungen in Chile mit denen in Deutschland.
Gibt es einen konkreten Vorschlag für Deutschland?
Ja, das Dokument präsentiert einen möglichen Übergangs-Vorschlag für Deutschland, der jedoch unter verschiedenen Rahmenbedingungen differiert werden muss.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Umlageverfahren, Kapitaldeckungsverfahren, Rentenversicherung, Generationenvertrag, demografischer Wandel, Systemwechsel, Übergangsproblematik, Pareto-Optimalität, Chile-Modell, finanzielle Hindernisse, politische Durchsetzbarkeit, Rentenreform.
- Quote paper
- Markus Skrzipek (Author), 2001, Umlage- versus Kapitaldeckungsverfahren: Chancen und Grenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2294