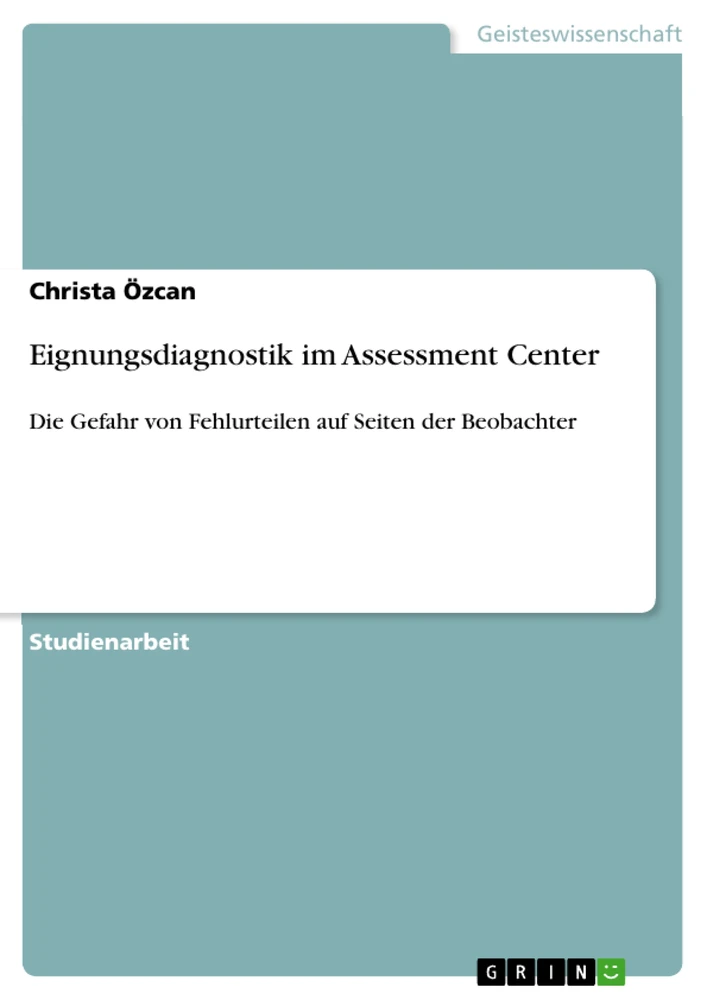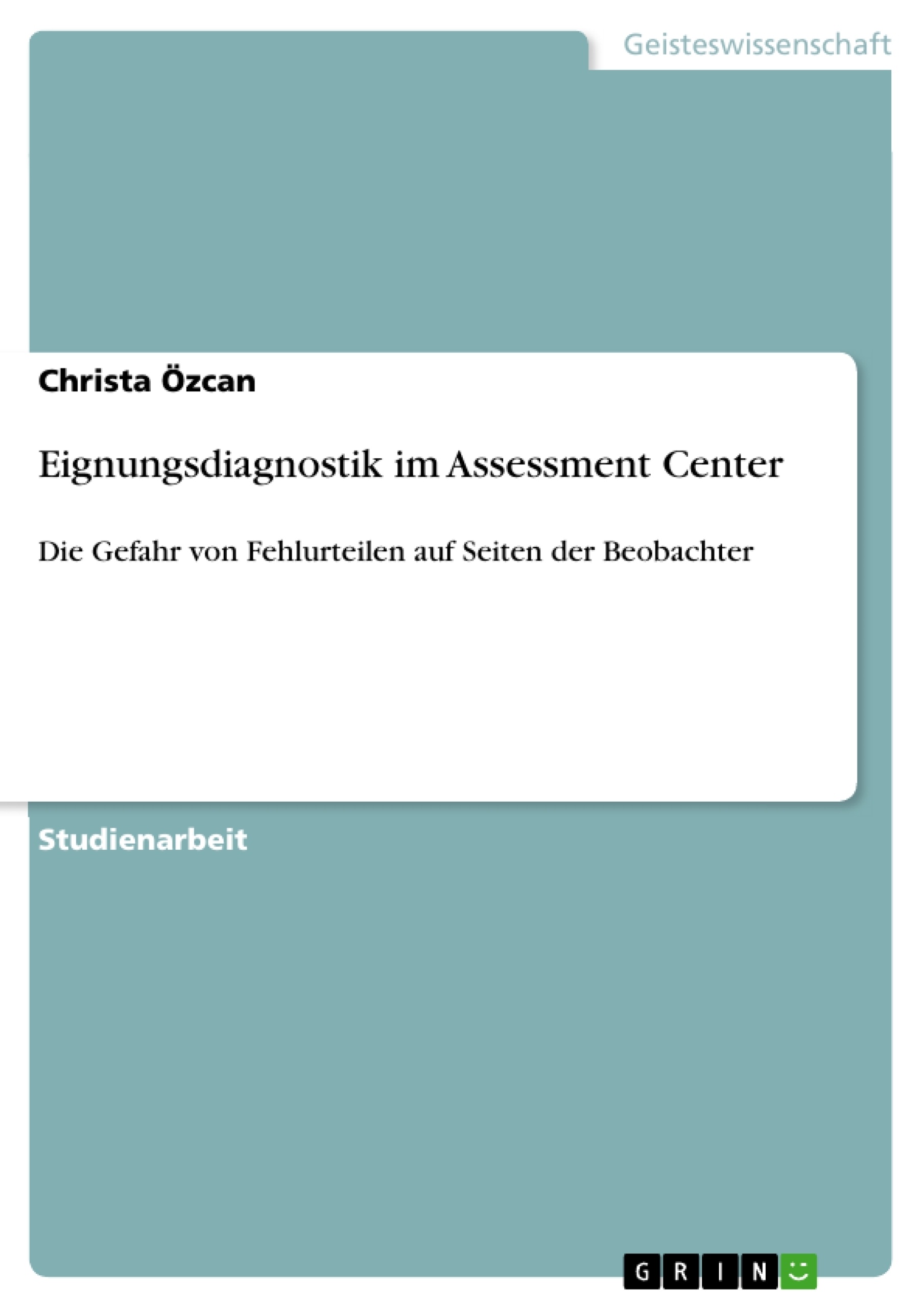2. Einleitung
Die Personalbeschaffung bedeutet für Unternehmen stets eine Investition in monetärer und nicht-monetärer Hinsicht. Das Risiko wird umso größer, dass aus der Neueinstellung eines Mitarbeiters eine Fehlinvestition wird, wenn das vorgeschaltete AC für die Bewerberauswahl auf Grund von Fehlurteilen den falschen Kandidaten auswählt. Neben den Gehalts-, Rekrutierungs-, Einarbeitungs-, oder Entlassungskosten, die auf das Unternehmen zukommen, kann durch eine Fehlbesetzung auch ein wirtschaftlicher Schaden entstehen (Obermann, 2009). Mitarbeiter, die unmotiviert / überfordert sind, innerlich gekündigt haben, werden
i. d. R. nicht die gewünschte Leistung erbringen, weisen einen höheren Krankheitsstand auf, können für Umsatzeinbußen sorgen und das Unternehmen nach kurzer Zeit wieder verlassen oder gekündigt werden. Die Konsequenz für den Mitarbeiter kann eine erschwerte Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt sein und das Unternehmen hat neben dem finanziellen Schaden, den Verlust von Human Capital hinzunehmen. Wissen, das dem Mitarbeiter vermittelt wurde, verlässt das Unternehmen und muss mit weiterem Aufwand erneut vermittelt werden.
Umso größer wird die Bedeutung von Personalentscheidungsinstrumenten und deren richtige Anwendung, die die unerwünschten Folgen sowohl für das Unternehmen als auch für den Bewerber minimieren.
Das AC hat gegenüber den alternativen Instrumenten der Personalauswahl – Bewerbungsgespräche, Einstellungstests - den Vorteil, dass es eine höhere Treffsicherheit bei Personalentscheidungen bietet. Die ein – oder mehrtägigen Testphasen bieten eine bessere Möglichkeit, den Bewerber zu beurteilen. Sowohl der Arbeitsstil, als auch sein Verhalten in Gesprächen oder in simulierten Testsituationen sind dem konventionellen Bewerbungsinterview in seiner Aussagekraft überlegen (Obermann, 2009).
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Einleitung
- Zentrale Erkenntnisse über den Einfluss von Merkmalen beobachteter Personen bei der Einschätzung anderer
- Aspekt 1: Einfluss von äußeren Merkmalen
- Aspekt 2: Einfluss von nonverbalen Merkmalen
- Begriffserklärung AC
- Entstehungsgeschichte
- Begriffsdefinition
- Das AC – ein eignungsdiagnostisches Instrument
- Gefahr von Fehlurteilen im AC auf Grund beobachteter Personenmerkmale
- Wahrnehmungsprozess bei der Urteilsbildung und deren Verzerrung
- Urteilsverzerrung durch Voreinstellungen des Beobachters
- Urteilsverzerrung bei beobachtbaren Merkmale
- Handlungsempfehlung für die Durchführung von AC
- Aufgaben der Beobachter
- Beobachtung und Bewertung
- Beobachterauswahl / -zusammensetzung
- Beobachtertraining
- Ein Trainingsdurchgang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit setzt sich zum Ziel, ausgewählte Aspekte der Gefahren von Fehlurteilen im Assessment Center (AC) zu beleuchten und mögliche Maßnahmen zur Vermeidung oder Reduzierung von Beobachtungs- und Beurteilungsfehlern zu identifizieren. Dabei werden zunächst der Nutzen eines AC sowie potenzielle negative Folgen bei Fehlentscheidungen im Auswahlprozess erläutert. Anschließend werden zentrale Erkenntnisse zum Einfluss von Merkmalen der beobachteten Person auf die Beurteilung durch den Beobachter dargestellt und das AC als Instrument der Eignungsdiagnostik beschrieben.
- Der Einfluss von Merkmalen der beobachteten Person auf die Wahrnehmung und Beurteilung
- Die Gefahr von Fehlurteilen in Assessment Centern
- Mögliche Verzerrung von Urteilen durch Voreinstellungen des Beobachters
- Die Bedeutung der Beobachterauswahl und -qualifikation
- Handlungsempfehlungen zur Minimierung von Fehlentscheidungen im AC-Prozess
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Zusammenfassung gibt einen Überblick über die wichtigsten Punkte der Arbeit, die den Fokus auf Fehlurteile im AC legen.
- Die Einleitung stellt den Nutzen eines ACs dar, aber auch die möglichen Folgen bei Fehlentscheidungen.
- Das dritte Kapitel geht auf die zentralen Erkenntnisse des Einflusses von Merkmalen beobachteter Personen bei der Einschätzung anderer ein.
- Das vierte Kapitel beschreibt das Assessment Center als ein eignungsdiagnostisches Instrument und beleuchtet seine Entstehungsgeschichte, Begriffsdefinition und Anwendung.
- Im fünften Kapitel werden die Gefahren von Fehlurteilen im AC aufgezeigt. Zwei Beispiele für Urteilsverzerrung werden näher betrachtet, der Halo-Effekt und der Similar-to-me-Effekt.
- Das sechste Kapitel beinhaltet Handlungsempfehlungen für Gegenmaßnahmen zur Minimierung von Fehlurteilen im AC-Prozess. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Aufgaben der Beobachter, der Beobachtung und Bewertung, der Beobachterauswahl und -zusammensetzung sowie dem Beobachtertraining.
Schlüsselwörter
Assessment Center, Eignungsdiagnostik, Fehlurteile, Beobachtungsfehler, Beurteilungsfehler, Halo-Effekt, Similar-to-me-Effekt, Beobachtertraining, Objektivität, Validität, Anforderungskriterien, Verhaltensbeobachtung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Assessment Center (AC)?
Ein AC ist ein eignungsdiagnostisches Instrument zur Personalauswahl, bei dem Bewerber über ein oder mehrere Tage in verschiedenen Simulationen und Tests beobachtet werden.
Warum sind Fehlentscheidungen im AC so teuer?
Fehlbesetzungen führen zu hohen Rekrutierungs-, Einarbeitungs- und Entlassungskosten sowie zum Verlust von Human Capital und potenziellen Umsatzeinbußen.
Was ist der Halo-Effekt?
Dabei überstrahlt ein einzelnes Merkmal (z.B. Attraktivität) alle anderen Eigenschaften eines Bewerbers, was zu einer verzerrten und oft zu positiven Gesamtbeurteilung führt.
Was besagt der Similar-to-me-Effekt?
Beobachter neigen dazu, Bewerber positiver zu bewerten, die ihnen in Aussehen, Herkunft oder Einstellungen ähnlich sind.
Wie kann man Beurteilungsfehler im AC minimieren?
Durch eine sorgfältige Beobachterauswahl, den Einsatz von mehreren Beobachtern pro Bewerber und ein intensives Beobachtertraining zur Sensibilisierung für Wahrnehmungsfehler.
- Quote paper
- Christa Özcan (Author), 2013, Eignungsdiagnostik im Assessment Center, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229405