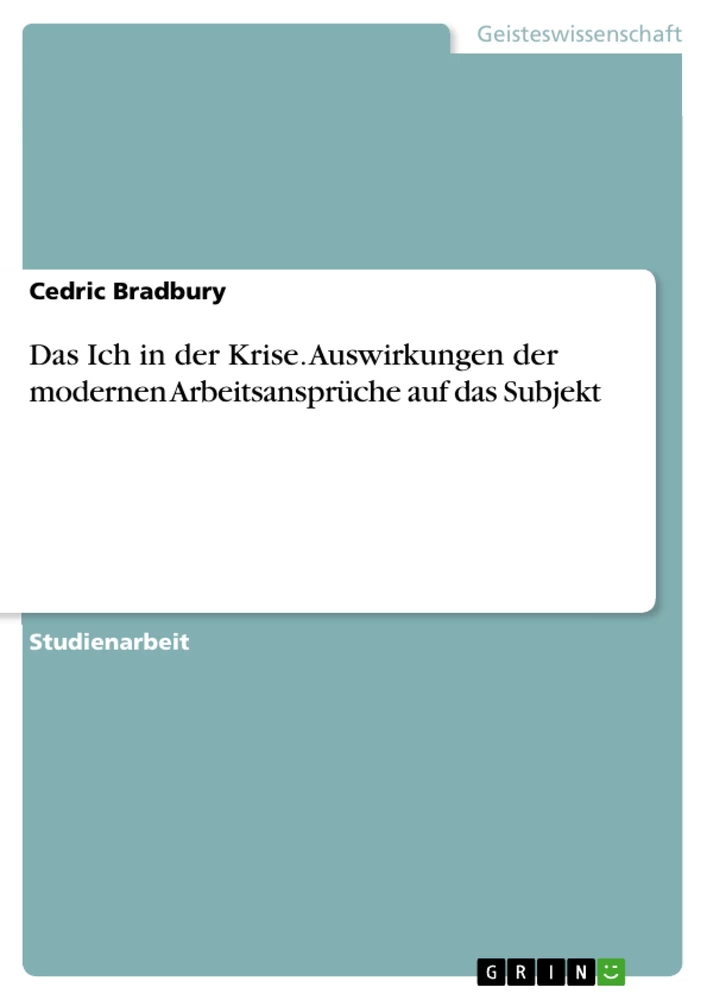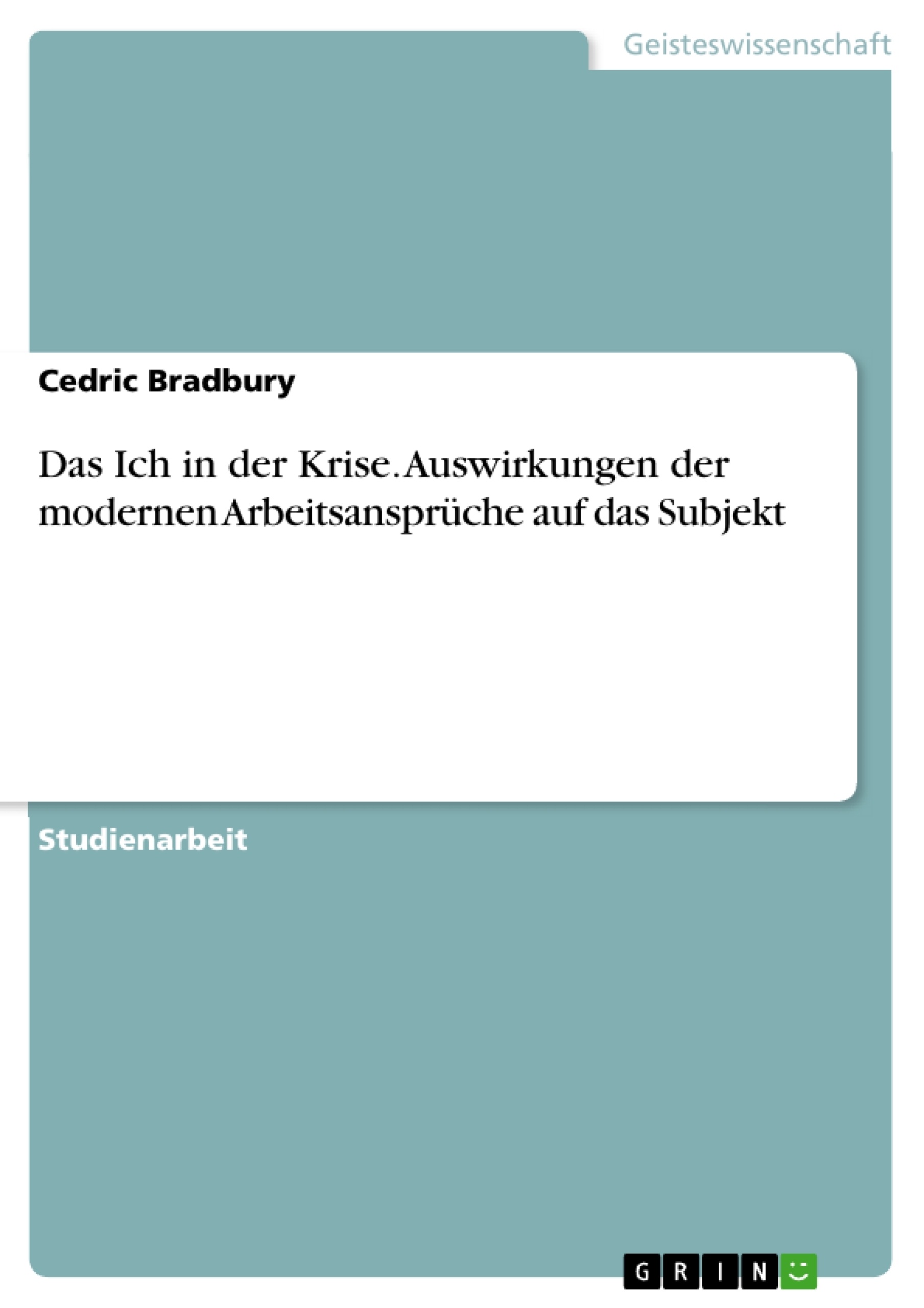Es ist absehbar, dass die Flüchtigkeit der Arbeitsverhältnisse in Zukunft zunehmen wird. Daran ist auf Grund fortschreitender Massenkommunikation und unbestreitbarer Effektivität von Arbeitsteilung wohl nicht zu rütteln. Um dennoch einen starken Charakter der Subjekte gewährleisten, sowie dem Gefühl innerer Leere und Bestimmungslosigkeit entgegenwirken zu können, bedarf es sowohl einen Wandel der Ansprüche der Arbeitswelt sowie auch der Schwerpunktsetzung des Arbeitnehmers, beziehungsweise des Subjektes.
Zum einem muss das Subjekt sich Freiräume erkämpfen und schaffen. Es muss erkennen, der finanziellen Sicherheit und nicht der Bestimmung wegen zu arbeiten; arbeiten um zu leben und nicht leben um zu arbeiten. Zum anderem muss auch das Wirtschaftssystem seinen Beitrag zur Verbesserung geistiger und emotionaler Lebensräume leisten. Es muss Freiräume zustande kommen lassen in dem es zum Beispiel Lücken oder `nicht-qualifizierende ́ Episoden, also Zeiträume individueller, alternativer Lebensgestaltung zulässt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Arbeitsverhältnisse im Wandel der Zeit
- Charakterschwäche als Konsequenz flüchtiger Arbeitsverhältnisse
- Individualisierung im Konflikt zur Fremdbestimmung durch die Konsumindustrie
- Paradoxien der Individualisierung
- Zwischenfazit
- Positive Selbstbeziehung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der modernen Arbeitsverhältnisse auf das Subjekt, insbesondere im Kontext des neuen Kapitalismus. Sie analysiert die Entwicklung vom Fordismus zum flexiblen Arbeitssystem und die damit verbundenen Veränderungen in den Anforderungen an das Arbeitssubjekt. Die Arbeit zielt darauf ab, die Herausforderungen für das geistige Wohl des Arbeitssubjektes im Spannungsfeld zwischen Individualisierung und Fremdbestimmung durch die Konsumindustrie aufzuzeigen.
- Wandel der Arbeitsverhältnisse vom Fordismus zum neuen Kapitalismus
- Auswirkungen der Flexibilisierung auf das Subjekt und seinen Charakter
- Paradoxien der Individualisierung und die Folgen für die Selbstverwirklichung
- Die Bedeutung von stabilen Sozialkontakten für eine positive Selbstbeziehung
- Die Herausforderungen für das geistige Wohl des Arbeitssubjektes im Kontext des neuen Kapitalismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung und den Fokus der Arbeit dar, die sich mit dem geistigen Zustand des Subjektes in Folge moderner Arbeitserwartungen und -verhältnisse beschäftigt. Die Arbeit greift die Überlegungen Richard Sennetts auf, der in seinem Buch "Der flexible Mensch - Die Kultur des neuen Kapitalismus" die Stressoren für das Arbeitssubjekt in der modernen Wirtschaft analysiert. Im zweiten Kapitel wird die Entwicklung vom Fordismus hin zum aktuellen Wirtschaftssystem dargestellt, wobei die mit ihr in Wechselwirkung stehenden geistigen Strömungen, insbesondere die Thematik der Individualisierung, beleuchtet werden. Das dritte Kapitel befasst sich mit den Stressoren für das Arbeitssubjekt, die aus der Flexibilisierung der Arbeitswelt resultieren.
Das vierte Kapitel widmet sich dem Spannungsfeld zwischen Individualisierung und Fremdbestimmung durch die Konsumindustrie. Es werden die Ambivalenzen des Individualisierungsprozesses und die Folgen für die persönliche Autonomie des Subjektes diskutiert. Das Zwischenfazit fasst die bisherigen Erkenntnisse zusammen und stellt die beiden zentralen Problemfelder heraus, die durch die Analyse von Sennett und Honneth deutlich werden: die Flüchtigkeit des Miteinanders und die Paradoxien der Individualisierung.
Das sechste Kapitel befasst sich mit der positiven Selbstbeziehung und der Bedeutung von stabilen Sozialkontakten für die Ich-Bildung. Honneths Anerkennungstheorie wird vorgestellt, die die Entwicklung des Ichs über drei Stufen der Verinnerlichung eines sozialen Reaktionsverhaltens erklärt. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und verdeutlicht die Herausforderungen, denen das moderne Arbeitssubjekt im Spannungsfeld zwischen Flexibilisierung, Individualisierung und Fremdbestimmung ausgesetzt ist. Es wird betont, dass sowohl der Wandel der Ansprüche der Arbeitswelt als auch die Schwerpunktsetzung des Arbeitnehmers notwendig sind, um einen starken Charakter zu gewährleisten und dem Gefühl innerer Leere und Bestimmungslosigkeit entgegenzuwirken.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den neuen Kapitalismus, die Flexibilisierung der Arbeitswelt, die Individualisierung, die Folgen für den Charakter und die Selbstbeziehung, die Herausforderungen für das geistige Wohl des Subjektes, die Bedeutung von stabilen Sozialkontakten, die Paradoxien der Individualisierung und die Notwendigkeit eines Wandels sowohl in den Ansprüchen der Arbeitswelt als auch in der Schwerpunktsetzung des Arbeitnehmers.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst der neue Kapitalismus den Charakter des Menschen?
Die Flexibilisierung und Flüchtigkeit der Arbeitsverhältnisse erschweren die Bildung eines stabilen Charakters und führen oft zu einem Gefühl der Bestimmungslosigkeit.
Was bedeutet "Flexibilisierung" nach Richard Sennett?
Sennett beschreibt damit den Wandel vom starren Fordismus zu einem System, das ständige Anpassung fordert, was soziale Bindungen und langfristige Lebensplanung untergräbt.
Was ist das Paradoxon der Individualisierung?
Während Menschen glauben, sich individuell zu verwirklichen, unterliegen sie oft einer subtilen Fremdbestimmung durch die Konsumindustrie und moderne Arbeitsansprüche.
Welche Rolle spielt Honneths Anerkennungstheorie?
Honneth zeigt auf, dass eine positive Selbstbeziehung nur durch soziale Anerkennung und stabile Sozialkontakte möglich ist, die in der modernen Arbeitswelt gefährdet sind.
Wie kann das Subjekt der "inneren Leere" entgegenwirken?
Indem es sich Freiräume erkämpft, die Arbeit als Mittel zur finanziellen Sicherheit (und nicht als einzige Bestimmung) sieht und alternative Lebensgestaltungen zulässt.
- Arbeit zitieren
- Cedric Bradbury (Autor:in), 2012, Das Ich in der Krise. Auswirkungen der modernen Arbeitsansprüche auf das Subjekt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229410