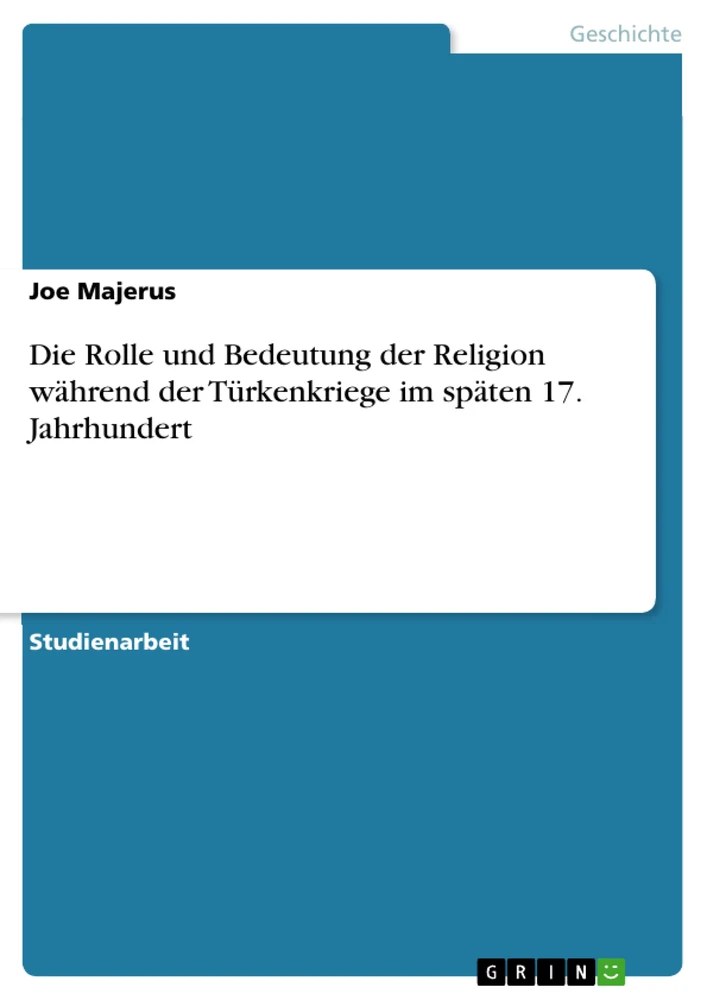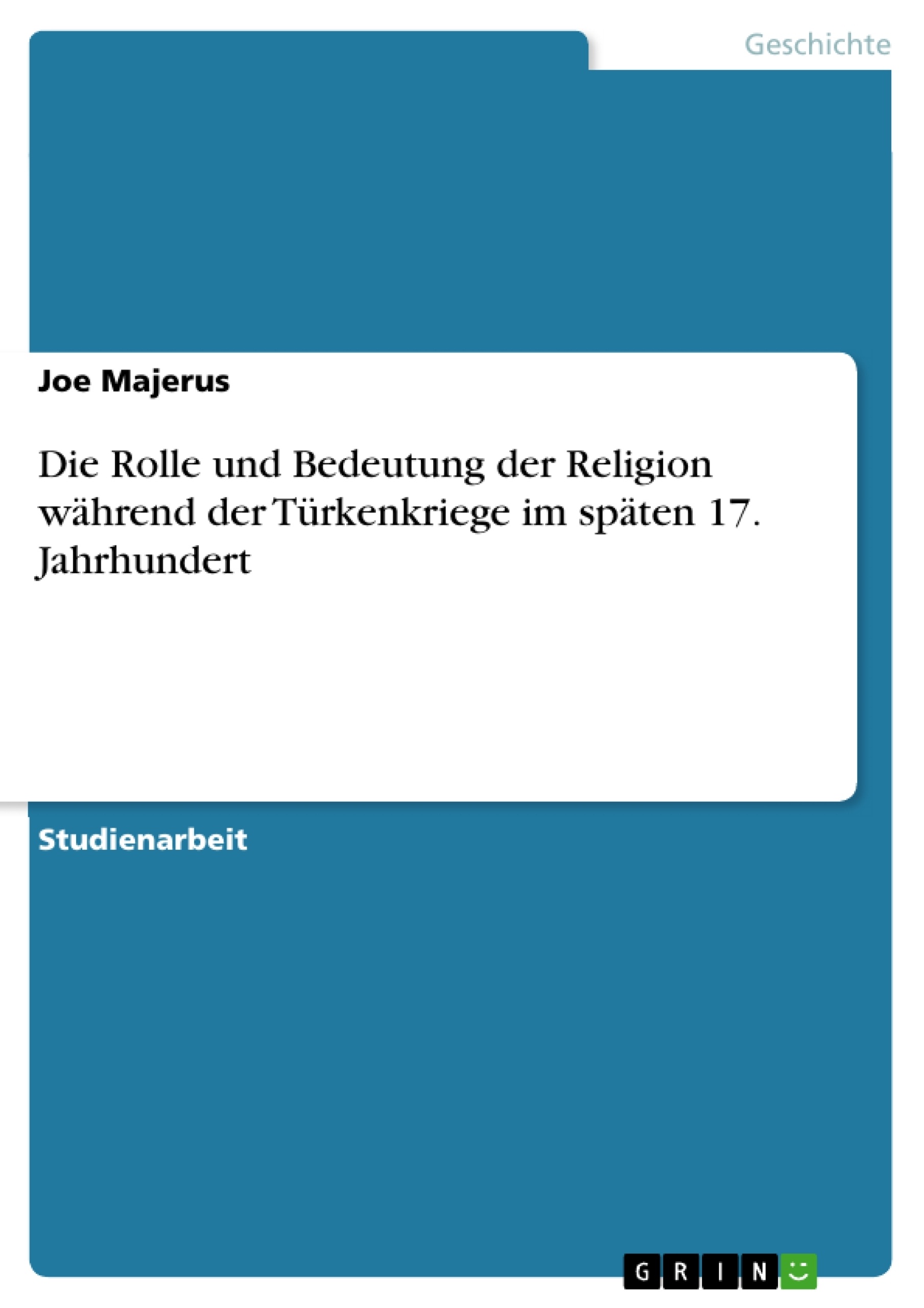Einer im akademischen Forschungsfeld der Internationalen Beziehungen fundamentalen Annahme zu Folge zeichnen sich die Interaktionen moderner Staaten innerhalb eines bestimmten Mächtesystems in erster Linie durch das ihnen vermeintlich inhärente Bestreben aus, ihre geostrategische Machtposition gegenüber den jeweiligen Rivalen auf der Basis nüchtern-rationaler Machtkalkulation abzusichern bzw. stetig auszuweiten. Demnach werden Staaten allen voran vom Imperativ realpolitischer Interessenverfolgung geleitet, im Rahmen welcher Aspekte der territorialen Integrität und des nationalen Schutzes zu den mit am wichtigsten Überlegungen gehören. Durch die äußeren Zwänge eines als anarchisch wahrgenommen Systems, in dem die internationalen Akteure formell keiner höheren, überstaatlichen und gesetzlich bindenden Justizgewalt unterstellt sind, werden zwischenstaatliche Auseinandersetzungen demnach nahezu ausschließlich vom geopolitischen Machtstreben bestimmt, während gleichsam sämtlichen, die alltägliche Machtpolitik transzendierenden Motivationen religiös oder ideologisch-ideeller Natur dabei bestenfalls eine untergeordnete Bedeutung beizumessen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Osmanische Expansion und Christentum in der Frühen Neuzeit
- Die Bedeutung der Religion währen der späteren Türkenkriege
- Der Krieg von 1663/1664
- Der Große Türkenkrieg von 1683
- Religion als indirekter casus belli: Die Freiheitsbewegung des Imre Thököly
- Das osmanische Reich
- Die Heilige Römische Reich
- Papst Innozenz XI. und „Die Heilige Liga“
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Analyse setzt sich zum Ziel, die Bedeutung religiöser Motivationen im Rahmen des europäischen Mächtesystems im späten 17. Jahrhundert zu untersuchen, insbesondere im Kontext der Auseinandersetzungen zwischen dem Habsburgerreich und dem Osmanischen Reich während der sogenannten Türkenkriege.
- Die Rolle der Religion im Spannungsfeld zwischen Realpolitik und Ideologie
- Der Einfluss religiöser Konflikte auf die politische und militärische Strategien beider Seiten
- Die Bedeutung von religiösen Beweggründen und Weltanschauungen in den Entscheidungen der Regierungsträger
- Die Auswirkungen der Türkenkriege auf die Entwicklung des europäischen Mächtesystems
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Frage nach der Bedeutung von religiösen Motiven und Beweggründen im Rahmen des europäischen Mächtesystems nach dem Westfälischen Frieden. Sie stellt die gängige Sichtweise der internationalen Beziehungen dar, die primär auf Realpolitik und Machtinteressen fokussiert, und argumentiert für die Notwendigkeit, die Rolle der Religion und Ideologie in der historischen Analyse zu berücksichtigen.
- Osmanische Expansion und Christentum in der Frühen Neuzeit: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Beziehung zwischen dem Heiligen Römischen Reich und dem Osmanischen Reich, die von einem tiefgreifenden religiösen Gegensatz geprägt war. Es betont die Bedeutung des Falls Konstantinopels im Jahr 1453 und den Einfluss der religiösen Konflikte auf die politische und militärische Entwicklung der beiden Mächte.
- Die Bedeutung der Religion währen der späteren Türkenkriege: Dieser Abschnitt analysiert die Rolle der Religion in den Türkenkriegen der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Es werden die spezifischen religiösen Beweggründe und Motive der jeweiligen Akteure im Detail beleuchtet, sowie die Auswirkungen des religiösen Konflikts auf den Verlauf und die Ergebnisse der Kriege.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Türkenkriege im späten 17. Jahrhundert, den Einfluss der Religion auf das europäische Mächtesystem, die Rolle des Habsburgerreiches und des Osmanischen Reiches, religiöse Konflikte zwischen Christentum und Islam, sowie die Bedeutung von realpolitischen und ideengeschichtlichen Überlegungen in der Außenpolitik.
- Citar trabajo
- Joe Majerus (Autor), 2013, Die Rolle und Bedeutung der Religion während der Türkenkriege im späten 17. Jahrhundert, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229453