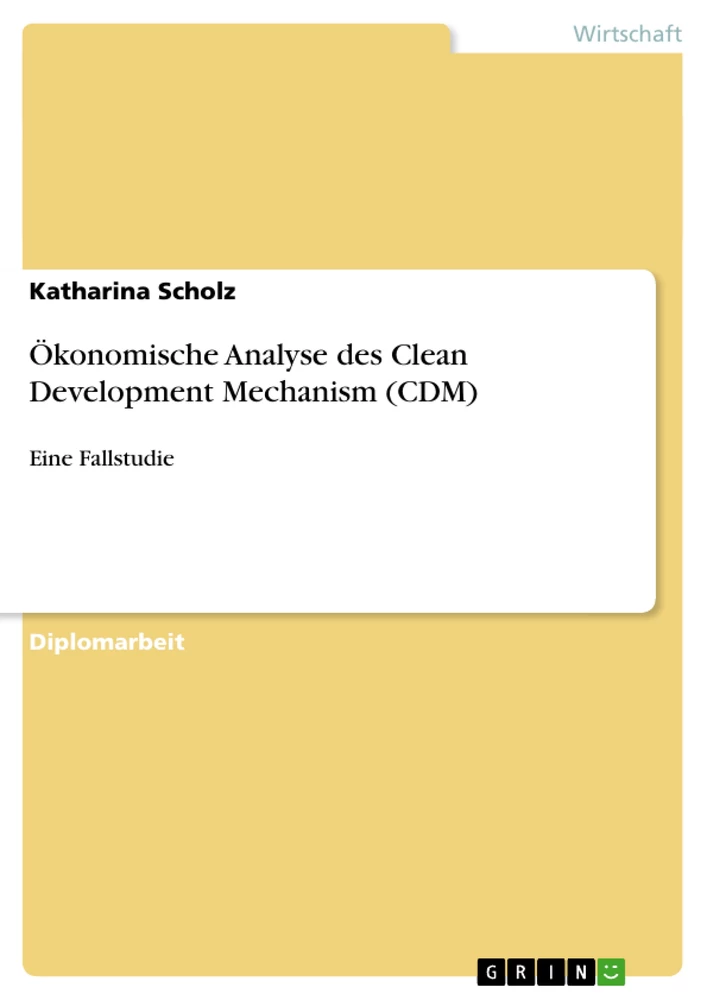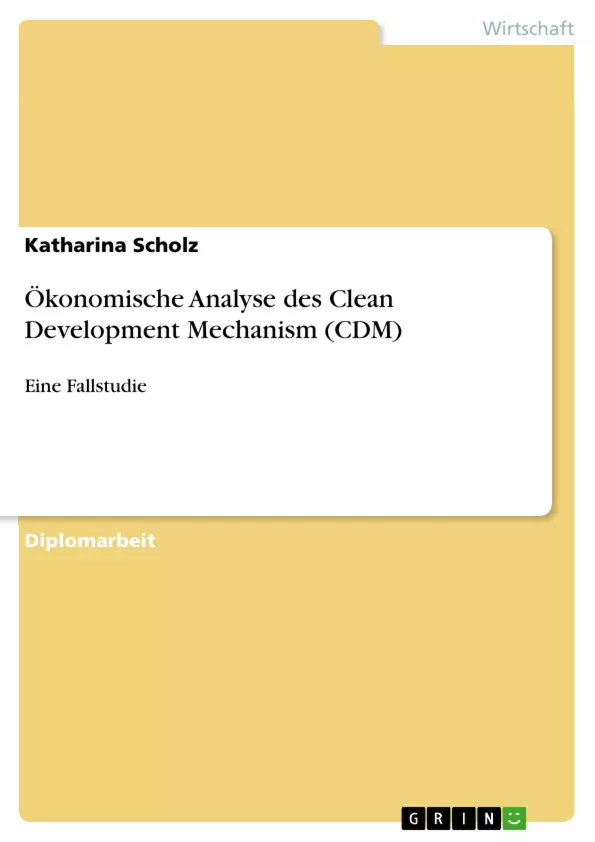„Treibhausgasemissionen sind Externalitäten und stellen das größte Markt-versagen dar, das die Welt je gesehen hat.“ (Stern, 2008, S.1)
In der Stern-Review warnt der ehemalige Weltbank-Chefökonom Sir Nicolas Stern vor den weitreichenden globalen Folgen des Klimawandels und den daraus für die Menschheit entstehenden Kosten von geschätzten 20% des globalen Bruttoinlandsprodukts. Auch die seit 1990 von der IPCC veröffentlichten Sachstandsberichte zum Thema Ursachen und Auswirkungen des anthropogenen Treibhauseffekts verdeutlichen, wie dringend weltweite Maßnahmen ergriffen werden müssen, um dem seit 1970 nachgewiesenen, anthropogen verursachten Temperaturanstieg, entgegenzuwirken. Zwar erscheinen die mitunter sehr extrem wirkenden Szenarien noch in weiter Ferne, jedoch lassen sich bereits heute die Auswirkungen des Temperaturanstiegs beobachten. Die Polkappen schmelzen, die Eisdecke in Grönland und der Arktis ist bereits dünner geworden und die Häufigkeit von Hitzewellen in Europa und Asien nimmt nachweislich zu. Jeder weitere Anstieg der Temperatur bedeutet also eine erhöhte Bedrohung für die Nahrungs- und Wasserressourcen der Menschheit. Das Thema Klimawandel ist allgegenwärtig und auch aus der aktuellen, nationalen Berichterstattung nicht mehr wegzudenken. So erfordert der geplante deutsche Atomausstieg eine Konzentration auf den Ausbau erneuerbarer Energien, wenn man an dem ehrgeizigen Ziel der Treibhausgasreduktion um 40% bis zum Jahr 2020 (im Vergleich zu 1990) festhalten will, aber gleichzeitig auch eine Einbindung des deutschen Modells in den europäischen und internationalen Kontext.
Um länderübergreifend Maßnahmen gegen den Klimawandel durchführen zu können, wurde 1992 das Rahmenübereinkommen über Klimaänderungen (UNFCCC) beschlossen. Kern der so genannten Klimarahmenkonvention ist die Verpflichtung der Industrieländer, als Hauptverursacher der steigenden Treibhausgasemissionen, Einsparungen vorzunehmen und Entwicklungsländer dabei zu unterstützen, sich an die Folgen des Klimawandels anpassen zu können.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Der anthropogene Treibhauseffekt
- 2.2 Die optimale Allokation externer Effekte
- 2.2.1 Die Umwelt als öffentliches Gut
- 2.2.2 Theoretische Lösungsansätze der Internalisierung externer Effekte
- 2.3 Das Kyoto-Protokoll und seine flexiblen Mechanismen
- 2.3.1 Emission Trading
- 2.3.2 Joint Implementation
- 2.3.3 Der Clean Development Mechanism
- 3. Der Clean Development Mechanism
- 3.1 Nachhaltige Entwicklung
- 3.2 Organisation und Projektzyklus
- 3.3 Praktische Umsetzung von CDM-Projekten
- 3.3.1 Transaktionskosten
- 3.3.2 Baseline und Zusätzlichkeit
- 3.3.3 Nachhaltige Entwicklung
- 3.3.4 Technologischer Fortschritt
- 3.3.5 Kritische Projektkategorien
- 3.3.6 Geographische Verteilung der Projekte
- 4. Umsetzung des Kyoto-Protokolls auf europäischer Ebene
- 4.1 Das EU Emissionshandelssystem
- 4.2 Die Handelsphasen des EU ETS
- 5. Umsetzung des CDM in Deutschland
- 5.1 Staatliche Institutionen
- 5.2 Umsetzung der Europäischen Richtlinien in Nationales Recht
- 5.3 Nationale Allokationspläne für Deutschland
- 5.4 Politische Einflussnahme auf die CDM-Projektaktivitäten in Deutschland
- 6. Nutzung des CDM durch Deutschland
- 6.1 Deutsche Beteiligung an CDM-Projekten
- 6.1.1 Chronologie der deutschen Beteiligungen
- 6.1.2 Geographische Verteilung der deutschen CDM-Projekte
- 6.1.3 Projektkategorien der deutschen CDM-Beteiligung
- 6.2 Einsatz von CERs durch deutsche Anlagenbetreiber
- 6.2.1 Akteure in der Nutzung von CERs in Deutschland
- 6.2.2 Geographische Herkunft der eingesetzten CERs
- 6.2.3 Projektkategorien der eingesetzten CERs
- 6.3 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Umsetzung des Clean Development Mechanism (CDM) im Rahmen des Kyoto-Protokolls, insbesondere dessen Nutzung durch Deutschland. Ziel ist es, die Rolle Deutschlands im CDM, die beteiligten Akteure und die Auswirkungen auf die nationale Klimapolitik zu analysieren.
- Der anthropogene Treibhauseffekt und die Notwendigkeit internationaler Klimaschutzmaßnahmen
- Theoretische Grundlagen der Internalisierung externer Effekte und der Marktmechanismen im Klimaschutz
- Der CDM als flexibles Mechanismus des Kyoto-Protokolls und seine praktische Umsetzung
- Die Umsetzung des CDM auf europäischer und nationaler Ebene in Deutschland
- Analyse der deutschen Beteiligung an CDM-Projekten und der Nutzung von CERs
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik des Klimawandels und der internationalen Klimaschutzbemühungen ein. Es stellt das Kyoto-Protokoll und seine flexiblen Mechanismen, insbesondere den Clean Development Mechanism (CDM), vor und skizziert die Forschungsfrage und die Struktur der Arbeit. Die Einleitung liefert den notwendigen Kontext für die nachfolgenden Kapitel und begründet die Relevanz der Thematik.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es erläutert den anthropogenen Treibhauseffekt, die Problematik externer Effekte und deren Internalisierung, sowie die Rolle der Umwelt als öffentliches Gut. Es werden verschiedene theoretische Ansätze zur Lösung des Problems der externen Effekte vorgestellt, bevor das Kyoto-Protokoll und seine flexiblen Mechanismen (Emission Trading, Joint Implementation und CDM) detailliert beschrieben werden. Das Kapitel bildet die theoretische Basis für die Analyse der praktischen Umsetzung des CDM in den folgenden Kapiteln.
3. Der Clean Development Mechanism: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Clean Development Mechanism (CDM). Es definiert nachhaltige Entwicklung im Kontext des CDM, beschreibt die Organisation und den Projektzyklus, und analysiert die praktische Umsetzung von CDM-Projekten. Dabei werden Aspekte wie Transaktionskosten, Baseline- und Zusätzlichkeitsprüfung, technologischer Fortschritt und kritische Projektkategorien detailliert betrachtet. Die geographische Verteilung der Projekte wird ebenfalls untersucht und die Bedeutung von nachhaltiger Entwicklung im Rahmen des CDM hervorgehoben. Das Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den Aufbau und die Funktionsweise des CDM.
4. Umsetzung des Kyoto-Protokolls auf europäischer Ebene: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Umsetzung des Kyoto-Protokolls, insbesondere des Emissionshandelssystems (EU ETS), auf europäischer Ebene. Es beschreibt das EU ETS im Detail, analysiert die verschiedenen Handelsphasen und deren Auswirkungen auf die Emissionsreduktion. Der Fokus liegt auf der Rolle des EU ETS als Instrument zur Erreichung der Klimaziele der Europäischen Union und auf den Herausforderungen bei der Umsetzung. Die unterschiedlichen Phasen des EU ETS werden umfassend beleuchtet, inklusive ihrer jeweiligen Auflagen und Änderungen.
5. Umsetzung des CDM in Deutschland: Dieses Kapitel untersucht die Umsetzung des CDM in Deutschland. Es beschreibt die beteiligten staatlichen Institutionen, die Umsetzung der europäischen Richtlinien in nationales Recht und die nationalen Allokationspläne. Es analysiert den Einfluss politischer Entscheidungsprozesse auf die CDM-Projektaktivitäten in Deutschland und beleuchtet die Herausforderungen und Erfolge bei der nationalen Umsetzung des CDM. Der Fokus liegt auf dem nationalen Kontext und den Besonderheiten der deutschen Klimapolitik.
6. Nutzung des CDM durch Deutschland: Dieses Kapitel analysiert die deutsche Beteiligung an CDM-Projekten und die Nutzung von Certified Emission Reductions (CERs) durch deutsche Anlagenbetreiber. Es untersucht die Chronologie der deutschen Beteiligungen, die geographische Verteilung der Projekte und die beteiligten Projektkategorien. Der Einsatz von CERs im EU ETS wird detailliert betrachtet, wobei die Akteure, die geographische Herkunft der CERs und die beteiligten Projektkategorien im Fokus stehen. Es liefert eine umfassende Darstellung der konkreten Nutzung des CDM durch deutsche Unternehmen und Institutionen.
Schlüsselwörter
Kyoto-Protokoll, Clean Development Mechanism (CDM), Emissionshandel, Zertifizierte Emissionsreduktionen (CERs), Nachhaltige Entwicklung, Klimapolitik, EU Emissionshandelssystem (EU ETS), Nationale Allokationspläne, deutsche CDM-Beteiligung, Transaktionskosten, Zusätzlichkeit, Baseline.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Umsetzung des Clean Development Mechanism (CDM) in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Umsetzung des Clean Development Mechanism (CDM) im Rahmen des Kyoto-Protokolls, insbesondere dessen Nutzung durch Deutschland. Der Fokus liegt auf der Rolle Deutschlands im CDM, den beteiligten Akteuren und den Auswirkungen auf die nationale Klimapolitik.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den anthropogenen Treibhauseffekt, die theoretischen Grundlagen der Internalisierung externer Effekte und Marktmechanismen im Klimaschutz, den CDM als flexiblen Mechanismus des Kyoto-Protokolls, dessen praktische Umsetzung auf europäischer und nationaler Ebene (insbesondere in Deutschland), sowie die Analyse der deutschen Beteiligung an CDM-Projekten und der Nutzung von CERs (Certified Emission Reductions).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) liefert den Kontext und die Forschungsfrage. Kapitel 2 (Theoretische Grundlagen) erläutert den Treibhauseffekt, externe Effekte und das Kyoto-Protokoll. Kapitel 3 (Der Clean Development Mechanism) beschreibt den CDM detailliert, inklusive seiner Organisation und Umsetzung. Kapitel 4 (Umsetzung des Kyoto-Protokolls auf europäischer Ebene) fokussiert auf das EU-Emissionshandelssystem (EU ETS). Kapitel 5 (Umsetzung des CDM in Deutschland) untersucht die nationale Umsetzung und die beteiligten Institutionen. Kapitel 6 (Nutzung des CDM durch Deutschland) analysiert die deutsche Beteiligung an CDM-Projekten und den Einsatz von CERs.
Was sind die Zielsetzungen der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Rolle Deutschlands im CDM zu analysieren, die beteiligten Akteure zu identifizieren und die Auswirkungen auf die nationale Klimapolitik zu untersuchen. Sie soll ein umfassendes Verständnis der deutschen CDM-Beteiligung und der Nutzung von CERs liefern.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Kyoto-Protokoll, Clean Development Mechanism (CDM), Emissionshandel, Zertifizierte Emissionsreduktionen (CERs), Nachhaltige Entwicklung, Klimapolitik, EU Emissionshandelssystem (EU ETS), Nationale Allokationspläne, deutsche CDM-Beteiligung, Transaktionskosten, Zusätzlichkeit und Baseline.
Wie ist der Aufbau der Arbeit strukturiert?
Die Arbeit folgt einer logischen Struktur, beginnend mit der Einleitung und den theoretischen Grundlagen, gefolgt von der Beschreibung des CDM und dessen Umsetzung auf europäischer und nationaler Ebene. Der letzte Teil analysiert die konkrete deutsche Beteiligung am CDM und den Einsatz von CERs.
Welche Aspekte der CDM-Umsetzung werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt detailliert Aspekte wie Transaktionskosten, die Baseline- und Zusätzlichkeitsprüfung von CDM-Projekten, den technologischen Fortschritt, kritische Projektkategorien, die geographische Verteilung der Projekte, die verschiedenen Handelsphasen des EU ETS und die Rolle der staatlichen Institutionen in Deutschland.
Wer sind die Akteure, die in dieser Arbeit betrachtet werden?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Akteure, darunter staatliche Institutionen auf europäischer und nationaler Ebene, deutsche Unternehmen und Anlagenbetreiber, die an CDM-Projekten beteiligt sind oder CERs einsetzen.
Welche Schlussfolgerungen werden in der Arbeit gezogen?
(Diese Frage kann nicht beantwortet werden, da die Zusammenfassung der Kapitel keine konkreten Schlussfolgerungen enthält. Diese wären im eigentlichen Text der Arbeit zu finden.)
- Arbeit zitieren
- Katharina Scholz (Autor:in), 2011, Ökonomische Analyse des Clean Development Mechanism (CDM), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229479