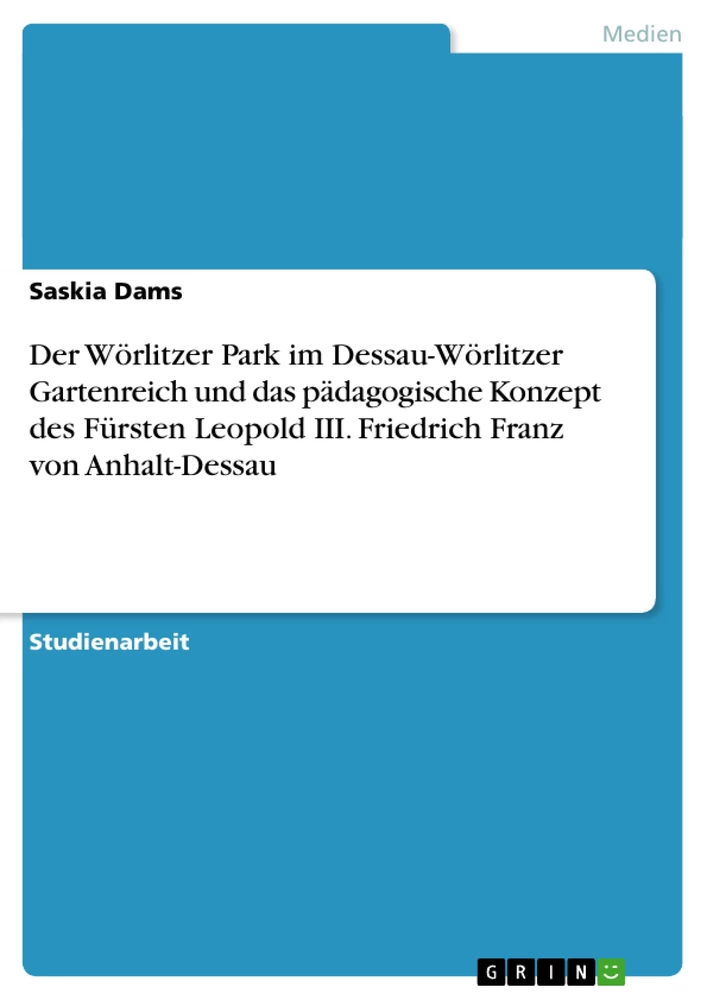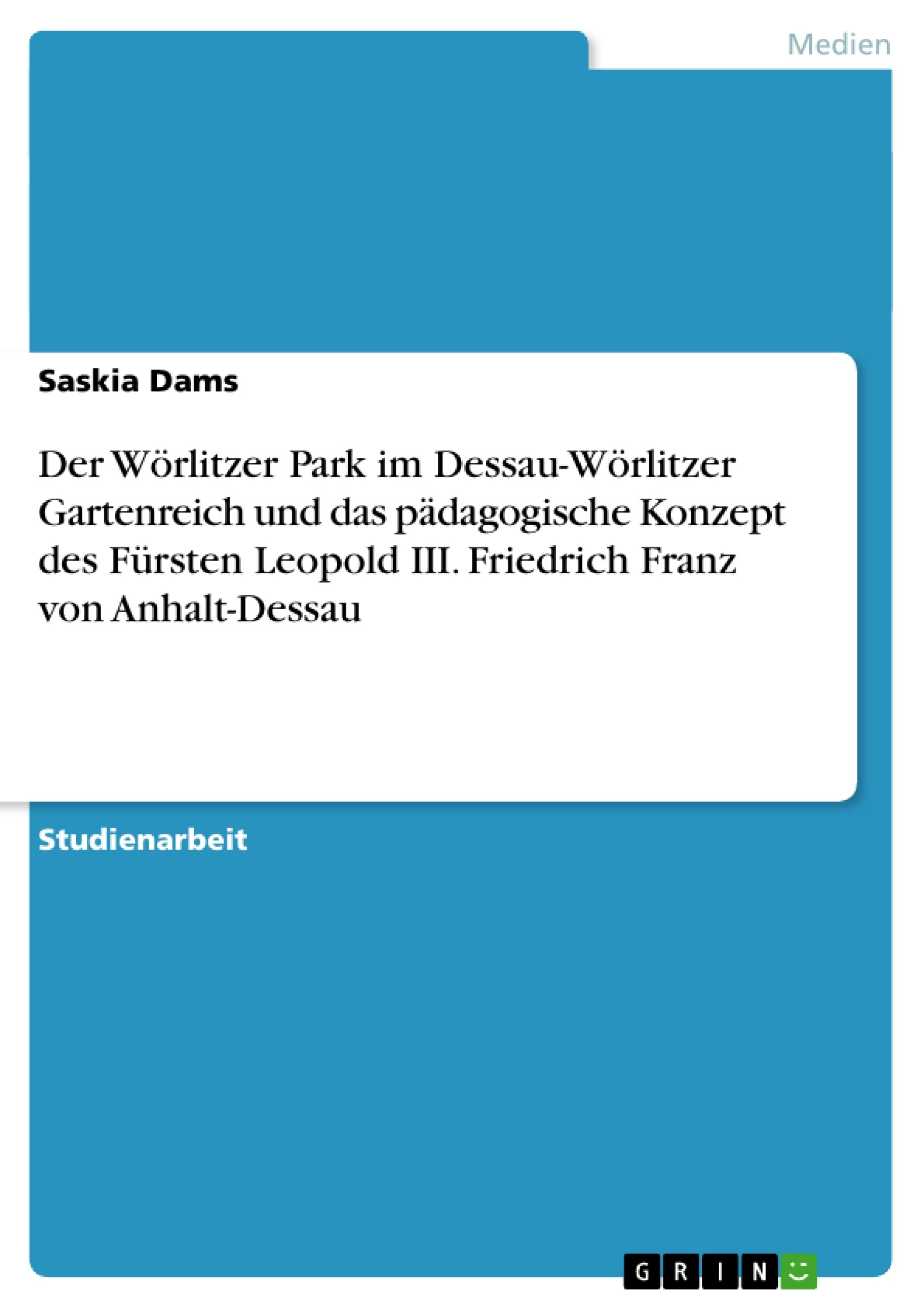Der Wörlitzer Garten im Dessau-Wörlitzer Gartenreich gilt als einer der ersten Landschaftsgärten in Deutschland. Die Entwicklung vom barocken und geometrischen Garten zum freien Landschaftsstil ist aber nicht ohne den individue llen Einfluss und Charakter der jeweiligen Herrschaft zu betrachten. Der hier nun in der einflussreichen Position stehende Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau (1740-1817) feierte seine Thronbesteigung als Achtzehnjähriger im Jahr 1758. Gleich darauf nahm er Abschied von der preußischen Armee und ließ Anhalt-Dessau für neutral erklären. Fürst Franz stellte sich dadurch gegen Friedrich II., welcher deshalb das kleine Land als eine Art Feindstaat betrachtete. Als Franz wegen einer Liebschaft nach England gehen wollte, präsentierte ihm Friedrich II. seine zukünftige Gattin, Henriette Wilhelmine Luise, Prinzessin von Brandenburg-Schwedt.1 Das Verhältnis zum kriegerisch orientierten Preußen blieb dennoch problematisch und durch mehrere Aufenthalte in Großbritannien beeinflusst, wendete sich der Fürst dem fortschrittlich bürgerlichen England zu.
Ebenfalls wichtigen Einfluss auf den Fürsten hatte der in Anhalt-Dessau herrschende reformiert calvinistische Glauben. Dieser maß die göttliche Auserwähltheit des einzelnen Menschen an der Größe seines Arbeitserfolges.2 Hiervon ausgehend kann Franz ambitionsreiches, von politischen und sozialen Reformen begleitetes Wirken im Dessau-Wörlitzer Gartenreich gedeutet werden. In dieser Arbeit soll neben Bemerkungen zur Entstehungsgeschichte des Gartens das dahinterstehende pädagogische Konzept des Fürsten erläutert werden.
1 Gartenreiches. Franz lebte in einer Art Nebenehe mit der Tochter seines Gärtners Schoch im
Gotischen Haus. Vgl. EISOLD, Norbert: Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Der Traum von der Vernunft. Rostock 2000, S. 13.
2 Vgl. EISOLD, 2000, S. 16.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bemerkungen zur Geschichte der Anlagen
- Das pädagogische Programm
- Reformen und Neuerungen
- Pädagogische Ansätze in den Anlagen
- Brückenprogramm
- Rezeptionsstadien englischer Gartenkunst
- Architekturbeispiele mit pädagogischem Ansatz
- Rousseauinsel
- Pavillons
- Der Toleranzfächer an der Goldenen Urne und die Funktion der Sichtachsen
- Felspartie
- Venustempel
- Neue Anlagen und Pantheon
- Abschlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das pädagogische Konzept des Fürsten Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau im Kontext des Wörlitzer Parks im Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Sie untersucht den Einfluss der englischen Gartenkunst und des reformiert calvinistischen Glaubens auf die Gestaltung der Anlagen und die pädagogischen Ambitionen des Fürsten.
- Die Entwicklung des Wörlitzer Parks als Landschaftsgarten und seine Abgrenzung vom barocken Gartenstil
- Der Einfluss von Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau auf die Gestaltung des Gartenreichs und die Umsetzung pädagogischer Ziele
- Die Rolle der Architektur, Skulpturen und Sichtachsen in der Vermittlung pädagogischer Botschaften
- Die Rezeption und Interpretation englischer Gartenkunst im Wörlitzer Park
- Das Konzept der „göttlichen Auserwähltheit“ und seine Verbindung zu den pädagogischen Ambitionen des Fürsten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in die Arbeit und stellt den Fokus auf das pädagogische Konzept des Fürsten Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau und seine Bedeutung im Kontext des Wörlitzer Parks dar. Das zweite Kapitel behandelt die Geschichte der Anlagen und beleuchtet die Entwicklung des Gartens von einem barocken Garten zu einem Landschaftsgarten. Dabei wird die Bedeutung der Englandreise des Fürsten und der Einfluss wichtiger Zeitgenossen wie Erdmannsdorff und Eyserbeck auf die Gestaltung des Gartenreichs hervorgehoben. Das dritte Kapitel widmet sich dem pädagogischen Programm des Fürsten. Hier werden die Reformen und Neuerungen, die pädagogischen Ansätze in den Anlagen, das Brückenprogramm und die Rezeption englischer Gartenkunst näher betrachtet. Das vierte Kapitel analysiert Architekturbeispiele mit pädagogischem Ansatz, darunter die Rousseauinsel, Pavillons, der Toleranzfächer an der Goldenen Urne, die Felspartie, der Venustempel und die neuen Anlagen und das Pantheon. Diese Kapitel beleuchten, wie der Fürst erzieherisch auf sein Land wirken wollte und welche Mittel er dafür einsetzte. Die Arbeit behandelt jedoch nicht alle in den Anlagen enthaltenen Staffagen und Plastiken im Detail, sondern beschränkt sich auf jene mit einem erkennbaren programmatischen Bezug zum Gesamtwerk.
Schlüsselwörter
Das pädagogische Konzept von Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, Wörlitzer Park, Dessau-Wörlitzer Gartenreich, englische Gartenkunst, Landschaftsgarten, Barockgarten, reformierter Calvinismus, Auserwähltheit, Architektur, Skulpturen, Sichtachsen, Brückenprogramm, Rousseauinsel, Pavillons, Toleranzfächer, Goldene Urne, Felspartie, Venustempel, Pantheon.
Häufig gestellte Fragen
Wer war der Schöpfer des Wörlitzer Parks?
Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau gestaltete den Park als einen der ersten Landschaftsgärten in Deutschland.
Was war das pädagogische Konzept hinter der Parkgestaltung?
Der Fürst wollte durch die Gestaltung des Gartens und seiner Architektur (z.B. Sichtachsen, Brückenprogramm) erzieherisch auf sein Volk wirken und Bildung sowie Aufklärung vermitteln.
Welchen Einfluss hatte der Glaube des Fürsten auf den Park?
Der reformierte Calvinismus, der Arbeitserfolg als Zeichen göttlicher Auserwähltheit sah, prägte das ambitionsreiche Wirken des Fürsten in der Gestaltung des Gartenreichs.
Welche Rolle spielte England bei der Entstehung des Parks?
Durch mehrere Aufenthalte in Großbritannien wandte sich der Fürst dem fortschrittlichen englischen Gartenstil zu und distanzierte sich vom barocken, geometrischen Stil preußischer Prägung.
Nennen Sie Beispiele für Architektur mit pädagogischem Ansatz im Park.
Dazu gehören die Rousseauinsel, der Toleranzfächer an der Goldenen Urne, der Venustempel und das Pantheon.
- Quote paper
- M.A. Saskia Dams (Author), 2003, Der Wörlitzer Park im Dessau-Wörlitzer Gartenreich und das pädagogische Konzept des Fürsten Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22948