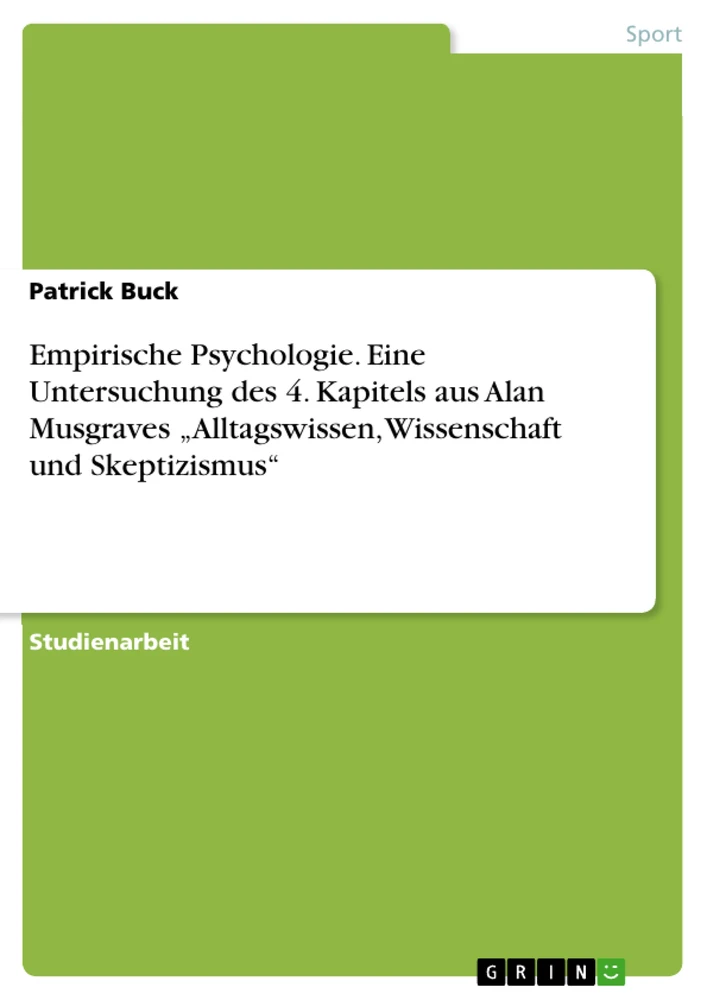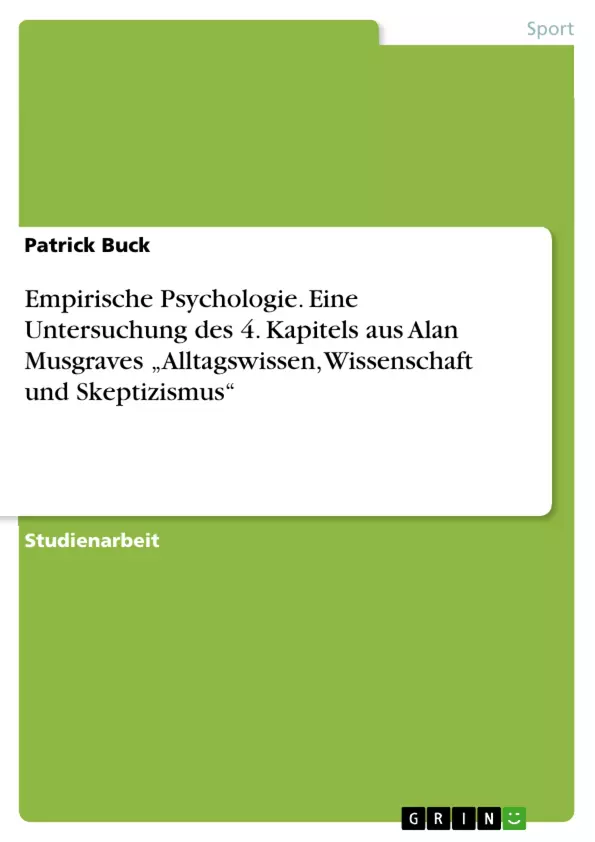Ich fasse hier das vierte Kapitel „Empirische Psychologie“ aus Alan Musgraves Buch „Alltagswissen, Wissenschaft und Skeptizismus“ zusammen. Der erst Teil dient allein diesem Zweck der inhaltlichen Kurzfassung des Textes. Im zweiten Teil werde ich einzelne wichtige Aspekte aus dem Text noch einmal aufgreifen und mit Hilfe weiterführender Literatur versuchen, diese ein wenig weiter auszuführen und zu erklären. Am Schluss werde ich noch einmal kurz meine eigene Ansicht zu der folgenden Problematik darlegen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- ZUSAMMENFASSUNG KAPITEL 4 - EMPIRISCHE PSYCHOLOGIE
- ABSCHNITT 1 - DIE KÜBEL-THEORIE DES GEISTES
- ABSCHNITT 2 - DIE TRADITION UND DIE BEDEUTUNG DER SPRACHE
- ABSCHNITT 3 - SPRACHLERNEN
- ABSCHNITT 4 - DIE ROLLe der WiederHOLUNGEN
- ABSCHNITT 5 - ANGEBORENE IDEEN ODER ANGEBORENES WISSEN?
- WEITERE ERLÄUTERUNGEN ZUM KAPITEL
- DIE KÜBELTHEORIE
- TRADITION
- SPRACHE
- ANGEBORENES WISSEN UND ANGEBORENE IDEEN
- KOMMENTAR
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem vierten Kapitel „Empirische Psychologie“ aus Alan Musgraves Buch „Alltagswissen, Wissenschaft und Skeptizismus“. Ziel ist es, den Text zusammenzufassen und wichtige Aspekte mithilfe weiterführender Literatur zu erläutern.
- Die empiristische Theorie der Bildung von Überzeugungen und das Henne-Ei-Problem.
- Die Rolle von Tradition und Sprache beim Erwerb von Wissen.
- Die Frage nach angeborenem Wissen und Ideen und deren Bedeutung für das Sprachlernen.
- Die Bedeutung von voreiligen Schlüssen und Verallgemeinerungen beim Sprachlernen.
- Die empirische Psychologie als Quelle des Wissens und der Überzeugung.
Zusammenfassung der Kapitel
Der Autor stellt die Frage, woher unser Vorwissen und unsere Überzeugungen stammen. Er diskutiert die empiristische Theorie, die besagt, dass alles Wissen aus der Erfahrung entsteht, und stellt sie der rationalistischen Theorie gegenüber, die dem Menschen angeborene Ideen zuschreibt. Musgrave verwendet das Kübel-Modell, um die empiristische Theorie zu veranschaulichen. Dabei werden Sinneseindrücke als Wasser betrachtet, das durch die Löcher des Kübels, also des menschlichen Geistes, fließt. Durch wiederholte Erfahrungen werden diese Eindrücke geordnet und dauerhaft verbunden, wodurch wir Vorhersagen treffen können.
Im zweiten Abschnitt wird die Bedeutung von Tradition und Sprache für den Erwerb von Wissen diskutiert. Locke argumentiert, dass Tradition keine unabhängige Quelle des Wissens sei, da man nie wissen könne, ob die Informationen wahr sind. Musgrave widerspricht diesem Standpunkt und argumentiert, dass Tradition eine wichtige Quelle des Wissens sein kann, wenn man die Rechtfertigung nicht zu streng nimmt.
Der Autor stellt die Frage, ob ein Blinder das Wort „rot“ verstehen kann, obwohl er die Farbe nicht sehen kann. Dies wirft die Frage auf, ob Sprache alles vermitteln kann und ob die Sprache durch Assoziation von Ideen durch Wiederholungen gelernt wird. Der Autor vertritt die These, dass Sprache durch das aktive Ziehen voreiliger Schlüsse gelernt wird.
Im dritten Abschnitt wird die empiristische Theorie des Sprachlernens betrachtet. Die Theorie, dass Sprache durch wiederholte Wahrnehmung gelernt wird, wird aufgrund der Geschwindigkeit und Komplexität des Sprachlernens in Frage gestellt. Noam Chomsky argumentierte, dass Kinder eine Art von angeborenem Sprachwissen besitzen, das für das weitere Sprachlernen eine Struktur bietet.
Der Autor betont die Bedeutung von Verallgemeinerungen und voreiligen Schlüssen beim Sprachlernen. Kinder benutzen am Anfang wenige Worte universal für all das, was dem ursprünglichen Gegenstand ähnlich sieht. Gleiches passiert beim Erlernen grammatischer Regeln.
Schlüsselwörter
Empirische Psychologie, Alltagswissen, Wissenschaft, Skeptizismus, Sinneserfahrung, Überzeugung, Tradition, Sprache, Sprachlernen, angeborene Ideen, Kübel-Theorie, voreilige Schlüsse, Verallgemeinerung, Noam Chomsky, Rationalismus, Empirismus.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die "Kübel-Theorie des Geistes"?
Diese empiristische Theorie vergleicht den Geist mit einem leeren Gefäß, in das Sinneserfahrungen wie Wasser hineinfließen. Wissen entsteht demnach ausschließlich durch die Ansammlung und Ordnung dieser Eindrücke.
Welche Rolle spielt die Sprache beim Erwerb von Wissen?
Sprache ermöglicht die Vermittlung von Tradition und Wissen über Generationen hinweg. Musgrave diskutiert, ob Sprache allein ausreicht, um Konzepte (wie Farben) zu verstehen, die man nie selbst wahrgenommen hat.
Gibt es angeborenes Wissen beim Sprachlernen?
Während Empiristen dies ablehnen, argumentieren Rationalisten und Linguisten wie Noam Chomsky, dass Kinder eine angeborene Sprachstruktur besitzen müssen, um die Komplexität der Grammatik so schnell zu erfassen.
Was sind "voreilige Schlüsse" beim Spracherwerb?
Kinder lernen Sprache oft durch aktive Verallgemeinerungen. Sie wenden gelernte Begriffe oder Regeln auf ähnliche Objekte oder Situationen an, noch bevor sie die genaue Differenzierung beherrschen.
Wie stehen Tradition und Skeptizismus zueinander?
Skeptiker bezweifeln oft Wissen, das nur auf Überlieferung basiert. Musgrave argumentiert jedoch, dass Tradition eine legitime Wissensquelle sein kann, wenn man die Anforderungen an die Rechtfertigung nicht unerfüllbar hoch ansetzt.
- Arbeit zitieren
- Patrick Buck (Autor:in), 2005, Empirische Psychologie. Eine Untersuchung des 4. Kapitels aus Alan Musgraves „Alltagswissen, Wissenschaft und Skeptizismus“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229507