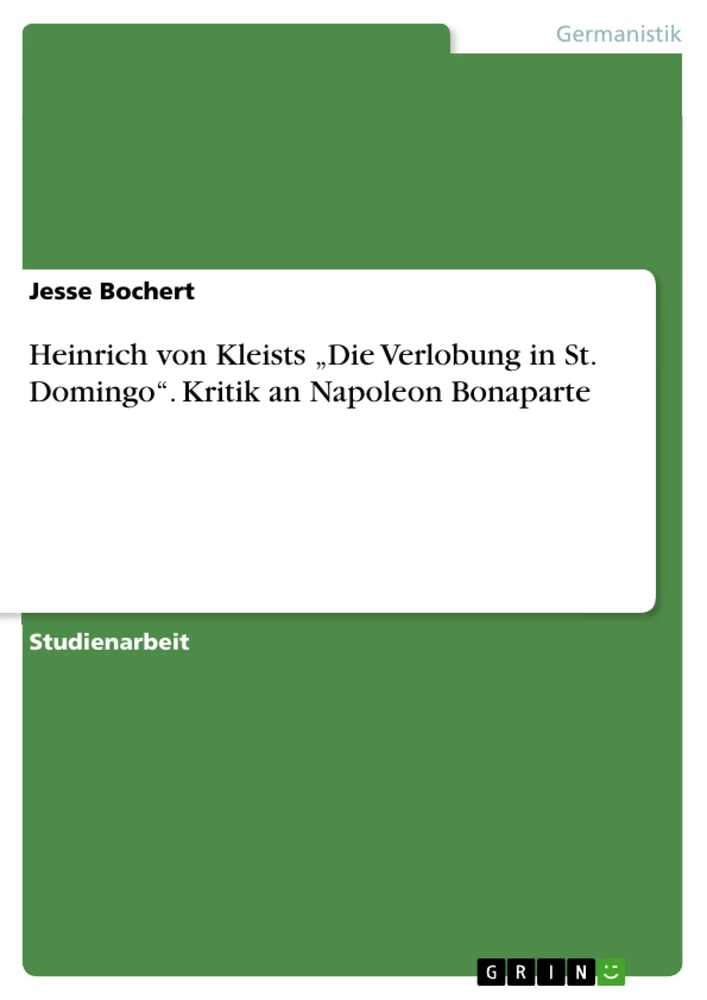Die 1811 erschienene Novelle „die Verlobung in St. Domingo“, von Heinrich von Kleist, spielt vor dem Hintergrund der Revolution auf Haiti. Durch eine, seit 1790, ausführlich stattfindende Berichterstattung, über die Verhältnisse auf Haiti, sind nicht nur Kleist, sondern auch seine Leser weitestgehend informiert. Die Erzählung von Kleist ist aber keineswegs eine historische, sondern vielmehr aufgegriffenes historisches Material zur literarischen Inszenierung eines Kampfes, bei dem es um komplizierte Beziehungen zwischen Geschlechtern, Rassen und Klassen geht. So ist Kleists Novelle auch häufig das Verhältnis von Liebe und Politik:1 „Schwarze sind dabei, Weiße zu vernichten, Neger Franzosen, Sklaven ihre Herren, Kolonisierte die Kolonisten, Untere Obere, Guerilleros Angehörige einer regulären Armee, Mandate Gesetze, die Barbarei die Zivilisation, die Französische Revolution ihre Kinder und die ‚Kinder‘ die ‚Eltern‘, vor allem aber, in einem ‚Haus‘, in dem die ‚Wildnis‘ herrscht, nicht-weiße Frauen weiße Männer.“2
Die ältere Forschung setzte Kleists Position unmittelbar mit dem Erzähler gleich, heutzutage ist es jedoch unstrittig, dass in dieser Novelle vom Erzähler eine konservative und gelegentlich rassistische Perspektive eingenommen wird, die nicht ausschließlich identisch ist mit der des Autors.3
[...]
1 Vgl. Uerlings, Herbert: Poetiken der Interkulturalität. Haiti bei Kleist, Seghers, Müller, Buch und Fichte, Tübingen 1997, S. 13.
2 Ebenda.
3 Vgl. Uerlings, Herbert: Preußen in Haiti?; In: Kreutzer, Hans Joachim: Kleist Jahrbuch 1991, Stuttgart 1991, S. 187.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Das historische Material zur literarischen Inszenierung eines Kampfes
- 2. Die französische Kolonisation in Saint Domingue und ihr geschichtlicher Hintergrund
- 3. Als die Schwarzen zur Büchse griffen
- 3.1. Der rassistische Erzähler bei Kleists „Die Verlobung in St. Domingo“
- 3.2. Der Weg von der „Schwarze Hure“ zur „Weißen Heiligen“
- 4. Wie versteckt Kleist seine Kritik an Napoleon?
- 4.1 Kleist und der „Allerwelts-Konsul“
- 4.2 Napoleon und Santo Domingo
- 4.3 Die retrospektiven Erzählungen von der Französischen Revolution
- 5. Einige Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Heinrich von Kleists Novelle „Die Verlobung in St. Domingo“ im Kontext der haitianischen Revolution und Kleists Kritik an Napoleon Bonaparte. Die Analyse fokussiert auf die strategische Nutzung einer scheinbar rassistischen Erzählerperspektive, um subversiv napoleonkritische Anspielungen in die Novelle einzubetten und Zensur zu umgehen.
- Kleists literarische Inszenierung des Kampfes auf Haiti
- Die Rolle des rassistischen Erzählers und seine Funktion in Kleists Kritik
- Der geschichtliche Hintergrund der französischen Kolonisation Saint Domingues
- Die verdeckte Kritik an Napoleon und der französischen Revolution
- Das Verhältnis von Liebe und Politik in der Novelle
Zusammenfassung der Kapitel
1. Das historische Material zur literarischen Inszenierung eines Kampfes: Dieses Kapitel untersucht die Einbettung der haitianischen Revolution in Kleists Novelle. Es wird deutlich, dass Kleist zwar historisches Material verwendet, aber keine rein historische Erzählung liefert. Stattdessen inszeniert er einen Kampf, der komplexe Beziehungen zwischen Geschlechtern, Rassen und Klassen darstellt. Die Analyse betont die Diskrepanz zwischen der scheinbar konservativen und rassistischen Perspektive des Erzählers und der möglichen Position des Autors, die Gegenstand weiterer Untersuchung ist. Die Verbindung von Liebe und Politik im Kontext des Konflikts wird hervorgehoben.
2. Die französische Kolonisation in Saint Domingue und ihr geschichtlicher Hintergrund: Dieses Kapitel liefert einen knappen Überblick über die Geschichte der französischen Kolonie Saint Domingue, von der Entdeckung durch Kolumbus bis zum Aufstand der Schwarzen. Es beschreibt die Ausbeutung durch die Kolonialmacht, den immensen Reichtum der Kolonie durch den Zuckerrohranbau und die Sklaverei, sowie die Schlüsselfiguren wie Toussaint Louverture und Dessalines. Der geschichtliche Kontext dient als Grundlage für das Verständnis von Kleists Novelle und der darin enthaltenen Kritik.
3. Als die Schwarzen zur Büchse griffen: Dieses Kapitel analysiert die rassistischen Elemente in Kleists Erzählung und deren Funktion im Kontext der napoleonkritischen Aussage. Es untersucht die Perspektive des Erzählers und seine Darstellung der beteiligten Akteure. Die Entwicklung der weiblichen Hauptfigur von einer "Schwarzen Hure" zu einer "Weißen Heiligen" wird im Detail beleuchtet, um die komplexen Machtstrukturen und die ideologischen Widersprüche aufzuzeigen.
4. Wie versteckt Kleist seine Kritik an Napoleon?: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die verdeckte Kritik an Napoleon und der französischen Revolution in Kleists Novelle. Es analysiert, wie Kleist die rassistische Erzählerperspektive benutzt, um die Zensur zu umgehen und seine politischen Ansichten zu äußern. Der Bezug zu Napoleon und seinen Aktionen in Santo Domingo wird hergestellt, ebenso wie die Einbettung der Kritik in die retrospektiven Erzählstrukturen der Novelle.
Schlüsselwörter
Heinrich von Kleist, Die Verlobung in St. Domingo, Haiti, Haitianische Revolution, Napoleon Bonaparte, Französische Revolution, Kolonialismus, Rassismus, Erzählerperspektive, Literaturkritik, politische Dekonstruktion, Zensur, Liebe und Politik.
Häufig gestellte Fragen zu Heinrich von Kleists „Die Verlobung in St. Domingo“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Heinrich von Kleists Novelle „Die Verlobung in St. Domingo“ im Kontext der haitianischen Revolution und Kleists Kritik an Napoleon Bonaparte. Der Fokus liegt auf der strategischen Verwendung einer scheinbar rassistischen Erzählerperspektive zur subversiven napoleonkritischen Aussage und zur Umgehung von Zensur.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Kleists literarische Inszenierung des Kampfes auf Haiti; die Rolle des rassistischen Erzählers und seine Funktion in Kleists Kritik; den geschichtlichen Hintergrund der französischen Kolonisation Saint Domingues; die verdeckte Kritik an Napoleon und der französischen Revolution; und das Verhältnis von Liebe und Politik in der Novelle.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Kapitel 1 untersucht die Einbettung der haitianischen Revolution in Kleists Novelle und die Diskrepanz zwischen Erzählerperspektive und möglicher Autorenposition. Kapitel 2 bietet einen Überblick über die Geschichte der französischen Kolonisation Saint Domingues. Kapitel 3 analysiert die rassistischen Elemente in der Erzählung und ihre Funktion im Kontext der napoleonkritischen Aussage. Kapitel 4 konzentriert sich auf die verdeckte Kritik an Napoleon und die Umgehung von Zensur. Kapitel 5 enthält abschließende Bemerkungen.
Wie wird Kleists Kritik an Napoleon dargestellt?
Kleist versteckt seine Kritik an Napoleon durch die strategische Nutzung einer scheinbar rassistischen Erzählerperspektive, um Zensur zu umgehen. Die Arbeit analysiert, wie diese Perspektive napoleonkritische Anspielungen in die Novelle einbettet, insbesondere im Bezug auf Napoleons Aktionen in Santo Domingo und die Einbettung der Kritik in retrospektive Erzählstrukturen.
Welche Rolle spielt der rassistische Erzähler?
Der rassistische Erzähler ist ein zentrales Element der Analyse. Seine Perspektive wird untersucht, um aufzuzeigen, wie Kleist diese scheinbar konservative Sichtweise nutzt, um subversiv seine Kritik an Napoleon und dem Kolonialismus auszudrücken. Die Entwicklung der weiblichen Hauptfigur von "Schwarzer Hure" zu "Weißer Heiliger" wird als Beispiel für die komplexen Machtstrukturen und ideologischen Widersprüche interpretiert.
Welche historischen Hintergründe werden beleuchtet?
Die Arbeit beleuchtet den historischen Hintergrund der französischen Kolonisation Saint Domingues, von der Entdeckung durch Kolumbus bis zum Aufstand der Schwarzen. Sie beschreibt die Ausbeutung, den Reichtum der Kolonie durch den Zuckerrohranbau und die Sklaverei, sowie Schlüsselfiguren wie Toussaint Louverture und Dessalines. Dieser Kontext dient dem Verständnis von Kleists Novelle und der darin enthaltenen Kritik.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Heinrich von Kleist, Die Verlobung in St. Domingo, Haiti, Haitianische Revolution, Napoleon Bonaparte, Französische Revolution, Kolonialismus, Rassismus, Erzählerperspektive, Literaturkritik, politische Dekonstruktion, Zensur, Liebe und Politik.
- Quote paper
- Jesse Bochert (Author), 2012, Heinrich von Kleists „Die Verlobung in St. Domingo“. Kritik an Napoleon Bonaparte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229604