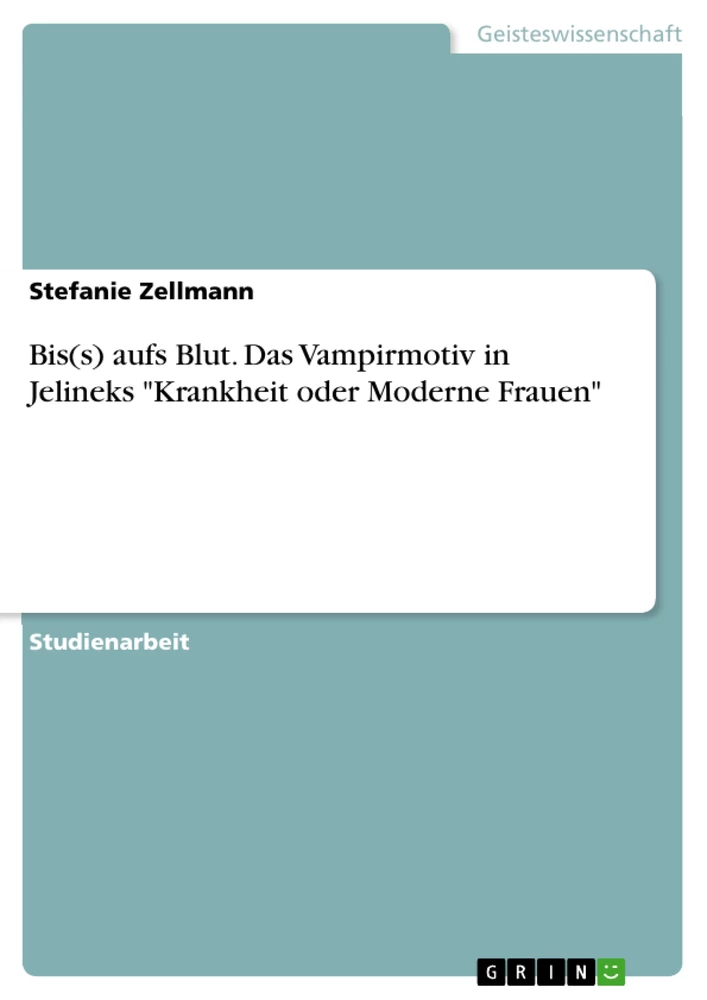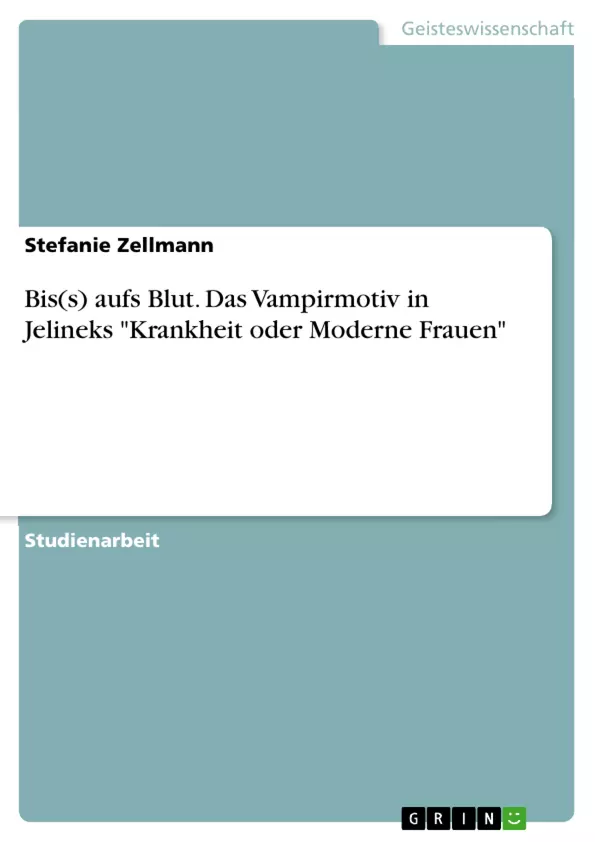In dieser Arbeit wird das von Jelinek verwendete Vampirmotiv in ihrem Stück "Krankheit oder Moderne Frauen" untersucht. Hierbei wird herausgearbeitet, warum sie sich dieses Motivs bedient, welches Ziel ihre Vampirfiguren verfolgen und ob sie es letztendlich erreichen. Hauptgegenstand der Arbeit ist die Frage, was Jelinek in ihrem Stück mithilfe des Vampirmotivs, derber Sprache, Perversion, Groteskem und Unverblümten in Bezug auf den Diskurs der Rolle der Frau bezweckt und wie sie das tut.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Vampirmythos
- Die Herkunft des Vampirmythos
- Die Modifizierung des Vampirmythos
- Jelineks Vampirinnen
- Ihre Einführung in das Stück
- Das Auflehnen und Scheitern der Frauen/Vampirinnen
- Der Sinn hinter dem vermeintlichen Unsinn
- Warum der Vampirmythos?
- Das Schaurige Groteske
- Die Regieanweisungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Elfriede Jelineks Verwendung des Vampirmotivs in ihrem Stück "Krankheit oder Moderne Frauen". Ziel ist es, Jelineks Intention hinter der Wahl dieses Motivs, der derben Sprache, des Grotesken und Unverblümten im Kontext des Diskurses über die Rolle der Frau herauszuarbeiten. Es wird analysiert, welches Ziel ihre Vampirfiguren verfolgen und ob sie dieses erreichen.
- Die historische Entwicklung des Vampirmythos und seine heutige Rezeption
- Die Darstellung von Jelineks Vampirinnen und deren Verhalten
- Die Funktion des Grotesken und der derben Sprache in Jelineks Stück
- Der Einfluss von Haupt- und Nebentext (Regieanweisungen) auf die Wirkung des Stücks
- Jelineks Kritik an gesellschaftlichen Geschlechterrollen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Ausgangsszene des Stücks – eine blutverschmierte Bühne mit lesbischen Vampirinnen und deren Männern – und formuliert die Forschungsfrage nach Jelineks Intention mit dem Vampirmotiv. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz: Zuerst wird der historische Hintergrund des Vampirmythos beleuchtet, dann werden die Vampirfiguren analysiert, der Einfluss von Haupt- und Nebentext untersucht, und schließlich Jelineks Nutzung des Mythos im Hinblick auf die Darstellung der Rolle der Frau erörtert. Die Bedeutung von Regieanweisungen als Kommentare der Autorin wird hervorgehoben.
2. Der Vampirmythos: Dieses Kapitel unterteilt sich in zwei Abschnitte. Der erste Abschnitt, "Die Herkunft des Vampirmythos", verfolgt die Ursprünge des Mythos in Sagen und Mythen, die auf der Angst vor den Toten und deren unbeherrschbarer Kontrolle beruhen. Es wird die Entwicklung des Vampirmythos von seinen Anfängen bis zum 19. Jahrhundert nachgezeichnet, wobei verschiedene kulturelle Ausprägungen und Schutzmaßnahmen gegen Vampire beschrieben werden. Der zweite Abschnitt, "Die Modifizierung des Vampirmythos", beschreibt die Veränderungen des Vampirbildes in der Filmgeschichte, von Murnaus Nosferatu bis hin zur Erotisierung des Vampirs und der Entstehung des weiblichen Vamp-Bildes als skrupellose, verführerische Frau. Die historische Entwicklung des Mythos wird mit den verschiedenen Darstellungen im Film verglichen und die Verschiebung der Bedeutung des Vampirmotivs vom Schrecken zur sexuellen Faszination beleuchtet.
Schlüsselwörter
Elfriede Jelinek, Vampirmythos, Krankheit oder Moderne Frauen, Geschlechterrollen, Groteske, Derbe Sprache, Regieanweisungen, Frauenfiguren, Feministische Literatur, Rollenverständnis.
Häufig gestellte Fragen zu Elfriede Jelineks "Krankheit oder Moderne Frauen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Elfriede Jelineks Verwendung des Vampirmotivs in ihrem Stück "Krankheit oder Moderne Frauen". Sie untersucht Jelineks Intention hinter der Wahl dieses Motivs, der derben Sprache, des Grotesken und Unverblümten im Kontext des Diskurses über die Rolle der Frau. Im Mittelpunkt steht die Analyse der Ziele und des Erfolgs von Jelineks Vampirfiguren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Vampirmythos und seine heutige Rezeption, die Darstellung von Jelineks Vampirinnen und deren Verhalten, die Funktion des Grotesken und der derben Sprache in Jelineks Stück, den Einfluss von Haupt- und Nebentext (Regieanweisungen) auf die Wirkung des Stücks und Jelineks Kritik an gesellschaftlichen Geschlechterrollen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zur Einleitung, dem Vampirmythos (inkl. Herkunft und Modifizierung), Jelineks Vampirinnen (Einführung und Scheitern), dem Sinn hinter dem vermeintlichen Unsinn (inkl. Begründung des Mythos und der grotesken Darstellung), den Regieanweisungen und einem Fazit. Jedes Kapitel untersucht einen Aspekt des Vampirmotivs und seiner Funktion in Jelineks Stück.
Was wird im Kapitel "Der Vampirmythos" behandelt?
Dieses Kapitel verfolgt die Ursprünge des Vampirmythos in Sagen und Mythen, die Entwicklung des Mythos bis ins 19. Jahrhundert und dessen Modifikation in der Filmgeschichte. Es wird die Verschiebung der Bedeutung des Vampirmotivs vom Schrecken zur sexuellen Faszination beleuchtet und verschiedene kulturelle Ausprägungen und Schutzmaßnahmen gegen Vampire beschrieben.
Welche Rolle spielen die Regieanweisungen?
Die Regieanweisungen werden als Kommentare der Autorin betrachtet und ihren Einfluss auf die Wirkung des Stücks untersucht. Ihre Bedeutung für das Verständnis von Jelineks Intention wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Elfriede Jelinek, Vampirmythos, Krankheit oder Moderne Frauen, Geschlechterrollen, Groteske, Derbe Sprache, Regieanweisungen, Frauenfiguren, Feministische Literatur, Rollenverständnis.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist die nach Jelineks Intention hinter der Wahl des Vampirmotivs, der derben Sprache und des Grotesken in "Krankheit oder Moderne Frauen" im Kontext der Darstellung der Rolle der Frau.
Wie wird der methodische Ansatz beschrieben?
Der methodische Ansatz beinhaltet die Untersuchung des historischen Hintergrunds des Vampirmythos, die Analyse der Vampirfiguren, die Untersuchung des Einflusses von Haupt- und Nebentext und die Erörterung von Jelineks Nutzung des Mythos im Hinblick auf die Darstellung der Rolle der Frau.
- Citation du texte
- B.A. Bachelor of Arts Stefanie Zellmann (Auteur), 2013, Bis(s) aufs Blut. Das Vampirmotiv in Jelineks "Krankheit oder Moderne Frauen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229920