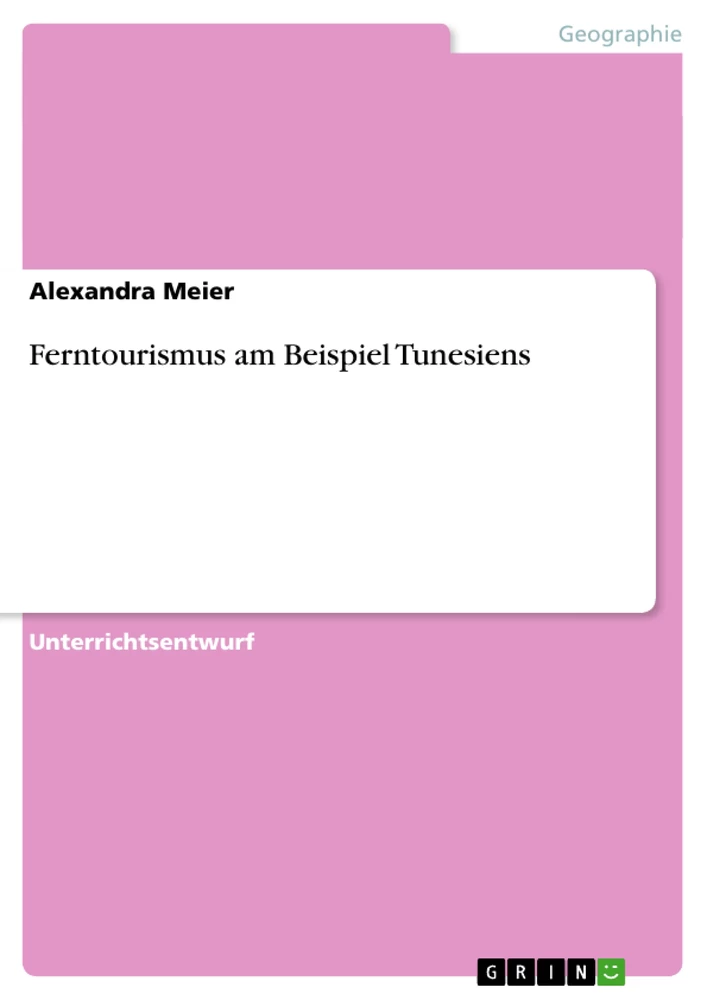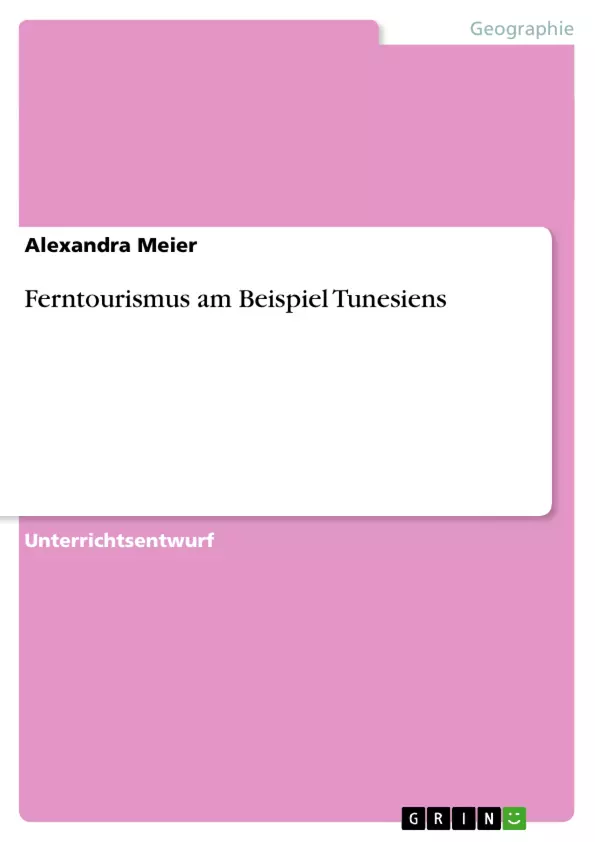18 Schüler der 9. Klasse der Hauptschule in Betzenstein, davon 9 männlich, 9 weiblich Etwa die Hälfte der Schüler Innen sind bereits über 15 Jahre alt. Eine Schülerin ist von der Realschule auf die Hauptschule gewechselt. In der Klasse sind zwei Ausländer. Der eine, ein Mexikaner, kennt die Klasse gut und ist integriert. Allerdings ist er immer nur in der Sommersaison in der Klasse, da seine Eltern nur eine befristete Aufenthaltserlaubnis haben und im Winter mit ihrem Sohn zurück nach Mexiko gehen. Die andere ist eine Brasilianerin, die erst im Dezember nach Deutschland gekommen ist. Aufgrund ihres ungenügenden Sprachvermögens ist sie nicht in der Klasse integriert.
Fachliches Vorwissen als Orientierung auf einer Karte, die Arbeit mit Atlanten, das Lesen von Diagrammen und Grafiken besteht. Zudem sind die Schüler in den vorhergehenden Stunden bereits in die Problematik von Industrie- und Entwicklungsländern eingeführt worden.
Das Thema Tourismus geht sie aufgrund von Eigenerfahrung und persönlicher Betroffenheit an.
Da die Schüler auch bereits über den Islam gesprochen haben, kann unproblematisch auch darauf zurückgegriffen werden. Die Schüler scheinen motiviert, interessiert und offen.
Raum: Klassenzimmer, geräumig, Bänke mit je einem Schüler in vier Reihen hintereinander
Der Raum kann durch Jalousien verdunkelt werden
Technik: Tafel, Overheadprojektor
Bücher: Durchblick 9, Braunschweig 1999
Atlanten sind nicht einheitlich, weder im Verlag noch im Erscheinungsjahr
Inhaltsverzeichnis
- Lehr- und Lernvoraussetzungen
- Sachanalyse
- Unterrichtssequenz
- Didaktische Analyse
- Lernziele
- Methodenanalyse
- Unterrichtsverlaufsskizze
- Reflexion
- Anhang
- Tafelbild
- Folien
- Arbeitsblätter
- Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Ferntourismus am Beispiel Tunesiens und analysiert die Auswirkungen dieser Form des Tourismus auf die Entwicklung des Landes. Die Arbeit beschäftigt sich insbesondere mit den Chancen und Risiken, die der Tourismus für die wirtschaftliche Entwicklung, die Gesellschaft und die Umwelt Tunesiens birgt.
- Tourismus als Motor der wirtschaftlichen Entwicklung
- Soziale und kulturelle Auswirkungen des Tourismus
- Ökologische Folgen des Tourismus
- Die Rolle der Tourismusindustrie und die Ansprüche der Touristen
- Die Perspektive der einheimischen Bevölkerung
Zusammenfassung der Kapitel
- Lehr- und Lernvoraussetzungen: Dieses Kapitel beschreibt die Lerngruppe und die Vorkenntnisse der Schüler im Hinblick auf das Thema Ferntourismus. Es werden die spezifischen Bedingungen des Unterrichtsraumes und die verfügbaren Materialien dargelegt.
- Sachanalyse: Das Kapitel analysiert die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen des internationalen Tourismus. Es beleuchtet die Rolle des Tourismus in der Entwicklung von Entwicklungsländern und setzt sich kritisch mit den Herausforderungen und Problemen auseinander, die mit dieser Form des Tourismus verbunden sind.
Schlüsselwörter
Ferntourismus, Tunesien, Entwicklung, Tourismusindustrie, wirtschaftliche Entwicklung, soziale Auswirkungen, ökologische Folgen, Kulturaustausch, Nachhaltigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Welche Auswirkungen hat der Ferntourismus auf Tunesien?
Der Tourismus wirkt als Motor der wirtschaftlichen Entwicklung, bringt aber auch soziale, kulturelle und ökologische Risiken für das Land mit sich.
Warum ist Tourismus für Entwicklungsländer oft problematisch?
Es besteht oft eine Abhängigkeit von der Tourismusindustrie, und die Ansprüche der Touristen können im Konflikt mit den Bedürfnissen der einheimischen Bevölkerung stehen.
Welche Rolle spielt die Religion im tunesischen Tourismus?
Da Tunesien ein islamisch geprägtes Land ist, ist das Verständnis für kulturelle und religiöse Hintergründe für den Erfolg und die Akzeptanz des Tourismus wichtig.
Was sind ökologische Folgen des Tourismus?
Dazu gehören Ressourcenverbrauch (z.B. Wasser), Müllproblematik und die Veränderung der natürlichen Landschaft durch Hotelbauten.
Wie kann Tourismus nachhaltig gestaltet werden?
Nachhaltigkeit erfordert einen Kulturaustausch auf Augenhöhe, faire wirtschaftliche Beteiligung der Einheimischen und den Schutz der Umwelt.
- Arbeit zitieren
- Alexandra Meier (Autor:in), 2003, Ferntourismus am Beispiel Tunesiens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23001