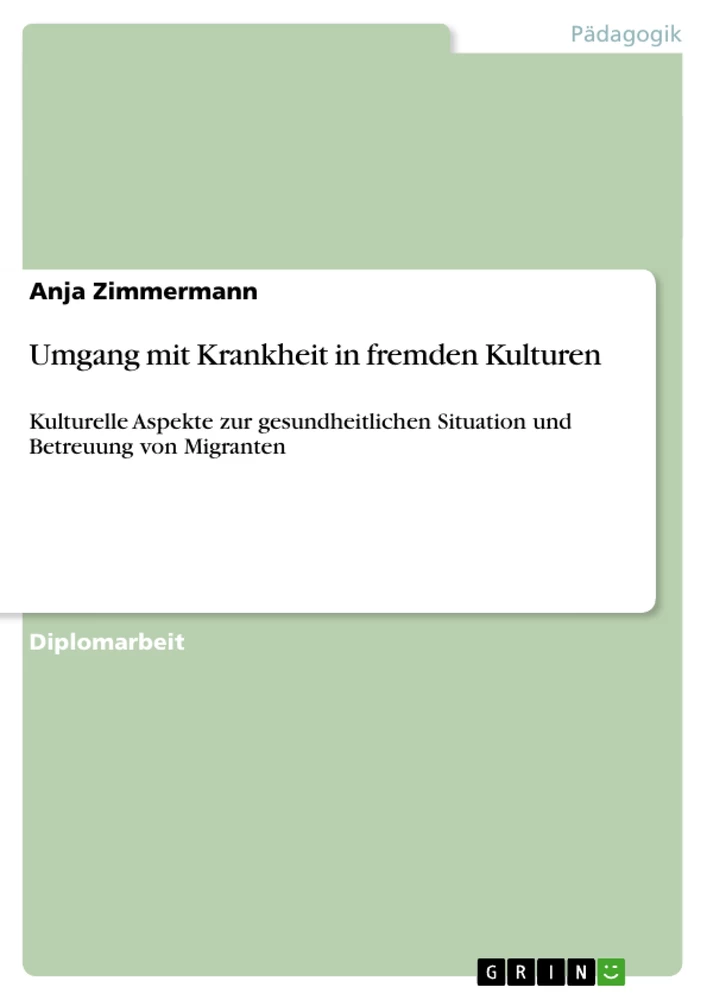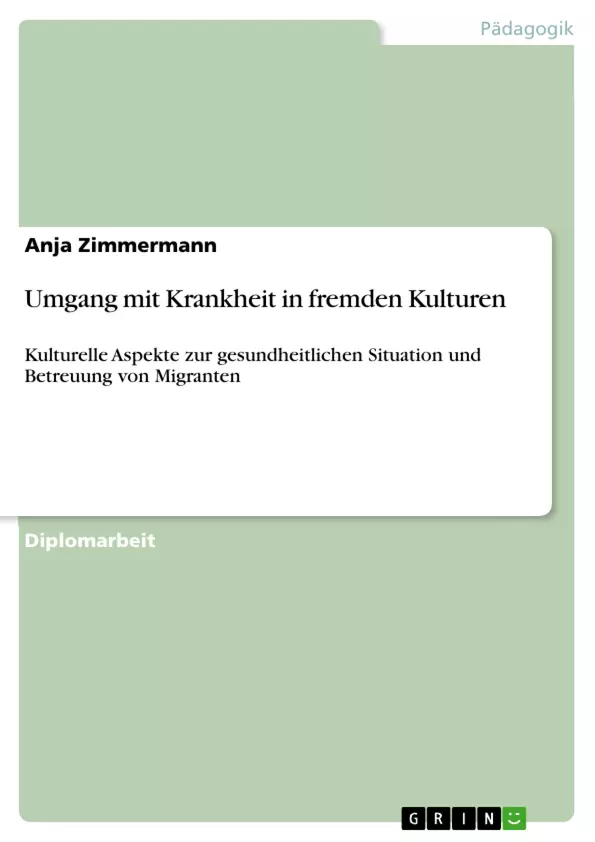Der enorme wirtschaftliche Aufschwung in Deutschland Anfang der fünfziger Jahre verursachte in der deutschen Produktion einen akuten Arbeitskräftemangel. So begann die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1955 ausländische Arbeitnehmer anzuwerben, um auf dem heimischen Arbeitsmarkt das Defizit auszugleichen. Bis zum Anwerbestop 1973 wanderten millionenfach ausländische Arbeitskräfte nach Deutschland ein. Die medizinische Versorgung wurde für diesen speziellen Prozess instrumentalisiert und hatte drei zentrale Funktionen. Zum einen sollte durch ausführliche medizinische Untersuchungen sichergestellt werden, dass nur besonders gesunde, leistungsfähige Arbeitskräfte nach Deutschland kommen würden; zweitens sollten die bei diesem Prozess für Deutschland anfallenden Gesundheits- und Sozialkosten minimiert und drittens die einheimische Bevölkerung vor eventuellen seuchen- und sozialhygienischen Problemen geschützt werden. Aufgrund des ausländerpolitischen Ziels der Rotation wurde die Öffnung des medizinischen Versorgungssystems für den veränderten Bedarf nicht als notwendig erachtet.
Die Entwicklung verlief jedoch in zwei entscheidenden Punkten nicht wie erwartet. Erstens: Das Prinzip der Rotation funktionierte nicht. Zweitens: Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass Migranten im Vergleich zu Einheimischen überdurchschnittlich häufig von Krankheit betroffen sind, was sie dazu zwingt, das hiesige Gesundheitsversorgungssystem in Anspruch zu nehmen. Zunehmend wurde deutlich, dass dies mit Problemen verbunden ist. So scheinen ungünstige rechtliche und soziale Bedingungen die Inanspruchnahme von gesundheitlicher Versorgung für Migranten erheblich zu erschweren.
In der Öffentlichkeit wie auch in der Gesundheitspolitik wird dieses Thema bisher kaum zur Kenntnis genommen.
Die vorliegende Arbeit wird zeigen, dass unter anderem durch gesetzlich geschaffene Zugangsbarrieren vielen Menschen im Vergleich zu anderen der Zugang zum gesundheitlichen Versorgungssystem in dem Maße erschwert wird, dass sie keine gleichen Chancen auf eine gute Gesundheit haben und daß dies eben auch ganz besonders mit ihrer Herkunft zusammenhängt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielstellung und Arbeitshypothesen
- Wissenschaftliche Struktur der Ethnomedizin
- Einordnung der Ethnomedizin
- Begriffsklärung
- Gegenstand
- Medizinische Systeme
- Charakteristika eines medizinisches Systems
- Verschiedene Krankheitskonzepte und Erklärungsmodelle von Krankheit
- Unterscheidung
- Auf magisch-religiösen Vorstellungen basierende Medizinsysteme
- Parawissenschaftliche Medizinsysteme
- Der Umgang mit Krankheit in fremdkulturellen Medizinsystemen
- Kulturspezifische Erkrankungen
- Heilerpersönlichkeiten
- Klassifizierung von Heilerpersönlichkeiten
- Das Beziehungsgeflecht Arzt - Patient - soziales Umfeld im kulturellen Vergleich
- Einordnung der Ethnomedizin
- Migration und Gesundheit in Deutschland
- Migration
- Definition des Migrationsbegriffs
- Die rechtliche Position von Migranten im deutschen Gesundheitssystem
- Auswirkungen von Migration
- Das Leben vor der Migration in der türkischen, ländlichen Gesellschaft
- Veränderungen durch die Migration
- Psychosoziale Aspekte der Migration – Leben zwischen zwei Kulturen
- Mögliche migrationsbedingte Beschwerden und Erkrankungen
- Migranten im deutschen Gesundheitssystem
- Die Inanspruchnahme gesundheitlicher Dienste durch Migranten - Erwartungen und Realität
- Die Problembereiche im Einzelnen
- Sprachbarriere
- Informationsdefizit
- Fremdkulturelles Krankheitsverhalten und fremdkulturelle Krankheitskonzepte
- Transkulturelle Mißverständnisse und ihre Folgen
- Resümee der Gesamtsituation
- Migration
- Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von Migranten
- Problembilanz
- Zusammenfassung der Vorschläge zur Berücksichtigung fremdkultureller Aspekte in der gesundheitlichen Versorgung von Migranten
- Möglichkeiten zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von Migranten
- Ethnomedizinische Aspekte in der Ausbildung von medizinischem Personal und die Delegation von Aufgabenbereichen
- Dolmetscherdienste
- Psychosoziale Beratung und Psychotherapie
- Aus- und Weiterbildungsangebote
- Interkulturelle Kompetenz
- Grenzen und Hemmnisse bei der Verwirklichung theoretischer Konzeptionen
- Zwei Beispiele für Modellprojekte
- Das Ethnomedizinische Zentrum Hannover e. V.
- Dolmetscherdienst am Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf
- Verifizierung der Arbeitshypothesen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Umgang mit Krankheit in verschiedenen Kulturen und den Einfluss kultureller Aspekte auf die gesundheitliche Situation und Betreuung von Migranten in Deutschland. Das Ziel ist es, die Herausforderungen und Probleme im deutschen Gesundheitssystem im Umgang mit Migranten zu beleuchten und Lösungsansätze aufzuzeigen.
- Ethnomedizinische Konzepte und ihre Unterschiede zum biomedizinischen Modell
- Auswirkungen von Migration auf die Gesundheit von Migranten
- Herausforderungen in der gesundheitlichen Versorgung von Migranten im deutschen System
- Möglichkeiten zur Verbesserung der interkulturellen Kommunikation und Versorgung
- Beispiele für erfolgreiche Modellprojekte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Hintergrund der Arbeit, ausgehend vom Arbeitskräftemangel in Deutschland in den 1950er Jahren und der damit verbundenen Zuwanderung. Sie thematisiert die anfängliche Instrumentalisierung des Gesundheitssystems zur Selektion gesunder Arbeitskräfte und die unerwartete Entwicklung, dass Migranten häufiger erkranken und auf das Gesundheitssystem angewiesen sind, was zu Problemen führt.
Wissenschaftliche Struktur der Ethnomedizin: Dieses Kapitel beleuchtet die wissenschaftliche Einordnung der Ethnomedizin, definiert den Begriff und beschreibt verschiedene medizinische Systeme, ihre Charakteristika, Krankheitskonzepte und den Umgang mit Krankheit in verschiedenen Kulturen. Es werden magisch-religiöse und parawissenschaftliche Medizinsysteme unterschieden und die Rolle von Heilerpersönlichkeiten und das Arzt-Patient-Verhältnis im kulturellen Kontext analysiert. Der Fokus liegt auf der Vielfalt von Erklärungsmodellen für Krankheit und deren Bedeutung für die medizinische Versorgung.
Migration und Gesundheit in Deutschland: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen von Migration auf die Gesundheit von Migranten in Deutschland. Es betrachtet den Migrationsprozess selbst, die rechtliche Stellung von Migranten im Gesundheitssystem und die spezifischen Herausforderungen, denen Migranten im deutschen Gesundheitswesen begegnen. Hierzu gehören Sprachbarrieren, Informationsdefizite und transkulturelle Missverständnisse, die zu ungünstigen Behandlungsergebnissen führen können. Der Abschnitt beschreibt das Leben von Migranten vor und nach der Migration, die damit verbundenen psychosozialen Aspekte und mögliche migrationsbedingte Erkrankungen.
Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von Migranten: Das Kapitel fasst die zuvor beschriebenen Probleme zusammen und entwickelt Lösungsansätze zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von Migranten. Es untersucht die Rolle der ethnomedizinischen Aspekte in der Ausbildung von medizinischem Personal, die Bedeutung von Dolmetscherdiensten, die Notwendigkeit psychosozialer Beratung und die Wichtigkeit von Aus- und Weiterbildungsangeboten. Interkulturelle Kompetenz wird als zentraler Aspekt hervorgehoben, und die Grenzen und Hemmnisse bei der Umsetzung theoretischer Konzepte werden diskutiert. Schliesslich werden zwei konkrete Modellprojekte vorgestellt.
Schlüsselwörter
Ethnomedizin, Migration, Gesundheit, Migranten, Deutschland, interkulturelle Kommunikation, medizinische Versorgung, Krankheitskonzepte, transkulturelle Missverständnisse, Modellprojekte, Sprachbarrieren, psychosoziale Aspekte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Migration und Gesundheit
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht den Umgang mit Krankheit in verschiedenen Kulturen und den Einfluss kultureller Aspekte auf die gesundheitliche Situation und Betreuung von Migranten in Deutschland. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Probleme im deutschen Gesundheitssystem im Umgang mit Migranten und zeigt Lösungsansätze auf.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt ethnomedizinische Konzepte und deren Unterschiede zum biomedizinischen Modell, die Auswirkungen von Migration auf die Gesundheit von Migranten, Herausforderungen in der gesundheitlichen Versorgung von Migranten im deutschen System, Möglichkeiten zur Verbesserung der interkulturellen Kommunikation und Versorgung sowie Beispiele für erfolgreiche Modellprojekte. Konkret werden Aspekte wie Sprachbarrieren, Informationsdefizite, transkulturelle Missverständnisse und die Rolle von Heilerpersönlichkeiten analysiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur wissenschaftlichen Struktur der Ethnomedizin, ein Kapitel zu Migration und Gesundheit in Deutschland und ein Kapitel zu Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von Migranten. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas, beginnend mit der Definition von Ethnomedizin und Migration bis hin zu konkreten Lösungsvorschlägen und Beispielen für erfolgreiche Modellprojekte.
Was versteht die Arbeit unter Ethnomedizin?
Die Arbeit definiert und ordnet Ethnomedizin wissenschaftlich ein. Sie beschreibt verschiedene medizinische Systeme, ihre Charakteristika, Krankheitskonzepte und den Umgang mit Krankheit in verschiedenen Kulturen. Magisch-religiöse und parawissenschaftliche Medizinsysteme werden unterschieden, und die Rolle von Heilerpersönlichkeiten und das Arzt-Patient-Verhältnis im kulturellen Kontext werden analysiert.
Welche Auswirkungen von Migration auf die Gesundheit werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert den Migrationsprozess selbst, die rechtliche Stellung von Migranten im deutschen Gesundheitssystem und die spezifischen Herausforderungen, denen Migranten im deutschen Gesundheitswesen begegnen. Dies umfasst Sprachbarrieren, Informationsdefizite und transkulturelle Missverständnisse, die zu ungünstigen Behandlungsergebnissen führen können. Das Leben von Migranten vor und nach der Migration, die damit verbundenen psychosozialen Aspekte und mögliche migrationsbedingte Erkrankungen werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Lösungsansätze zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung werden vorgeschlagen?
Die Arbeit schlägt Lösungsansätze zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von Migranten vor, indem sie die Rolle der ethnomedizinischen Aspekte in der Ausbildung von medizinischem Personal, die Bedeutung von Dolmetscherdiensten, die Notwendigkeit psychosozialer Beratung und die Wichtigkeit von Aus- und Weiterbildungsangeboten untersucht. Interkulturelle Kompetenz wird als zentraler Aspekt hervorgehoben, und die Grenzen und Hemmnisse bei der Umsetzung theoretischer Konzepte werden diskutiert. Konkrete Modellprojekte werden vorgestellt.
Welche konkreten Beispiele für Modellprojekte werden genannt?
Als Beispiele für erfolgreiche Modellprojekte werden das Ethnomedizinische Zentrum Hannover e. V. und der Dolmetscherdienst am Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf genannt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Ethnomedizin, Migration, Gesundheit, Migranten, Deutschland, interkulturelle Kommunikation, medizinische Versorgung, Krankheitskonzepte, transkulturelle Missverständnisse, Modellprojekte, Sprachbarrieren, psychosoziale Aspekte.
- Quote paper
- Anja Zimmermann (Author), 2003, Umgang mit Krankheit in fremden Kulturen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23037