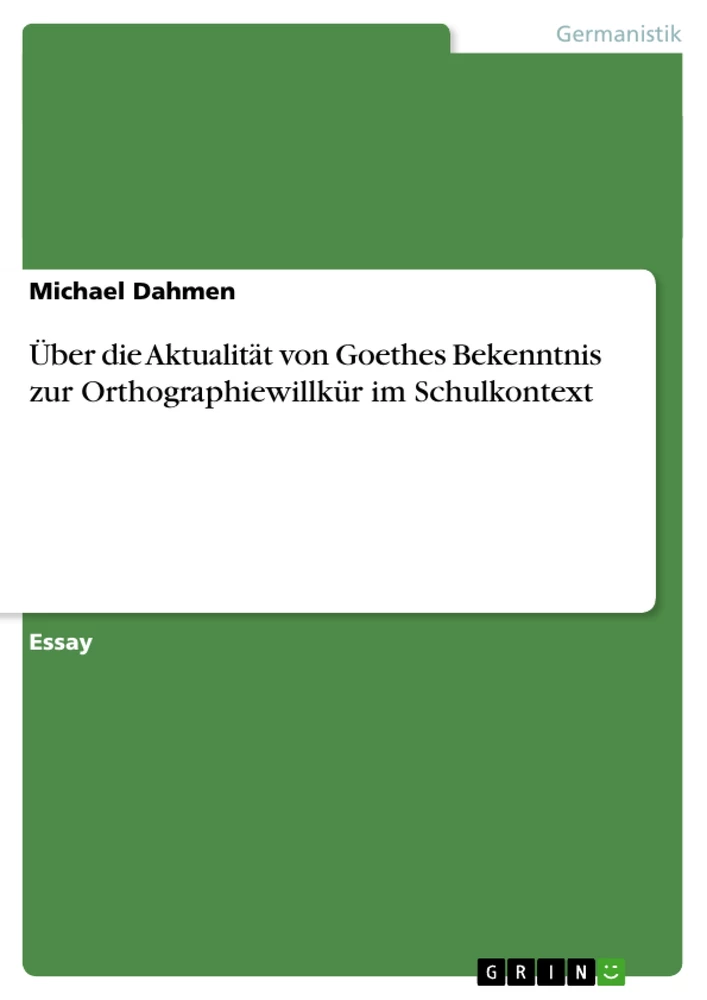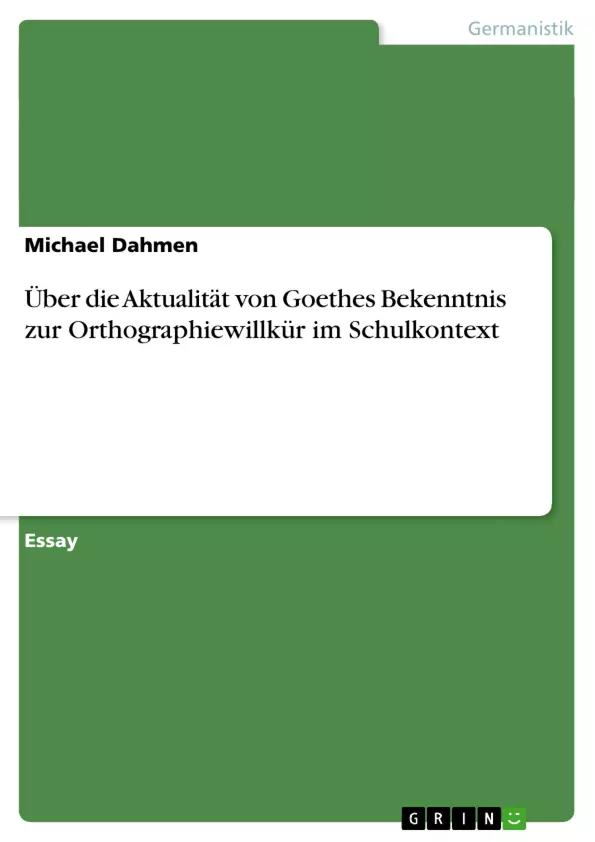Der folgende Essay überprüft und diskutiert das Bekenntnis von Johann Wolfgang von Goethe zu einer willkürlichen Orthographie hinsichtlich seiner Aktualität, Nachvollziehbarkeit, Wirksamkeit und Anwendbarkeit im schulischen Kontext.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Wege der orthographischen Regelfindung
2.1 Historisches zur Orthographie
2.2 Angenommene Gewohnheiten
3 Prinzipien der Rechtschreibung und Streitfälle
3.1 Die phonologische Prinzip und seine Grenzen
3.2 Morphologisches Prinzip als Stillehre innerhalb eines Wortes
3.3 Etymologisches Prinzip als Argument gegen Willkürlich
4 Zweifeln und Reflexion über Orthographie im Schulalltag
5 Forderung nach einem Unterricht mit Mut zur Debatte
6 Fazit
1. Einleitung
„Man steht heute noch fast allgemein dem Fehler vornehmlich mit Wertgefühlen gegenüber. Er wird als ein Ding betrachtet, das nicht sein soll und das den ruhigen Fortgang des Unterrichts in unangenehmer Weise stört. Als seine Wurzeln gelten gemeinhin Dummheit, Faulheit und Unaufmerksamkeit. Daher fühlt man sich in vielen Fällen berechtigt, nicht nur den Fehler zu verbessern, sondern auch seinen Urheber, den Verfehler, zu bestrafen.“ (Weimer 1925, Vorwort)
Diese von Hermann Weimer formulierten Eingangsworte in seinem Buch „Psychologie der Fehler“ zeigen, welche Brisanz mit dem Gegenstand des Fehlers – in der Folge ist von orthographischen Fehlern die Rede – verbunden sein kann. Auch heute hat sich an diesem hohen Stellenwert des Fehlers wenig geändert, denn eine fehlerfreie Beherrschung der (Grund)regeln wird in der Gesellschaft weiterhin vorausgesetzt und ist Bestandteil eines Kapitals an Wissen, welches mit einem Indiz für Allgemeinbildung einhergeht. Des Weiteren gilt die Beherrschung orthographischer Regeln als Indiz für Intelligenz sowie für Tugenden wie Leistungs- und Lernbereitschaft, Ordnung, Pflichtbewusstsein und Disziplin, welche ebenfalls einen Zugang zum Arbeitsmarkt erst ermöglichen (vgl. Mentrup 1993, S.193 f.). Umso erstaunlicher erscheint die Aussage von Johann Wolfgang von Goethe1, in der er sich bekennt, dass ihm eine konsequente Rechtschreibung immer gleichgültig war und es darauf ankommt, dass die Leser verstehen, was man sagen will. Der folgende Teil soll diese Aussage in Bezug auf ihre Aktualität, Nachvollziehbarkeit, Wirksamkeit und Anwendbarkeit diskutieren und die Frage beantworten, ob Zweifel und Reflexion über Orthographie nicht der bessere Weg ist, als eine allgemeine Gleichgültigkeit und eine Beschränkung auf das kommentarlose Markieren von Fehlern.
2. Wege der orthographischen Regelfindung
Einheitliche Rechtschreibregeln, wie wir sie heute vorfinden, sind eine eher moderne Erscheinung. Bis ins 18. Jahrhundert gab es keine allgemeine verbindliche Rechtschreibung. So kommt es dazu, dass es dem heutigen Leser älterer Texte oft schwerfällt, den Inhalt des Textes zu erschließen, da ihm im Schritt vorher Wörter aufgrund ihrer ungewöhnlichen orthographischen Umsetzung unbekannt vorkommen. Gerade im Mittelalter, in der nur eine sehr geringe Anzahl an Menschen überhaupt lesen konnte, erübrigte sich die Forderung nach einer einheitlichen Schriftsprache. Man schrieb also individuell und wie man es für richtig hielt. Die politische und geographische Aufteilung des damaligen deutschen Staatsgebietes begründete somit auch eine große Anzahl vorkommender Varietäten.
2.1 Historisches zur Orthographie
Aufgrund von engeren Vernetzungen der Nationalstaaten und höherer Schulbildung kam somit als Folge die Forderung nach einer einheitlichen Schriftsprache auf. Das Ziel ist also eine verbesserte Kommunikation. Zwar erschien bereits 1722 mit Hieronymus Freyers „Anweisung zur Teutschen Orthografie“ ein orthographisches Lehrbuch, welches jedoch nicht als verbindlich galt. Neben den von den Behörden abgelehnten Versuchen einer allgemeingültigen Vereinheitlichung, lässt sich sinngemäß auch Goethes Bekenntnis einordnen, wobei erwähnt werden muss, dass selbst der rechtschreibkritische Goethe sich von Johann Christoph Adelungs „Vollständige Anweisung zur Deutschen Orthographie“ hat beeinflussen lassen2 - nicht zufällig steht Goethe 1800 auch für die Forderung nach dem „Deutschen Bühnenhochdeutsch“ , was eine vereinheitlichte Standartaussprache aller Buchstaben auf deutschen Theaterbühnen einfordert und das gleiche Ziel, nämlich die verbesserte Kommunikation zwischen den Menschen, verfolgt. Die 1901 erfolgte zweite Orthographische Konferenz in Berlin regelte die deutsche Schriftsprache zum ersten Mal einheitlich, bevor die Beschlüsse durch die Deutsche Rechtschreibreform 1996 weiterentwickelt wurden.
2.2 Angenommene Gewohnheiten
Bevor Regeln der Rechtschreibung überhaupt erst zu verbindlichen, ausformulierten Normen wurden, herrschte bereits eine stillschweigende Einigkeit über bestimmte Gewohnheiten, die anscheinend in der Mehrheit bereits ohne jegliche Einwirkung von außen eine Gültigkeit besaßen (vgl. Ickler 1999, S. 3). Man kann somit festhalten, dass es eine innerliche Intention nach Gewohnheiten und damit im letztlich weiterentwickelten Schritt auch nach Rechtschreibregeln geben muss. Demnach entstehen die Regeln nicht willkürlich und könnten so zu Verständnisproblemen oder wie bei Goethe auf ablehnende Gleichgültigkeit stoßen, sondern es wird lediglich in Anspruch genommen, zunächst den allgemeinen Schreibgebrauch zu beobachten und dann Regeln zu formulieren, die gleichsam die Theorie zu den beobachtbaren Tatsachen des Schreibgebrauchs sind (vgl. Nerius 1989, S.151). Dass Goethe also voraussetzt, dass eigene, willkürliche Rechtschreibung und das Verständnis des Lesers generell miteinander einhergehen, kann somit zunächst einmal in Frage gestellt werden, da das nicht-regelkonform Geschriebene nicht den Tatsachen des Schreibgebrauchs entspricht. Das Sprachgefühl, auf welches Goethe sich zu verlassen scheint, ist in der Wissenschaft jedoch sehr umstritten und wird als Ideologie aufgefasst. Der Begriff ist als elitäre Auffassung zu verstehen, nach dem nur der Dichter eine Sprache vollkommen beherrscht und nur die Poetik eine Sprachform mit vollendeten Ausdruck darstellt (vgl. Schrodt 1993, S. 29). Wahrscheinlicher ist jedoch, dass auch Goethe seiner Zeit bereits bestimmte Gewohnheiten verinnerlicht hatte, die im nächsten Schritt zu den Prinzipien der Rechtschreibung führten.
[...]
1 „Mir, der ich selten selbst geschrieben, was ich zum Druck beförderte, und, weil ich diktierte, mich dazu verschiedener Hände bedienen mußte, war die konsequente Rechtschreibung immer ziemlich gleichgültig. Wie dieses oder jenes Wort geschrieben wird, darauf kommt es doch eigentlich nicht an; sondern darauf, daß die Leser verstehen, was man damit sagen wollte! Und das haben die lieben Deutschen bei mir doch manchmal getan.“
2 Martin, Hans-Jürgen: Geschichtlicher Abriß der Rechtschreibung,
http://schriftdeutsch.de/orthogra.htm (Stand: 21.01.2013)
Häufig gestellte Fragen
Wie stand Goethe zur Rechtschreibung?
Goethe bekannte sich zur „Orthographiewillkür“. Er vertrat die Ansicht, dass eine konsequente Rechtschreibung gleichgültig sei, solange der Leser versteht, was gemeint ist.
Wann wurde die Rechtschreibung in Deutschland vereinheitlicht?
Eine erste einheitliche Regelung erfolgte 1901 durch die zweite Orthographische Konferenz in Berlin, gefolgt von der Reform 1996.
Welche Prinzipien der Rechtschreibung werden im Essay diskutiert?
Es werden das phonologische Prinzip (Schreibe, wie du sprichst), das morphologische Prinzip und das etymologische Prinzip analysiert.
Welchen Stellenwert hat der „Fehler“ heute im Schulalltag?
Fehlerfreie Rechtschreibung gilt weiterhin als Indiz für Intelligenz, Disziplin und Allgemeinbildung und ist oft eine Voraussetzung für den Arbeitsmarktzugang.
Was ist das morphologische Prinzip?
Das morphologische Prinzip dient als eine Art „Stillehre innerhalb eines Wortes“ und hilft dabei, Wortstämme über verschiedene Wortformen hinweg erkennbar zu halten.
- Arbeit zitieren
- Michael Dahmen (Autor:in), 2013, Über die Aktualität von Goethes Bekenntnis zur Orthographiewillkür im Schulkontext, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230466