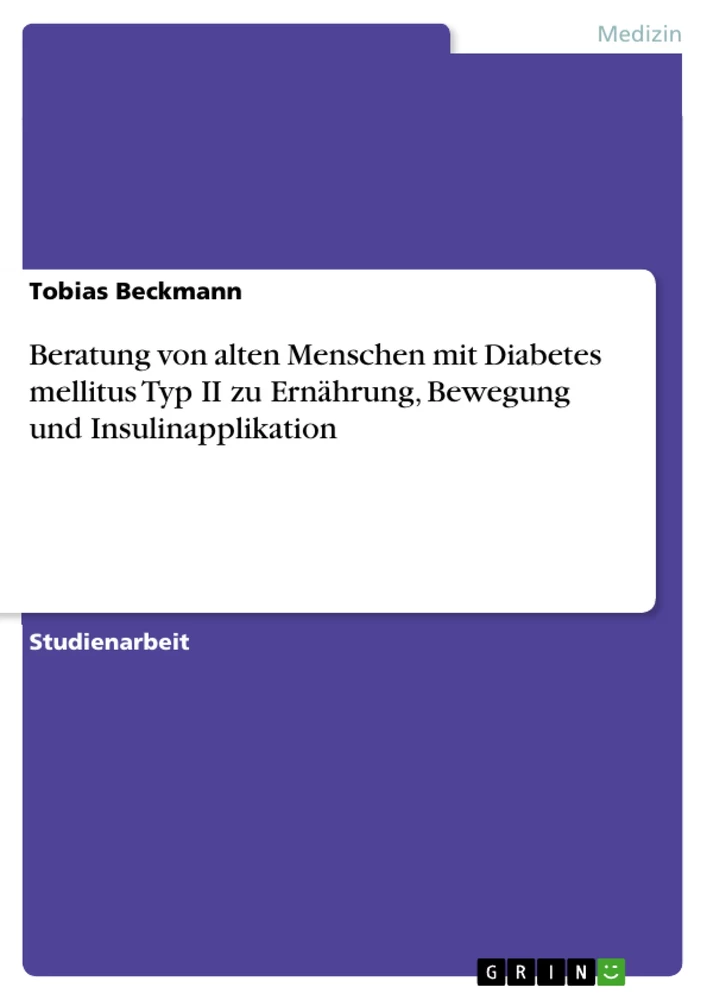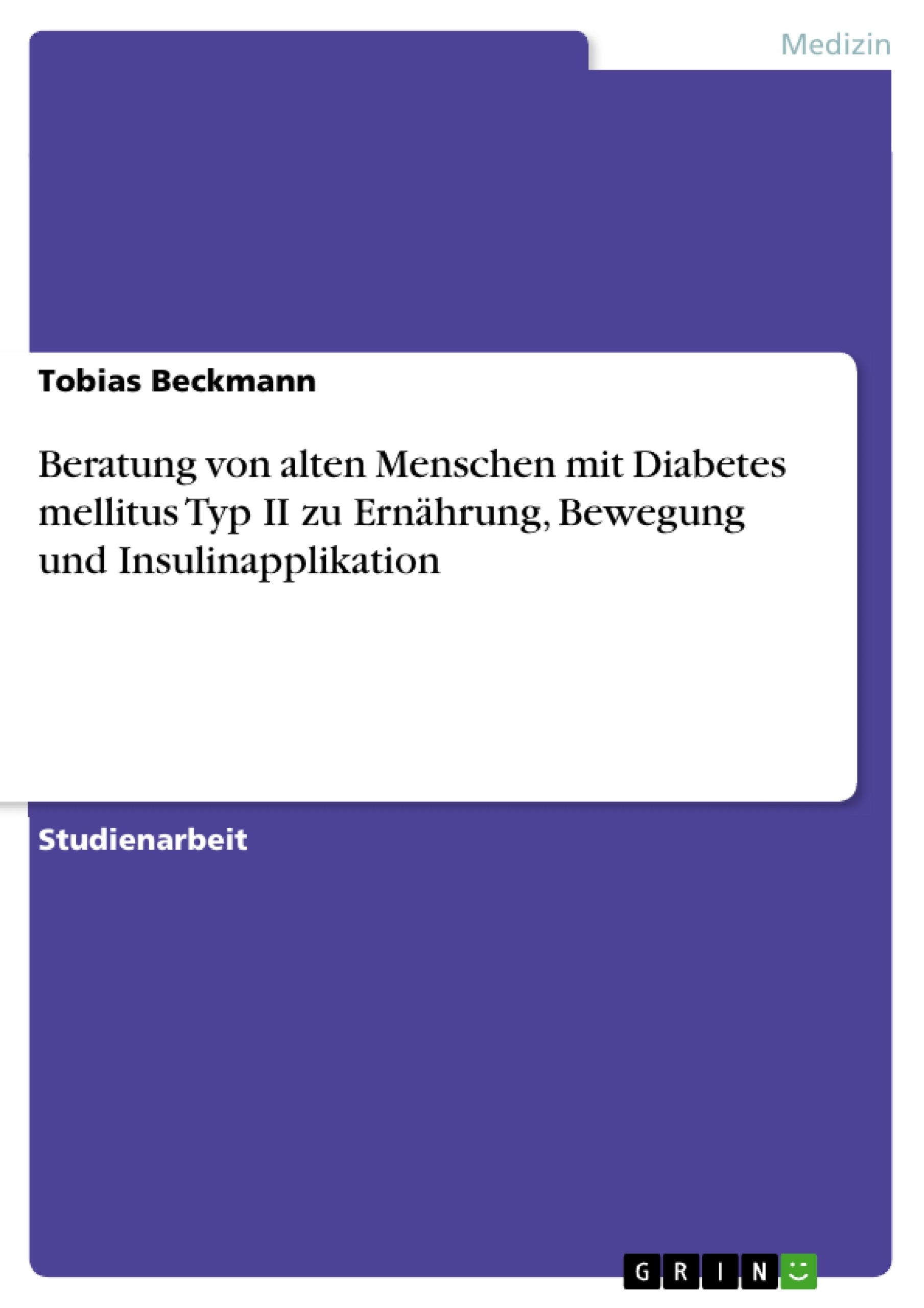Ziel dieses Teilcurriculums und seiner praktischen Anwendung ist es, die Schüler dazu zu befähigen, alte Menschen im Rahmen ihrer Ausbildung und späterer Berufstätigkeit professionell beraten zu können. Dargestellt wird dies am Beispiel des Typ II-Diabetes, der exemplarisch für alle chronischen Erkrankungen steht. Voraussetzung für dieses Teilcurriculum ist, dass das Teil-Lernfeld 1.3.5 der empfehlenden Ausbildungsrichtlinie für die Altenpflege für Nordrhein-Westfalen von Hundenborn & Kühn (2003) (bzw. das Krankheitsbild Diabetes mellitus) bereits bearbeitet wurde.
Darüber hinaus sollen die Schüler befähigt werden den Stellenwert von präventiven Maßnahmen einzuschätzen. Konkretisiert wird dies durch das Reflektieren der eigenen Bewegungs- und Ernährungsgewohnheiten sowie der gesellschaftlichen Kompetenzen und Kapazitäten.
Dieses Teilcurriculum wurde im Rahmen des Moduls „Curriculumentwicklung und Evaluation“ des Master-Studiengangs „Berufspädagogik Pflege und Gesundheit“ der Fachhochschule Bielefeld konzipiert. Der Autor orientiert sich hierbei an den vier Phasen der Curriculumentwicklung nach Knigge-Demal in Anlehnung an Siebert (vgl. Siebert, 1974 zitiert nach Knigge-Demal, 2001).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erste Phase der Curriculumentwicklung
- Analyse gesellschaftlicher Anforderungen
- Verständigung über das berufliche Selbstverständnis
- Verständigung über Bildungs- und Leitziele
- Leitziele und übergeordnete Bildungsziele
- Zweite Phase der Curriculumentwicklung
- Analyse des beruflichen Handlungsfeldes
- Klientenperspektive
- Angehörigenperspektive
- Pflegendenperspektive
- Bedingungsanalyse
- Analyse der Lernvoraussetzungen
- Berufstypische Situation
- Analyse der wissenschaftlichen Disziplinen
- Objektiver Pflegeanlass
- Subjektives Erleben und Verarbeiten
- Interaktionsstrukturen
- Tätigkeitsfelder und ihre kontextuelle Einbettung
- Handlungsabläufe und Handlungsmuster
- Pflegeprozess
- Gesellschaftlicher Kontext
- Dritte Phase der Curriculumentwicklung
- Kompetenzen / Qualifikationen
- Didaktische Überlegungen und Didaktische Reduktion
- Didaktische Überlegungen
- Didaktische Reduktion
- Modulplanung im Überblick
- Planung der Unterrichtsreihe
- Vierte Phase der Curriculumentwicklung
- Lernergebniskontrolle
- Evaluation
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Curriculums zur Beratung älterer Menschen mit Typ-II-Diabetes. Der Fokus liegt auf der Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Insulinapplikation. Das Curriculum soll den Bedürfnissen der Zielgruppe und den Anforderungen des beruflichen Handlungsfeldes gerecht werden.
- Analyse des beruflichen Handlungsfeldes der Pflege älterer Menschen mit Diabetes mellitus Typ II
- Entwicklung von Lernzielen und -inhalten für die Beratung in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Insulinapplikation
- Didaktische Konzeptionierung des Curriculums unter Berücksichtigung der Lernvoraussetzungen der Zielgruppe
- Planung der Lernergebniskontrolle und Evaluation
- Einbeziehung verschiedener Perspektiven (Klient, Angehörige, Pflegende)
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Beratung älterer Menschen mit Diabetes mellitus Typ II ein und beschreibt den Aufbau und die Struktur der Arbeit. Sie skizziert die Bedeutung des Themas im Kontext des demografischen Wandels und der steigenden Zahl an Diabetikern. Die Einleitung legt den Fokus auf die Notwendigkeit eines speziell auf diese Zielgruppe zugeschnittenen Curriculums.
Erste Phase der Curriculumentwicklung: Diese Phase befasst sich mit der Analyse gesellschaftlicher Anforderungen, der Klärung des beruflichen Selbstverständnisses und der Definition von Bildungs- und Leitziele. Es wird untersucht, welche gesellschaftlichen Bedürfnisse und Herausforderungen durch das Curriculum adressiert werden sollen. Die Definition der Leitziele legt den Grundstein für die weitere Curriculumentwicklung und stellt sicher, dass die angestrebten Kompetenzen der Pflegenden im Umgang mit älteren Menschen mit Diabetes klar umrissen sind.
Zweite Phase der Curriculumentwicklung: In dieser Phase wird das berufliche Handlungsfeld umfassend analysiert. Dabei werden verschiedene Perspektiven, wie die der Klienten, Angehörigen und Pflegenden, berücksichtigt, um ein ganzheitliches Verständnis der Situation zu ermöglichen. Die Analyse der Lernvoraussetzungen dient dazu, den Curriculuminhalt und die didaktische Gestaltung optimal auf die Bedürfnisse der Lernenden abzustimmen. Die wissenschaftlichen Disziplinen, die relevant sind, werden hier ebenfalls eingeordnet. Dies dient der Begründung der Inhalte und Methoden des Curriculums. Der Pflegeprozess und der gesellschaftliche Kontext werden miteinbezogen.
Dritte Phase der Curriculumentwicklung: Hier werden die notwendigen Kompetenzen und Qualifikationen definiert, die die angehenden Pflegekräfte nach dem Abschluss des Curriculums besitzen sollen. Die didaktischen Überlegungen und die didaktische Reduktion gewährleisten die Praktikabilität und Effizienz des Curriculums. Die Modulplanung im Überblick und die Planung der Unterrichtsreihe zeigen, wie die Inhalte strukturiert und vermittelt werden sollen.
Schlüsselwörter
Diabetes mellitus Typ II, ältere Menschen, Beratung, Ernährung, Bewegung, Insulinapplikation, Curriculum, Curriculumentwicklung, Evaluation, Pflege, Berufspädagogik, Handlungsfeldanalyse, Kompetenzen, Didaktik.
Häufig gestellte Fragen zum Curriculum: Beratung älterer Menschen mit Typ-II-Diabetes
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Vorschau auf ein Curriculum zur Beratung älterer Menschen mit Typ-II-Diabetes. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Insulinapplikation.
Welche Phasen der Curriculumentwicklung werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt vier Phasen der Curriculumentwicklung: Die erste Phase umfasst die Analyse gesellschaftlicher Anforderungen und die Definition von Bildungs- und Leitziele. Die zweite Phase beinhaltet die Analyse des beruflichen Handlungsfeldes aus verschiedenen Perspektiven (Klient, Angehörige, Pflegende) sowie die Analyse der Lernvoraussetzungen und relevanter wissenschaftlicher Disziplinen. Die dritte Phase befasst sich mit der Definition von Kompetenzen, didaktischen Überlegungen, Modul- und Unterrichtsplanung. Die vierte Phase beschreibt die Lernergebniskontrolle, Evaluation und einen Ausblick.
Welche Themen werden im Curriculum behandelt?
Die zentralen Themen des Curriculums sind die Beratung älterer Menschen mit Typ-II-Diabetes in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Insulinapplikation. Es werden sowohl fachliche Inhalte vermittelt als auch die didaktische Umsetzung und die Berücksichtigung verschiedener Perspektiven (Klient, Angehörige, Pflegende) betont.
Welche Zielgruppe spricht das Curriculum an?
Das Curriculum richtet sich an zukünftige Pflegekräfte, die ältere Menschen mit Typ-II-Diabetes beraten sollen. Der Inhalt und die didaktische Gestaltung berücksichtigen die Lernvoraussetzungen dieser Zielgruppe.
Welche Perspektiven werden im Curriculum berücksichtigt?
Das Curriculum berücksichtigt die Perspektiven der Klienten, Angehörigen und Pflegenden, um ein ganzheitliches Verständnis der Situation zu ermöglichen und die Beratung effektiv zu gestalten.
Wie wird das Curriculum evaluiert?
Das Dokument erwähnt die Planung der Lernergebniskontrolle und Evaluation als Bestandteil der vierten Phase der Curriculumentwicklung. Konkrete Methoden der Evaluation werden jedoch nicht detailliert beschrieben.
Welche wissenschaftlichen Disziplinen spielen eine Rolle?
Die Analyse der wissenschaftlichen Disziplinen umfasst Aspekte wie den objektiven Pflegeanlass, das subjektive Erleben und Verarbeiten, Interaktionsstrukturen, Tätigkeitsfelder, Handlungsabläufe, den Pflegeprozess und den gesellschaftlichen Kontext.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren das Curriculum?
Schlüsselwörter sind: Diabetes mellitus Typ II, ältere Menschen, Beratung, Ernährung, Bewegung, Insulinapplikation, Curriculum, Curriculumentwicklung, Evaluation, Pflege, Berufspädagogik, Handlungsfeldanalyse, Kompetenzen, Didaktik.
- Quote paper
- B.A. Anleitung und Mentoring / cand. M.A. Berufspädagogik Pflege und Gesundheit Tobias Beckmann (Author), 2012, Beratung von alten Menschen mit Diabetes mellitus Typ II zu Ernährung, Bewegung und Insulinapplikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230702