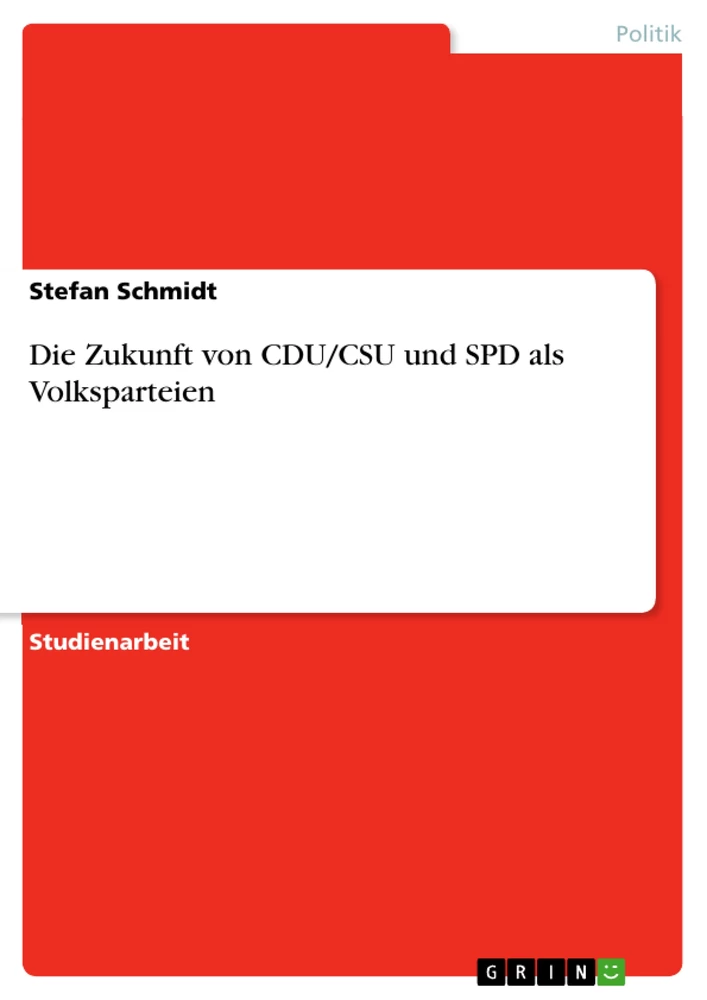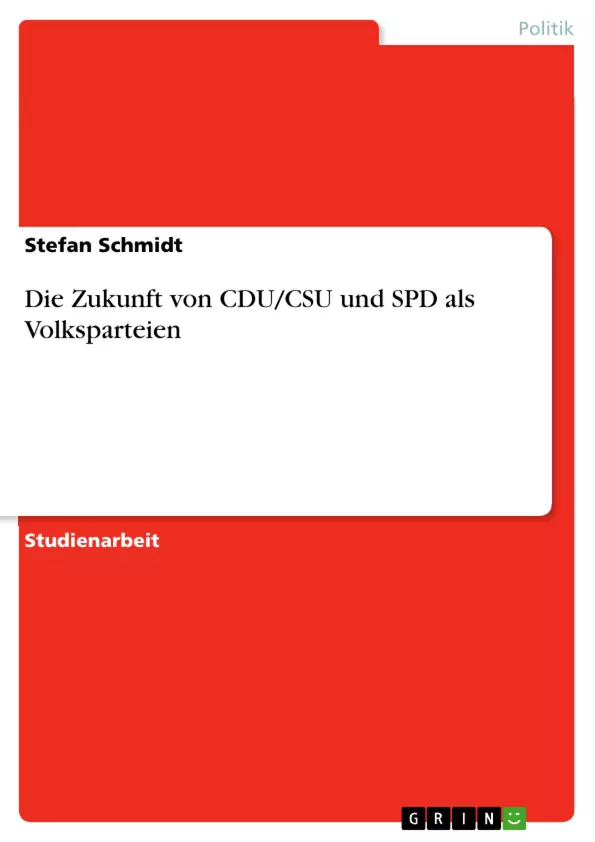Gibt es in der deutschen Parteienlandschaft noch Volksparteien? In der Presse und Literatur ist an vielen Stellen zu vernehmen, dass „die Riesen wanken“, die „Krise der Volksparteien“ ist allgegenwärtig. Vielerorts scheint ihr Schicksal besiegelt, man liest vom „schleichenden Ende der Volksparteien“ oder gar vom definitiven „Ende der Volksparteien“ . Auf den ersten Blick lässt sich die Vermutung stützen, dass die oben genannten Behauptungen der Wahrheit entsprechen. Als wichtigster Indikator gilt hier der Anteil der Stimmen der wahlberechtigten Deutschen, die eine Partei auf sich vereinen kann. Im Bezug auf Volksparteien sind in der Bundesrepublik nur zwei, beziehungsweise drei von Relevanz. CDU/CSU, die auf Bundeseben gemeinsam als Union antreten, und die SPD. Beobachtet man nun die Stimmenanteile beider Parteien seit den ersten Bundestagswahlen von 1949, fällt sofort ein Rückgang der Prozentanteile auf. Betrug der kumulierte Wähleranteil bei den Bundestagswahlen 1972 und 1976 noch über 90%, so ist er zur Bundestagswahl 2009 auf unter 60% gesunken. Damit ist nach der geläufigen Auffassung in der Parteienforschung ein Punkt weniger gegeben, der CDU/CSU und SPD als Volksparteien charakterisiert, nämlich „die Fähigkeit, […] gemeinsam über dreiviertel der Wählerschaft zu binden.“
Auch sinkt die Zahl derer, die sich mit einer der vermeintlichen Volksparteien identifizieren beständig. Vor allem die SPD leidet unter der Auflösung des klassischen Arbeitermilieus, aus der sie entstanden ist, was einen beträchtlichen Schwund in der Identifikation mit der ehemaligen Arbeiterpartei bewirkt.
Die oben genannten Aspekte sind die Gängigen bei Untersuchungen zum Status der großen deutschen Parteien, deren Wähleranteil und Parteienidentifikation. Hinzu kommt die Repräsentation aller Schichten und Gruppen durch die Wähler einer Partei.
Doch dies soll in der folgenden Arbeit nur am Rande behandelt werden. Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt auf den Parteimitgliedern als Spiegel der Gesellschaft. Wie ist die Bevölkerung in den vermeintlichen Volksparteien repräsentiert? Gibt es Unterschiede in Konfession, Sozialmilieu, Altersgruppen, berechtigt die reine Mitgliederzahl zur Bezeichnung als Volkspartei? Welches sind die Gründe für die Mitarbeit an und in einer der zu untersuchenden Parteien CDU/CSU und SPD?
Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
2. Definition des Begriffes Volkspartei
3. Untersuchung der Parteimitglieder von CDU/CSU und SPD nach Wildenmann
3.1. Massenmitgliedschaft
3.2. Zusammensetzung der Parteimitglieder
3.2.1. Frauenanteil in CDU/CSU und SPD
3.2.2. Repräsentierte Altersgruppen
3.2.3. Zusammenhang zwischen Partei- mitgliedschaft und Milieuangehörigkeit
4. Eine neue Art des Parteimitglieds?
5. Fazit und Schlussbetrachtungen
Häufig gestellte Fragen
Was kennzeichnet eine „Volkspartei“ in Deutschland?
Traditionell gilt eine Partei als Volkspartei, wenn sie in der Lage ist, breite Schichten der Bevölkerung über Milieugrenzen hinweg anzusprechen und gemeinsam mit anderen Volksparteien über drei Viertel der Wählerschaft zu binden.
Warum wird vom „Ende der Volksparteien“ gesprochen?
Ein wichtiger Indikator ist der sinkende Stimmenanteil: Während CDU/CSU und SPD in den 70er Jahren noch über 90 % der Stimmen erhielten, sank dieser Wert bis 2009 auf unter 60 %. Auch die Zahl der Parteimitglieder geht stetig zurück.
Welche Rolle spielt die Mitgliederstruktur für den Status als Volkspartei?
Die Arbeit untersucht, ob die Parteimitglieder ein getreues Spiegelbild der Gesellschaft sind. Dabei werden Unterschiede in Konfession, Sozialmilieu, Alter und der Frauenanteil analysiert, um die Repräsentativität zu prüfen.
Warum verliert insbesondere die SPD an Rückhalt?
Die SPD leidet stark unter der Auflösung des klassischen Arbeitermilieus. Durch den gesellschaftlichen Wandel schwindet die Identifikation mit der ehemaligen Arbeiterpartei in ihrer ursprünglichen Wählerbasis.
Welche Faktoren beeinflussen die Mitarbeit in einer Partei?
Die Untersuchung geht der Frage nach, aus welchen Gründen sich Menschen heute noch in CDU/CSU oder SPD engagieren und ob es Anzeichen für eine „neue Art des Parteimitglieds“ gibt, die sich von traditionellen Bindungen löst.
- Quote paper
- Stefan Schmidt (Author), 2012, Die Zukunft von CDU/CSU und SPD als Volksparteien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230746