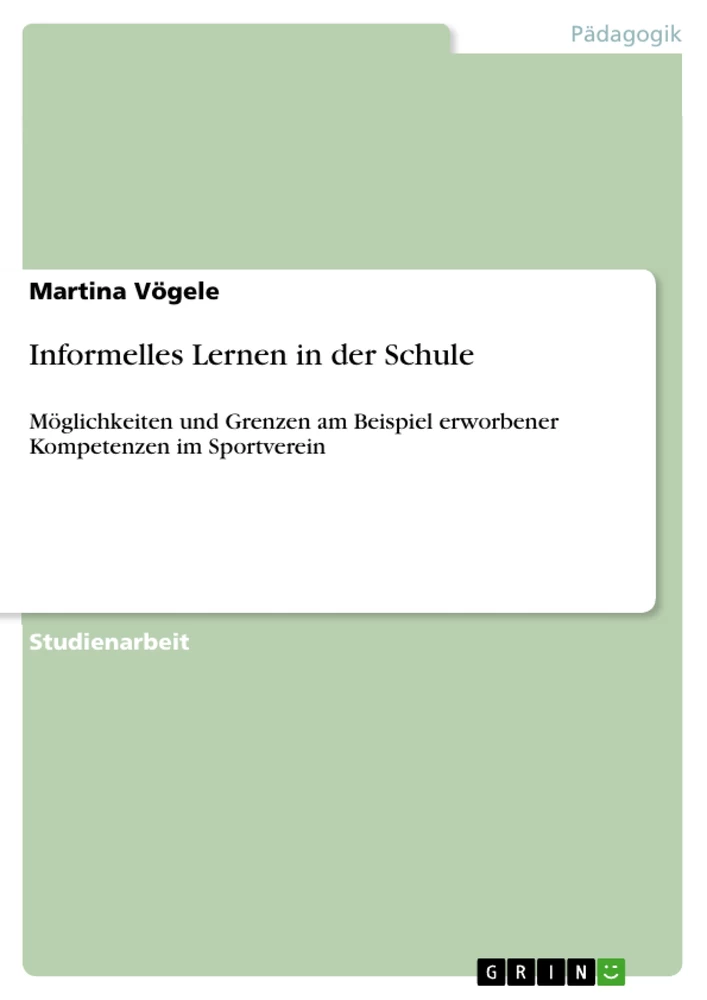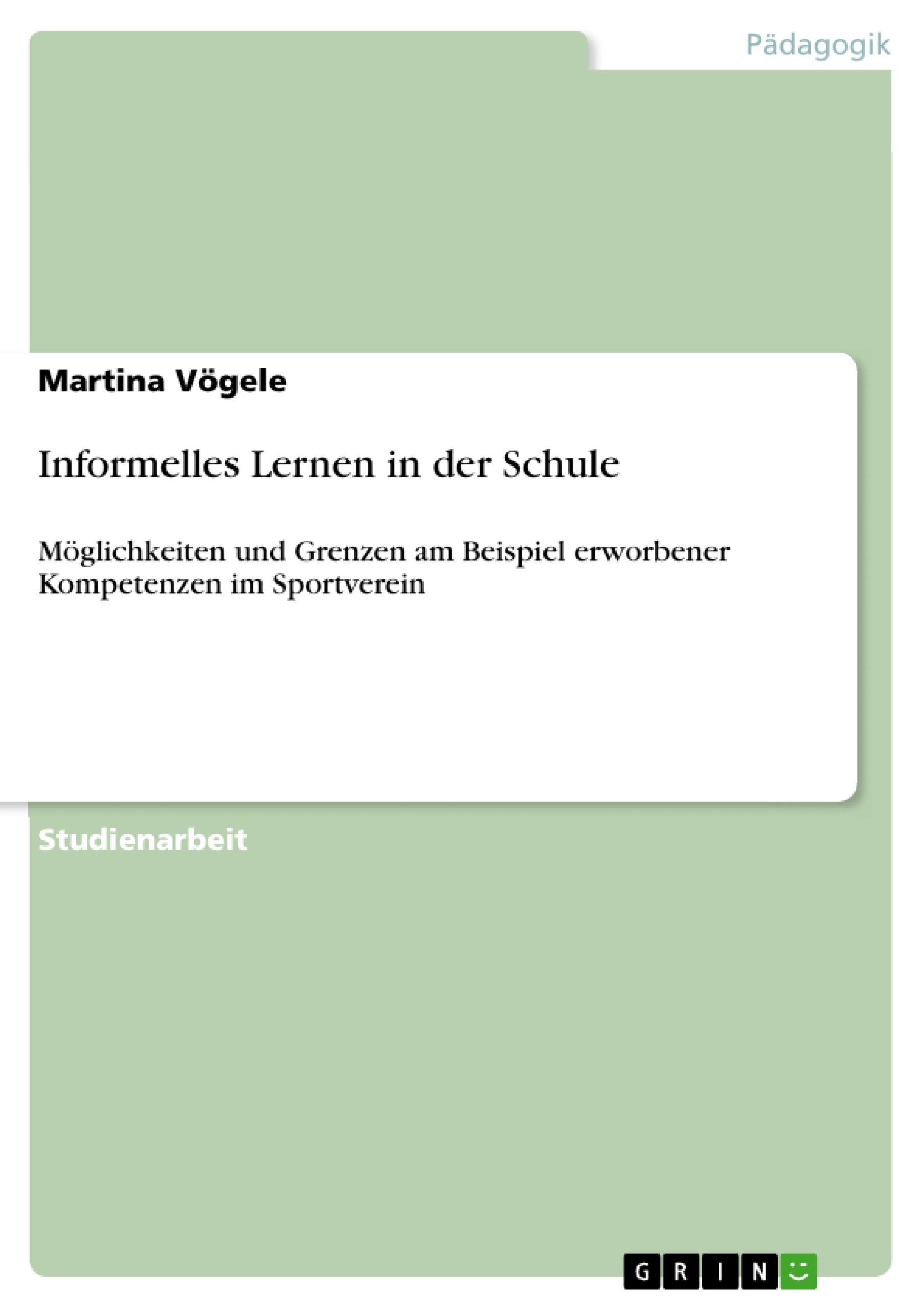Informelles Lernen ist in Deutschland seid einigen Jahren in der Diskussion und die Determinanten für diese Art des Lernens sind noch lange nicht geklärt, die Chancen, die dieses Lernen bietet noch lange nicht ausgeschöpft.
Während in anderen Ländern informelle Bildungsprozesse schon viel länger eine stärkere Aufmerksamkeit erhalten, ist Deutschland in dieser Hinsicht noch weit zurück.
In Deutschland ist das informelle Lernen insbesondere im Kontext der betrieblichen Aus- und Fortbildung und der Berufsschule untersucht worden. Allerdings bieten sich auch im Bereich von Real- und Gesamtschulen sowie Gymnasien Möglichkeiten informelle Bildungsprozesse zu nutzen und zu unterstützen. Insbesondere im Zusammenhang mit dem Thema Ganztag bieten sich neue Chancen junge Menschen in ihren Interessenschwerpunkten zu fördern und freiwillige Lernarrangements in der Schule zu schaffen.
In dieser Arbeit soll zunächst der Begriff des informellen Lernens geklärt werden. Dazu ist es notwendig, das informelle Lernen von non-formalem bzw. formellem Lernen abzugrenzen. Im Anschluss wird auf informelles Lernen und Kompetenzerwerb im Sportverein eingegangen. Der Sportverein bietet jungen Menschen die Möglichkeit sich aktiv in die Gestaltung der Sportaktivität mit
einzubringen und dort in vielfältiger Weise Erfahrungen zu sammeln und Kompetenzen zu erwerben.
Hier wird insbesondere auf Untersuchungen von Nils Neuber von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster zum Kompetenzerwerb im Sportverein eingegangen sowie auf Untersuchungen zum Thema der Gruppen- und Sporthelferausbildung von Jugendlichen.
Im darauf folgenden vierten Kapitel wird der Focus auf die Schule gelenkt. Hier wird untersucht, inwieweit Prozesse des informellen und non-formalen Lernens, welche im Sportverein stattfinden, auf die Schule übertragbar bzw. inwieweit im Sportverein erworbene Kompetenzen in der Schule nutzbar sind. Dabei wird zwischen dem Unterricht und außerunterrichtlichem Schulalltag unterschieden, da sich hier unterschiedliche Lernkontexte abbilden.
Zuletzt wird ein kritisches Fazit gezogen, inwieweit informelles Lernen in der Schule möglich ist und wo die Grenzen dieser Form des Lernens in der Schule liegen.
Inhaltsverzeichnis
1 Vorwort Fehler! Textmarke nicht definiert
2 Informelles Lernen, Non-Formales Lernen und Formales Lernen – eine Begriffsbestimmung
3 Informelles Lernen und Kompetenzerwerb im Sportverein
3.1 Kompetenzerwerb Jugendlicher durch Engagement im Sportverein
3.2 Handlungssituationen des Kompetenzerwerbs im Sportverein
4 Informelles Lernen in der Schule
4.1 Möglichkeiten der Anbindung informeller Lernprozesse aus dem Sportverein in den Schulalltag
4.2 Möglichkeiten der Nutzung informell im Sportverein erworbener Kompetenzen in der Schule
4.3 Möglichkeiten der Übertragbarkeit informeller Lernprozesse in den Unterricht
5 Fazit
5.1.1 Hypothesenbildung
6 Literaturverzeichnis
7 Anhang
Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen formellem und informellem Lernen?
Formelles Lernen findet in Bildungseinrichtungen (Schule, Uni) statt und ist zielgerichtet. Informelles Lernen geschieht außerhalb dieser Strukturen im Alltag, oft unbewusst und ohne formale Zertifizierung.
Welche Kompetenzen erwerben Jugendliche im Sportverein?
Jugendliche erwerben durch Engagement (z. B. als Sporthelfer) soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Führungskompetenz und Organisationsgeschick.
Wie kann die Schule informelles Lernen nutzen?
Schulen können informelle Lernprozesse durch Ganztagsangebote, freiwillige Arbeitsgemeinschaften und die Anerkennung von außerschulisch erworbenen Zertifikaten (z. B. Gruppenhelferschein) in den Schulalltag integrieren.
Was bedeutet 'non-formales Lernen'?
Non-formales Lernen findet in geplanten Programmen außerhalb des formalen Bildungssystems statt, wie zum Beispiel in Jugendzentren oder bei organisierten Weiterbildungen im Verein.
Wo liegen die Grenzen des informellen Lernens in der Schule?
Die Grenzen liegen oft im starren Lehrplan, dem Leistungsdruck und der Notwendigkeit der Notengebung, was den freiwilligen und interessengeleiteten Charakter des informellen Lernens einschränken kann.
- Citation du texte
- Martina Vögele (Auteur), 2010, Informelles Lernen in der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230778