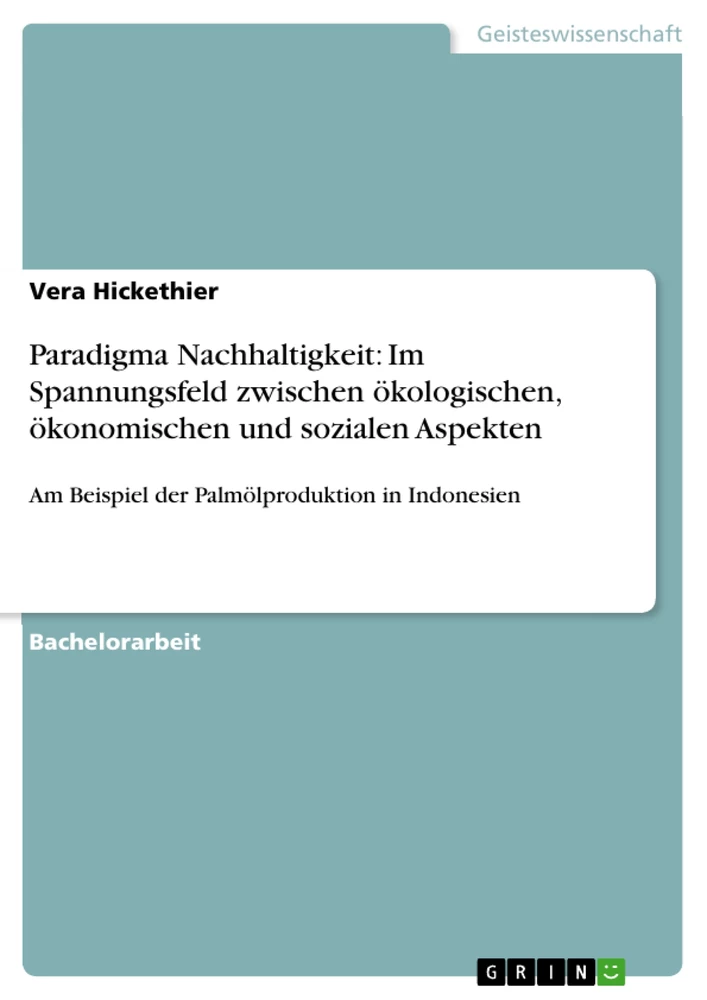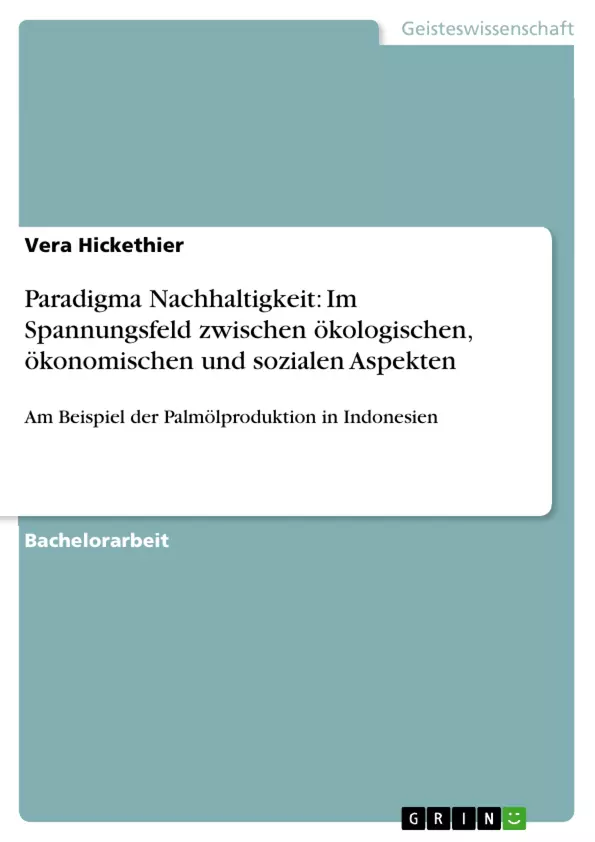„Nachhaltigkeit“ ist ein zunehmend zentralerer Begriff in unserem alltäglichen Leben. Viele Produkte werden als „aus nachhaltiger Produktion“ deklariert und im großen Maße konsumiert. „Nachhaltige Entwicklung“ ist ein weltweit anerkanntes Leitbild in der Politik,Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, welches seit über 60 Jahren in der internationalen Debatte Eingang findet. Gegenwärtig ist die Nachhaltigkeitsdebatte, ausgelöst durch den globalen Klimawandel, so omnipräsent wie noch nie. Palmöl, als nachwachsender Rohstoff, wird dabei als „Schlüssel [im] Kampf“ gegen den globalen Klimawandel und für die Versorgungssicherheit innerhalb der Gemeinschaft gesehen. Doch wie nachhaltig kann beispielsweise eine Palmölproduktion sein, wenn dafür Regenwälder degradiert und Menschen vertrieben werden?
Viele verschiedene Nachhaltigkeitsmodelle wurden in den letzten Dekaden formuliert. Von großer Bedeutung ist hier das Nachhaltigkeitsdreieck nach Carlowitz, welches die Dimensionen einer nachhaltigen Entwicklung vorgibt: Ökologisches Gleichgewicht, ökonomische Sicherheit und soziale Gerechtigkeit. (..)
Diese drei integrativ betrachteten Nachhaltigkeitsdimensionen gelten international als die Grundziele um eine lebenswerte Existenzgrundlage für die Weltgemeinschaft zu schaffen.
Da die Problematik der Nachhaltigkeit kein einfach abgrenzbares policy-Feld ist, sondern ein Querschnittsthema, das andere gesellschaftliche und ökologische Bereiche tangiert, sollen im Folgenden jene komplexen Wechselwirkungen und Prozesse an dem paradigmatischen Beispiel der nachhaltigen Palmölproduktion in Indonesien, dem Land mit der höchsten
Palmöl Produktions- und Exportquote, skizziert und verdeutlicht werden. Kein anderes Thema polarisiert die globale Diskussion so sehr, wie die energetische Verwendung von „Sustainable Palm Oil“ als erneuerbare Ressource. (...)
Dafür wird zunächst der Begriff „Nachhaltigkeit“ nach internationalen Standards erläutert und im wissenschaftlichen Diskurs betrachtet, bevor auf das Drei-Säulen-Modell eingegangen wird, welches die Grundlage für die in dieser Arbeit durchgeführte Analyse darstellt. Anschließend wird der indonesische Palmölsektor hinterfragt, um folglich dessen Ausmaße auswerten zu können. Das Konzept des zertifizierten „Sustainable Palm Oil“ bildet dann den Anstoß für eine kritische Analyse der ökonomischen, sozialen und ökologischen Dimensionen der Palmölproduktion.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einführung
1.1. Heranführung an die Thematik
1.2. Verwendete Quellen
2. Definition von Nachhaltigkeit
2.1. Die Stationen auf dem Weg zur ‚nachhaltigen Entwicklung‘
2.2. „Nachhaltigkeit“ im wissenschaftlichen Diskurs
2.3. Die drei Dimensionen einer nachhaltigen Entwicklung
2.3.1. Die ökologische Dimension
2.3.2. Die ökonomische Dimension
2.3.3. Die soziale Dimension
3. Indonesiens Palmölsektor
3.1. Die Entwicklung der indonesischen Palmölproduktion
3.2. Die relevanten gesellschaftlichen Akteure
4. Palmölproduktion - Wachstumsmarkt mit Nachhaltigkeitsgarantie?
4.1. Globale und lokale Ausmaße der indonesischen Palmölproduktion
4.2. ‚Sustainable Palm Oil‘ - Zertifizierte Nachhaltigkeit?
4.3. Die „Neukonfiguration von (gesellschaftlichen) Naturverhältnissen“
4.3.1. Die ökonomische Dimension- ökonomische Sicherheit
4.3.2. Die soziale Dimension- soziale Gerechtigkeit
4.3.3. Die ökologische Dimension- ökologisches Gleichgewicht
5. Fazit ‚Mehr Schein als Sein‘
6. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit?
Es beschreibt Nachhaltigkeit als Gleichgewicht zwischen drei Dimensionen: ökologisches Gleichgewicht, ökonomische Sicherheit und soziale Gerechtigkeit.
Warum ist die Palmölproduktion in Indonesien umstritten?
Obwohl Palmöl ein effizienter Rohstoff ist, führt seine Produktion oft zur Zerstörung von Regenwäldern, zum Verlust der Biodiversität und zur Vertreibung lokaler Gemeinschaften.
Gibt es wirklich „nachhaltiges“ Palmöl?
Es existieren Zertifikate für „Sustainable Palm Oil“, doch die Arbeit analysiert kritisch, ob diese Standards in der Praxis tatsächlich ökologische und soziale Gerechtigkeit garantieren.
Welche Rolle spielt Palmöl für den Klimawandel?
Palmöl wird einerseits als erneuerbare Energiequelle geschätzt, andererseits setzt die Rodung von Wäldern für Plantagen massive Mengen an CO2 frei.
Was versteht man unter der „Neukonfiguration von Naturverhältnissen“?
Es beschreibt den Prozess, wie gesellschaftliche und politische Akteure die Natur umgestalten, um sie ökonomisch nutzbar zu machen, oft auf Kosten ökologischer Stabilität.
- Quote paper
- Vera Hickethier (Author), 2012, Paradigma Nachhaltigkeit: Im Spannungsfeld zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230810