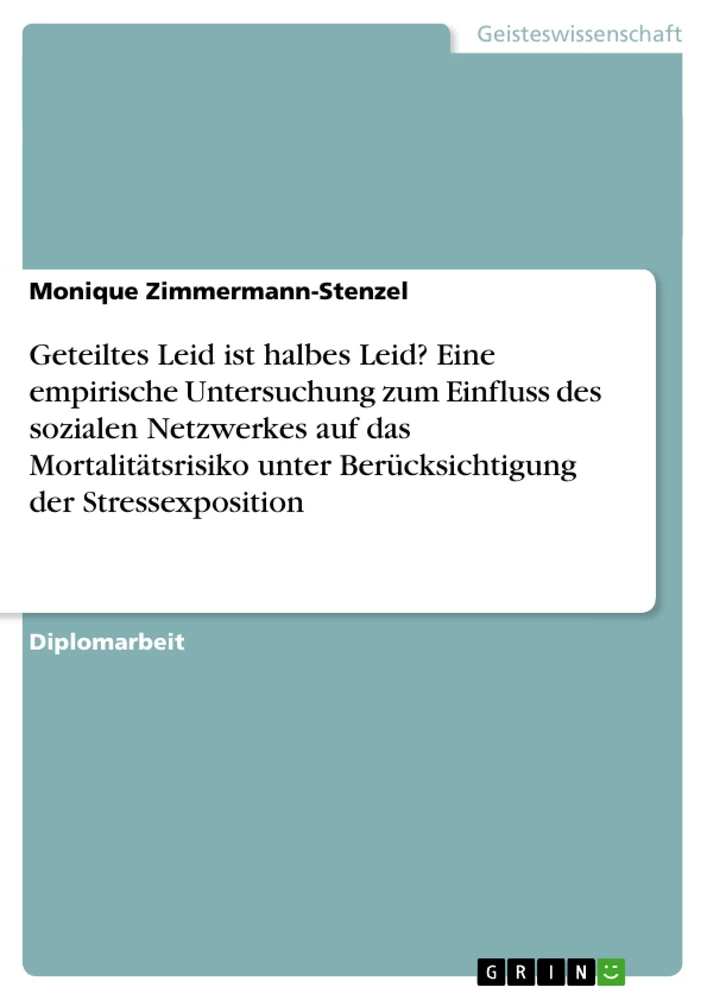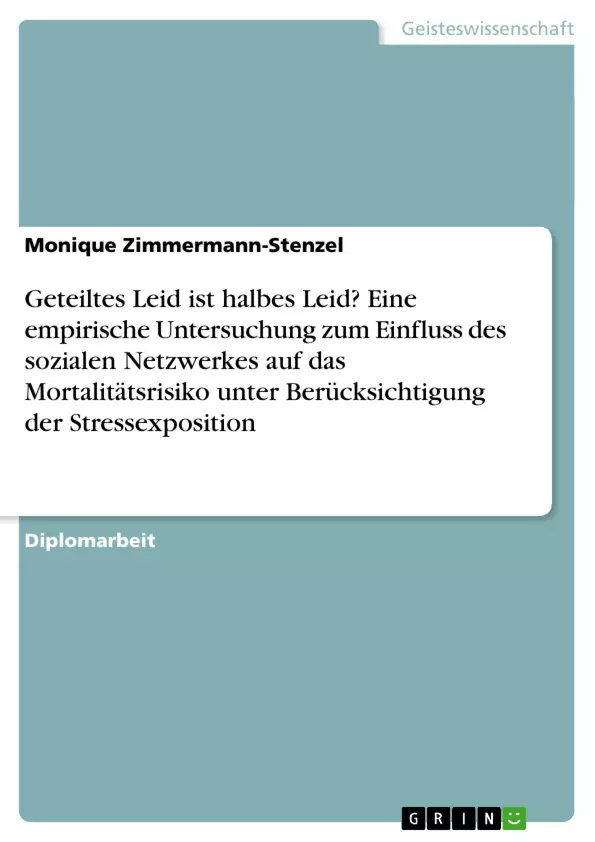Seit einigen Jahrzehnten ist die Rolle des sozialen Netzwerkes in Bezug auf das Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko Gegenstand des Interesses. So ist der Einfluss sozialer Netzwerke sowohl auf die psychische als auch körperliche Gesundheit empirisch belegt. Ebenfalls wurde in internationalen Studien nachgewiesen, dass diese sozialen Netzwerke auch einen Effekt auf das Mortalitätsrisiko ausüben. Demgemäß haben sowohl Alleinlebende als auch einsame und sozial isolierte Personen unter sonst gleichen Bedingungen ein höheres Mortalitätsrisiko als Personen, die sozial integriert sind und über ein großes soziales Netzwerk verfügen.
Gemäß vieler Erhebungen und Befragungen fühlt sich ein großer Anteil von Menschen durch Stress fast täglich belastet. Sowohl alte als auch junge Menschen sind davon im privaten sowie im beruflichen Bereich betroffen: Arbeiter, Angestellte und Manager in Betrieben, Mütter, Polizisten, Krankenschwestern, Ärzte, Lehrer. Kaum ein Beruf ist ausgenommen. Doch ist es für ein Individuum generell eher vorteilhaft, wenn es durch Angehörige der Familie, Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen durch Gespräche und Zuwendungen seelischen Halt und Unterstützung erhält, oder nur während belastenden Lebenssituationen?
Die vorliegenden empirischen Analysen bestätigen -unter Berücksichtigung der Differenzierung zwischen funktionalem, strukturellem Netzwerk und dem Social Network Index nach Berkman - die mortalitätsreduzierende Wirkung sozialer Beziehungen. Bemerkenswert ist, dass soziale Beziehungen einen mortalitätssenkenden Effekt aufweisen unabhängig von Stress bzw. sozialen Belastungen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG.
- EINFÜHRUNG IN DIE THEMATIK.
- FRAGESTELLUNG UND AUFBAU DER ARBEIT.
- THEORETISCHER FORSCHUNGSSTAND.
- DIE DIREKTEFFEKT-THESE: BEZIEHUNGEN UND SOZIALE NETZWERKE ALS EINFLUSSFAKTOREN DES MORTALITÄTSRISIKOS.
- Inhaltliche Typologie sozialer Unterstützung.
- Merkmale und Qualität von Beziehungen und Netzwerken
- STRESS ALS EINFLUSSFAKTOR DES MORTALITÄTSRISIKOS
- DIE PUFFEREFFekt-These: soziale NetzwerKE UND STRESS ALS INTERAGIERENDE EINFLUSSFAKTOREN DES MORTALITÄTSRISIKOS
- Wahrnehmung von Stress als Belastung.
- Umgang mit Stress.
- Ansatzpunkte sozialer Unterstützung in stressvollen Situationen
- ZUSAMMENFASSUNG.
- EMPIRISCHER FORSCHUNGSSTAND
- STAND DER FORSCHUNG HINSICHTLICH SOZIALER NETZWERKE ALS EINFLUSSFAKTOREN DES MORTALITÄTSRISIKOS (DIirekteffekt-TheSE).
- STAND DER FORSCHUNG HINSICHTLICH SOZIALER NETZWERKE UND STRESS ALS INTERAGIERENDE EINFLUSSFAKTOREN DES MORTALITÄTSRISIKOS (PUFFEREFFEKT-THESE).
- ZUSAMMENFASSUNG.
- DATEN UND METHODE
- DATENGRUNDLAGE UND DATENBESCHRÄNKUNG
- OPERATIONALISIERUNGEN.
- METHODEN
- EMPIRISCHE ERGEBNISSE
- DESKRIPTIVE ANALYSE.
- Überlebensstatus nach vorhandenen Netzwerkressourcen
- Überlebensstatus nach der Stressexposition
- Überlebensstatus nach vorhandenen Netzwerkressourcen und Stressexposition.
- ERGEBNISSE DER EREIGNISDATENANALYSE.
- Der Einfluss von Netzwerkstrukturen und Stress auf das Mortalitätsrisiko und die empirische Überprüfung der Direkteffekt-These
- Der Einfluss der Interaktionen von Netzwerken und Stress auf das Mortalitätsrisiko und die empirische Überprüfung der Puffereffekt-These
- DISKUSSION.
- ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss sozialer Netzwerke auf das Mortalitätsrisiko unter Berücksichtigung der Stressexposition. Sie zielt darauf ab, die Direkteffekt- und Puffereffekt-Thesen empirisch zu überprüfen. Dabei soll geklärt werden, ob soziale Netzwerke unabhängig von Stress einen positiven oder negativen Einfluss auf die Mortalität haben (Direkteffekt-These) und ob soziale Netzwerke als Puffer in stressvollen Situationen wirken und so das Mortalitätsrisiko reduzieren können (Puffereffekt-These).
- Einfluss von sozialen Netzwerken auf das Mortalitätsrisiko
- Stressexposition als Einflussfaktor der Mortalität
- Empirische Überprüfung der Direkteffekt-These
- Empirische Überprüfung der Puffereffekt-These
- Interaktion von sozialen Netzwerken und Stress auf das Mortalitätsrisiko
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und erläutert die Fragestellung sowie den Aufbau der Arbeit. Das zweite Kapitel beleuchtet den theoretischen Forschungsstand zu den beiden zentralen Thesen - der Direkteffekt- und der Puffereffekt-These - und stellt die relevanten Forschungsarbeiten zu sozialen Netzwerken, Stress und deren Einfluss auf das Mortalitätsrisiko vor. Das dritte Kapitel analysiert den empirischen Forschungsstand und beleuchtet die Ergebnisse relevanter Studien zu den beiden Thesen. Das vierte Kapitel beschreibt die Datengrundlage und die methodischen Vorgehensweisen der Arbeit. Kapitel fünf präsentiert die deskriptiven und ereignisdatenanalytischen Ergebnisse der Untersuchung und analysiert die Einflüsse von sozialen Netzwerken, Stress und deren Interaktion auf das Mortalitätsrisiko. Die Diskussion der Ergebnisse erfolgt im sechsten Kapitel, während das siebte Kapitel die Arbeit zusammenfasst und einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfelder gibt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themenbereiche soziale Netzwerke, Stress, Mortalitätsrisiko, Direkteffekt-These, Puffereffekt-These, empirische Forschung, Ereignisdatenanalyse. Die Ergebnisse der Arbeit sollen Erkenntnisse über den Einfluss von sozialen Netzwerken und Stress auf die Lebenserwartung liefern und die theoretischen Modelle der Direkteffekt- und Puffereffekt-Thesen empirisch validieren.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen soziale Netzwerke das Mortalitätsrisiko?
Empirische Studien zeigen, dass sozial integrierte Personen mit großen Netzwerken ein geringeres Mortalitätsrisiko haben als sozial isolierte oder einsame Menschen.
Was besagt die Direkteffekt-These?
Die Direkteffekt-These postuliert, dass soziale Beziehungen und Netzwerke unabhängig von vorhandenem Stress einen positiven, mortalitätssenkenden Effekt auf die Gesundheit haben.
Was versteht man unter der Puffereffekt-These?
Die Puffereffekt-These besagt, dass soziale Netzwerke vor allem in stressvollen Lebenssituationen als Schutzfaktor wirken und die negativen Auswirkungen von Stress auf die Sterblichkeit abmildern.
Welche Rolle spielt Stress in dieser Untersuchung?
Stress wird als zentraler Einflussfaktor auf das Mortalitätsrisiko betrachtet, wobei untersucht wird, wie er mit sozialen Ressourcen interagiert.
Was sind die zentralen Ergebnisse der empirischen Analyse?
Die Analysen bestätigen die mortalitätsreduzierende Wirkung sozialer Beziehungen, die bemerkenswerterweise oft unabhängig von der Stressexposition auftritt.
Welche methodischen Ansätze wurden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit nutzt deskriptive Analysen sowie die Ereignisdatenanalyse, um den Einfluss von Netzwerkstrukturen und Stress auf das Überleben zu prüfen.
- Quote paper
- Dr. Monique Zimmermann-Stenzel (Author), 2002, Geteiltes Leid ist halbes Leid? Eine empirische Untersuchung zum Einfluss des sozialen Netzwerkes auf das Mortalitätsrisiko unter Berücksichtigung der Stressexposition, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23082