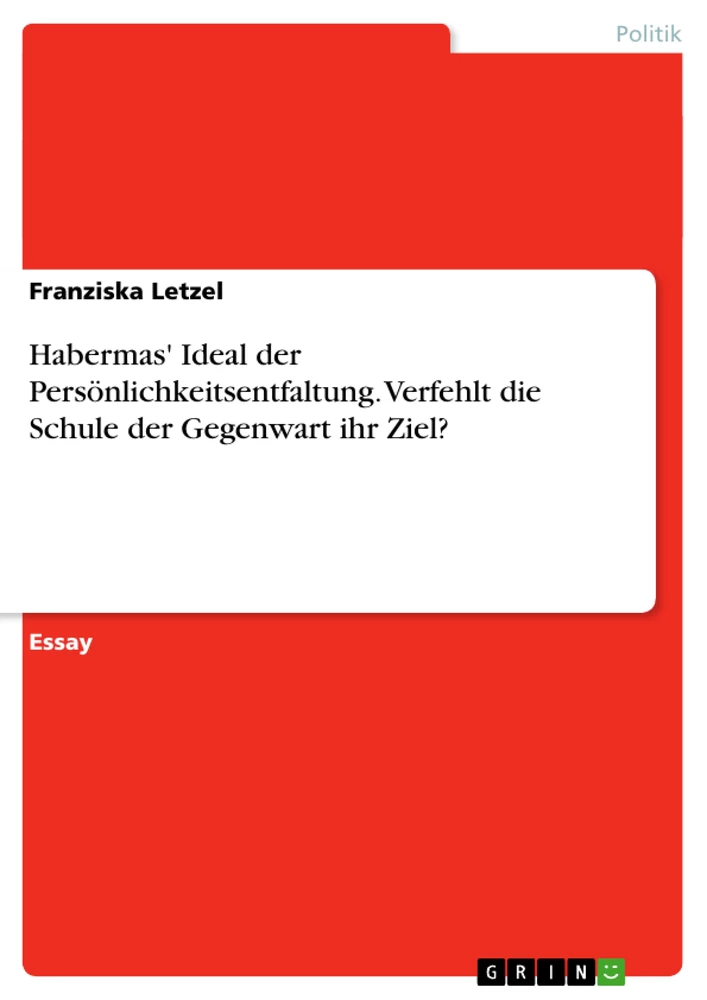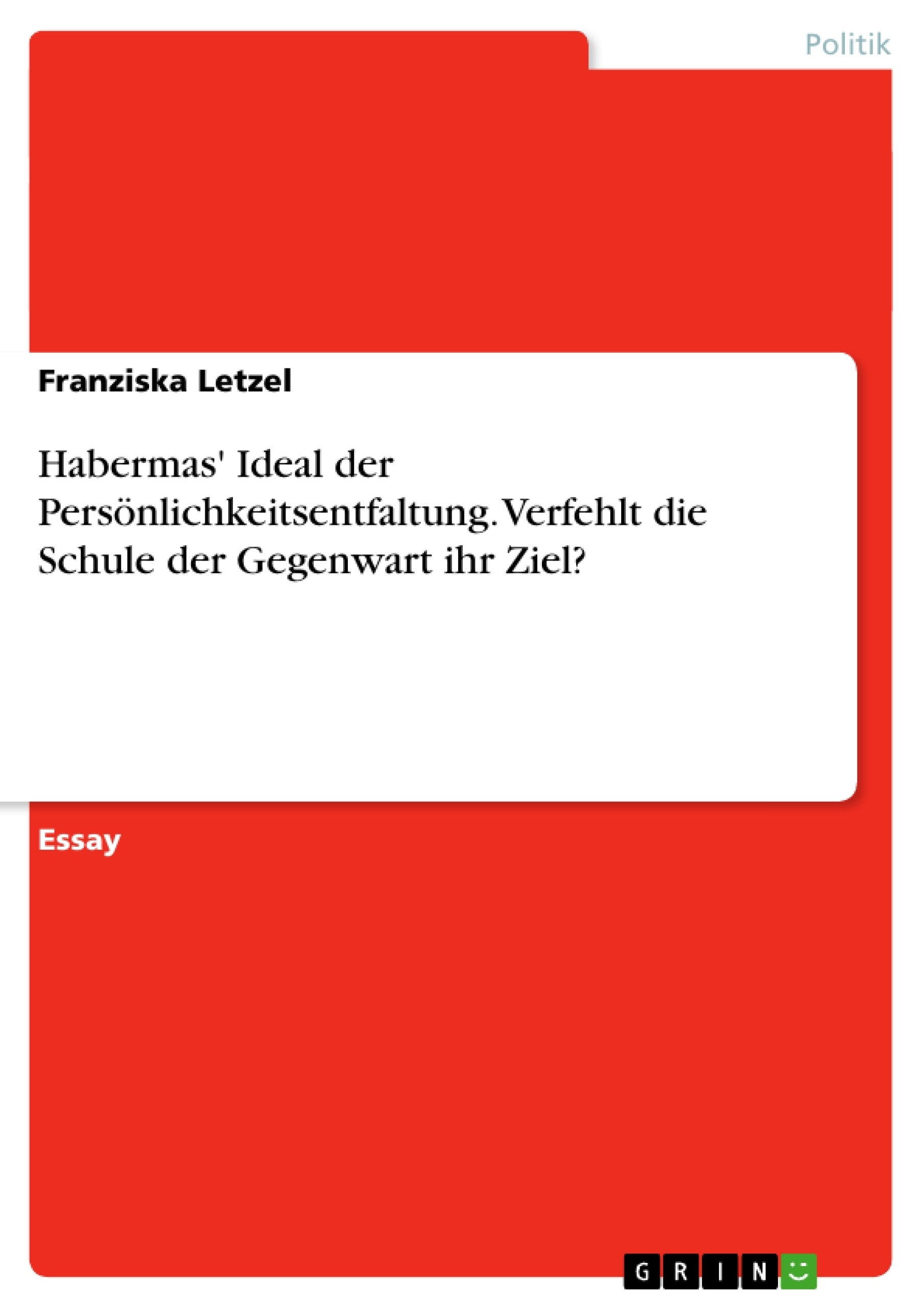Ein bedeutender Teil des Sozialisationsprozesses eines Heranwachsenden findet im Rahmen der Bildung und somit in der Institution Schule statt. Diese leistet neben den Eltern und dem Freundeskreis (Peergroup) einen entscheidenden Beitrag zur Sozialisation des Kindes und damit auch zur Persönlichkeitsentfaltung des Einzelnen. Ihre Wirkung auf den Schüler und dessen Identitätsfindung wird seit jeher stark diskutiert und bildet einen deutlichen Schwerpunkt sowohl in der pädagogischen Forschung der Gegenwart, als auch in diskursiven Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit. Vielfach werden kritische Stimmen laut, die behaupten, die Instanz Schule würde die Kinder und Jugendlichen in ihrer freien Persönlichkeitsentfaltung nicht hinreichend unterstützen, die Wirklichkeit nicht ausreichend vielschichtig und kontrovers darstellen und die Heranwachsenden in ihrer Entwicklung so in eine ganz bewusste Richtung lenken.
Einen Verweis auf diese Diskussion lässt sich auch in Jürgen Habermas‘ Theorie der Sozialisation finden. Habermas‘ Bildungsauftrag an die Schule kann man wie folgt konkretisieren:
Die Schule soll ein Ort kommunikativen Handelns sein, in der die Ausbildung der Ich-Identität gefördert wird. Es gilt eine Schule zu schaffen, in der prinzipiengeleitetes Denken gefördert und verständigungsorientiertes Handeln trainiert wird. Sie soll Rollen- und Normsysteme der Gesellschaft vermitteln (Ausbildung der Rollenidentität), die Schüler aber gleichzeitig dazu befähigen, sich ihnen gegenüber zu behaupten und sie kritisch zu hinterfragen (Ausbildung der Ich-Identität).
An diesem Punkt stellt sich nun die Frage, ob die Schule der Gegenwart den Bildungsauftrag erfüllt, der ihr von Habermas‘ auferlegt wird oder verfehlt sie gar ihr Ziel, den Schülern eine freie Persönlichkeitsentfaltung im Habermas’schen Sinne zu gewährleisten?
Die Beantwortung dieser Fragestellung ist Gegenstand dieses Essays.
„Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, das Kind zu formen,
sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren.“
Maria Montessori (1870-1852), italienische Ärztin und Pädagogin
Als Vertreterin der deutschen Reformpädagogik nimmt Maria Montessori Bezug auf einen Kerngedanken der Sozialisationstheorie: Neben der Komponente der Vergesellschaftung, in der sich der Heranwachsende durch die Übernahme von Verhaltensweisen, Normen und Werten zu einem aktiven Mitglied der Gesellschaft entwickelt, beinhaltet die Sozialisation eben immer auch einen Prozess der Individuierung: Der Heranwachsende entfaltet und formt seine individuelle Identität, übernimmt Werte und Normen oder grenzt sich von ihnen ab – in der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt findet er sich selbst.
Ein bedeutender Teil dieses Prozesses findet im Rahmen der Bildung und somit in der Institution Schule statt. Diese leistet neben den Eltern und dem Freundeskreis (Peergroup) einen entscheidenden Beitrag zur Sozialisation des Kindes und damit auch zur Persönlichkeitsentfaltung des Einzelnen. Ihre Wirkung auf den Schüler und dessen Identitätsfindung wird seit jeher stark diskutiert und bildet einen deutlichen Schwerpunkt sowohl in der pädagogischen Forschung der Gegenwart, als auch in diskursiven Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit. Vielfach werden kritische Stimmen laut, die behaupten, die Instanz Schule würde die Kinder und Jugendlichen in ihrer freien Persönlichkeitsentfaltung nicht hinreichend unterstützen, die Wirklichkeit nicht ausreichend vielschichtig und kontrovers darstellen und die Heranwachsenden in ihrer Entwicklung so in eine ganz bewusste Richtung lenken.
Einen Verweis auf diese Diskussion lässt sich auch in Jürgen Habermas‘ Theorie der Sozialisation finden. So skizziert er die Dynamik des Prozesses der Persönlichkeitsentwicklung und bezieht auch die Komponente der individuellen Selbstentfaltung Montessoris in seine Ausführungen mit ein. Ganz konkret präzisiert er sein Verständnis von Sozialisation mittels zweier grundsätzlicher Aspekte:
1. Der demokratische Staat braucht individuierte, selbstständige Bürger, die im Besitz der kommunikativen Kompetenz, also zu kommunikativem Handeln und Diskursen[1] fähig sind.
2. Die Menschen sollen sich als Bürger sowohl in das Rollen- und Normsystem ihrer Gesellschaft einfügen, es jedoch gleichzeitig kritisch hinterfragen und sich diesem nicht unreflektiert unterwerfen.
(vgl. Baumgart 2008: 162).
Um diese Fähigkeiten auszubilden, braucht es nach Habermas die Sozialisation. Deren Kern sieht er in der Ausbildung einer besonderen Form der Ich-Organisation, der sogenannten starken Ich-Identität, die den Höhepunkt der menschlichen Identitätsbildung darstellt und in Folge dessen die genannten Aspekte im Individuum vereinigt. Um dies nachzuvollziehen ist es erforderlich, sich Habermas‘ Stufen der Identitätsbildung vor Augen zu führen.
Er geht davon aus, dass der Mensch von Natur aus eine natürliche Identität besitzt. Diese wird in der Entwicklung des Kindes abgelöst durch die Rollenidentität. Im Verlauf dieses Prozesses eignet sich das Kind umgebende Verhaltensweisen der Familie und Freunde, sowie gesellschaftliche Handlungsnormen und Rollenerwartungen an: Es erkennt und übernimmt seine Rolle innerhalb der Gesellschaft. Diese Rollenidentität wird schließlich in der Phase der Adoleszenz abgelöst durch die Ich-Identität, indem der Heranwachsende lernt, seine eigene Persönlichkeit gegenüber Rollenerwartungen und Normsystemen zu behaupten.
(vgl. Baumgart 2008: 162f.)
Habermas‘ Ich-Identität ist also gekennzeichnet einerseits durch Vergesellschaftung (Vermittlung von Rollen- und Normensystemen; Fähigkeit, den Anforderungen der Gesellschaft zu genügen) und andererseits durch Individuierung (Aufbau einer kritischen Distanz zu den abverlangten Rollen und den geltenden Normen; kritisches Hinterfragen/Überprüfen der verinnerlichten gesellschaftlichen Normen) (vgl. Habermas 1976: 69).
Die Schule hat neben den Eltern und der Peergroup einen wichtigen Beitrag zu leisten zur Ausbildung der Ich-Identität des Heranwachsenden und somit zu einer gelungenen Sozialisation. Habermas‘ Bildungsauftrag an die Schule kann man deshalb wie folgt konkretisieren:
Die Schule soll ein Ort kommunikativen Handelns sein, in der die Ausbildung der Ich-Identität gefördert wird. Es gilt eine Schule zu schaffen, in der prinzipiengeleitetes Denken gefördert und verständigungsorientiertes Handeln trainiert wird. Sie soll Rollen- und Normsysteme der Gesellschaft vermitteln (Ausbildung der Rollenidentität), die Schüler aber gleichzeitig dazu befähigen, sich ihnen gegenüber zu behaupten und sie kritisch zu hinterfragen (Ausbildung der Ich-Identität).
An diesem Punkt stellt sich nun die Frage, ob die Schule der Gegenwart den Bildungsauftrag erfüllt, der ihr von Habermas‘ auferlegt wird oder verfehlt sie gar ihr Ziel, den Schülern eine freie Persönlichkeitsentfaltung im Habermas’schen Sinne zu gewährleisten?
Nach eingehender Prüfung der unterschiedlichen Positionen, die zu der Thematik einzunehmen sind, komme ich zu der Ansicht, dass sich durchaus feststellen lässt, dass die heutige Schule die Anforderungen erfüllt, die von Habermas im Sinne der Persönlichkeitsentfaltung der Schüler an sie herangetragen werden. Um dies zu belegen, werde ich mich im Folgenden auf die drei zentralen Aspekte beziehen, die Habermas als Bedingungen für eine gelungene Sozialisation anführt, und untersuchen, inwiefern die Schule der Gegenwart diese Bedingungen erfüllt.
[...]
[1] Unter „kommunikativem Handeln“ versteht Habermas das soziale, auf Verständigung ausgerichtete Handeln. Es stellt das durch Sprache vermittelte Handeln dar und ist im Gegensatz zum „strategischen Handeln“ nicht zweckrational.
Unter „Diskurs“ als Sonderform des kommunikativen Handelns versteht Habermas die analytische Diskussion von Geltungsansprüchen mit dem Ziel, einen Konsens zu erzielen. (vgl. Habermas 1971: 114ff.)
Häufig gestellte Fragen
Was ist Habermas’ Ideal der Ich-Identität?
Die starke Ich-Identität vereint die Fähigkeit, sich in gesellschaftliche Rollen einzufügen (Vergesellschaftung), mit der Fähigkeit, diese kritisch zu hinterfragen (Individuierung).
Welchen Bildungsauftrag hat die Schule laut Habermas?
Schule soll ein Ort „kommunikativen Handelns“ sein, der prinzipiengeleitetes Denken und verständigungsorientiertes Handeln fördert.
Verfehlt die moderne Schule ihr Ziel der Persönlichkeitsentfaltung?
Der Essay untersucht kritische Stimmen und kommt zu dem Schluss, dass die heutige Schule die Anforderungen an eine gelungene Sozialisation im Habermas’schen Sinne durchaus erfüllt.
Was unterscheidet kommunikatives von strategischem Handeln?
Kommunikatives Handeln zielt auf gegenseitige Verständigung ab, während strategisches Handeln zweckrational ist und einen eigenen Vorteil verfolgt.
Was sind die Stufen der Identitätsbildung nach Habermas?
Der Prozess verläuft von der natürlichen Identität über die Rollenidentität bis hin zur ausgereiften Ich-Identität in der Adoleszenz.
- Arbeit zitieren
- Franziska Letzel (Autor:in), 2013, Habermas' Ideal der Persönlichkeitsentfaltung. Verfehlt die Schule der Gegenwart ihr Ziel?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230915