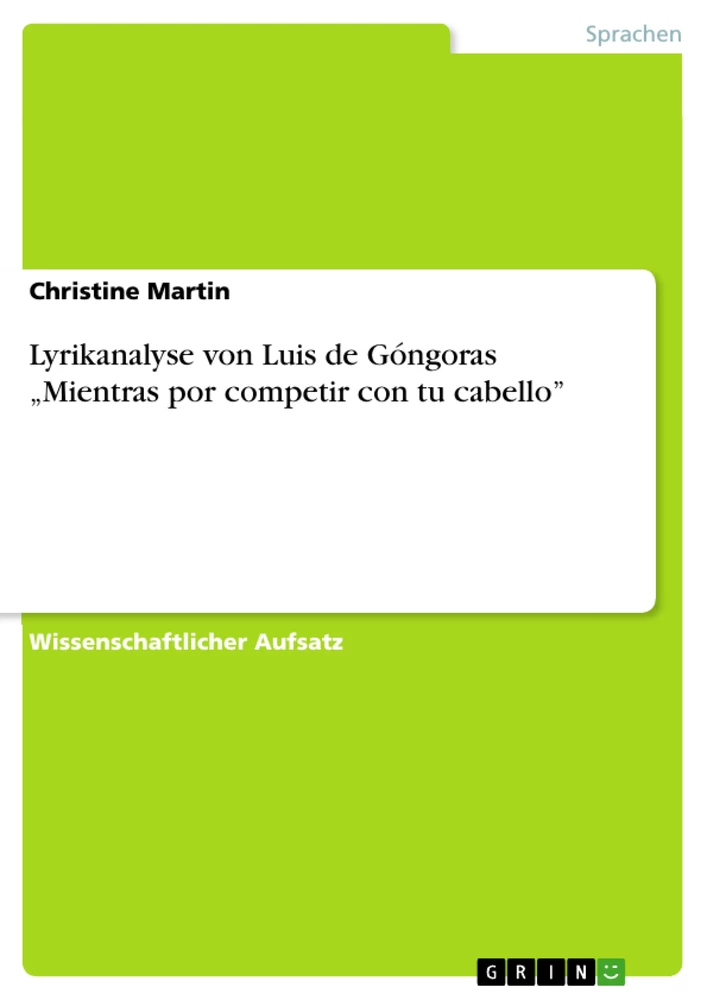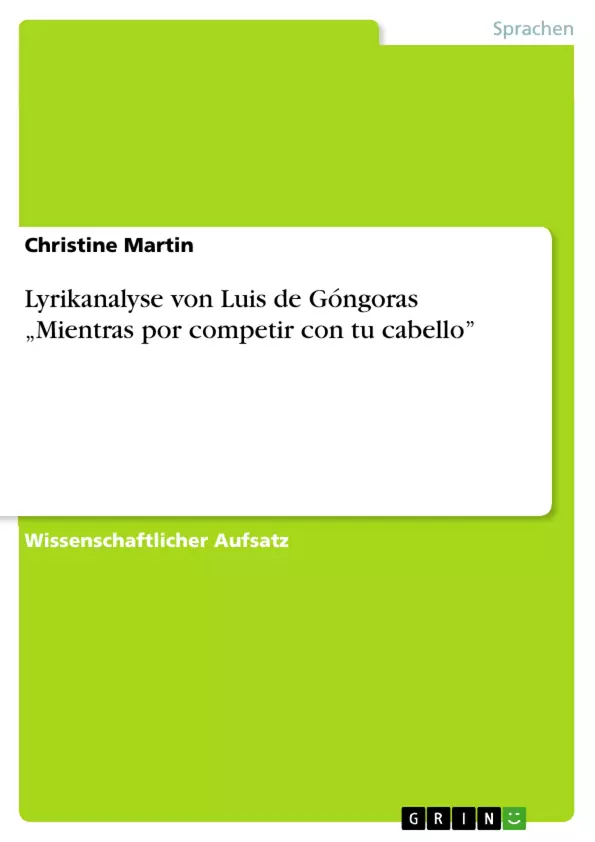Im Folgenden wird das Gedicht bezüglich pragmatischer, semantischer und syntaktisch-phonologischer Aspekte analysiert. Anschließend wird das Werk in den historischen Kontext und in das Gesamtwerk des Autors eingeordnet.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Analyse von Luis de Góngoras „Mientras por competir con tu cabello”
2.1 Pragmatische Ebene
2.2 Semantische Ebene
2.3 Syntaktische/ Phonologische Ebene
2.4 Einordnung in den historischen Kontext
3. Fazit
4. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
In seinem Sonett „Mientras por competir con tu cabello” greift der Barocklyriker Luis de Góngora (1561-1627) die Thematik auf, die bereits Garcilosa de la Vega in seinem Sonett „En tanto que de rosa y d´azucena“ behandelt hat. Als einer der wichtigsten Vertreter des Siglo de Oro dient sein Gedicht schließlich der Dichterin Sor Juana Inés de la Cruz wiederum als Vorlage. Durch seinen eigenen Stil sticht Luis de Góngora aus der Masse hervor. „Mientras por competir con tu cabello“ ist folglich nur eines seiner bekannten Werke. Góngora stellt in diesem Gedicht die Schönheit einer Frau und ihre Vergänglichkeit in den Mittelpunkt (vgl. Strosetzki 2003: 78-80).
Im Folgenden wird nun das Gedicht bezüglich pragmatischer, semantischer und syntaktisch-phonologischer Aspekte analysiert. Anschließend wird das Werk in den historischen Kontext und in das Gesamtwerk des Autors eingeordnet.
2. Analyse von Luis de Góngoras „Mientras por competir con tu cabello”
Die Analyse des Gedichts lässt sich zunächst unterteilen in verschiedene Ebenen: Die pragmatische, die semantische und zuletzt die syntaktische und phonologische Ebene dienen der Analyse des Inhalts. Zuletzt wird Bezug genommen auf den historischen Kontext und das Wirken des Autors zu seiner Zeit.
2.1 Pragmatische Ebene
Bezüglich der Sprechsituation des Gedichtes sei zunächst erwähnt, dass die Personaldeixis in den Vordergrund tritt. Der Text richtet sich explizit an ein lyrisches Du, das mehrmals direkt mit dem Personalpronomen „tú“ (Velten Varcárcel 1990: S.196 V. 131 ) angesprochen wird. Die Verwendung von Possesivpronomen ist ein weiterer Hinweise auf das lyrische Du, wie beispielsweise „tu cabello“ (V. 1), „tu gentil cuello“ (V. 8) oder „tu edad“ (V. 10). Der fiktive Sprecher ist linguistisch zwar nicht fassbar, jedoch wird durch die direkte Anrede des lyrischen Du auf die Existenz eines lyrischen Ich hingewiesen. Dieses tritt jedoch nicht in Erscheinung. Bezüglich des Geschlechts des Sprechers lässt sich feststellen, dass es sich um einen Mann handelt, der eine Frau anspricht, das lyrische Du.
In Bezug auf die Temporaldeixis steht die Sprechsituation zum Sprechgegenstand in einem Verhältnis der Gleichzeitigkeit. In diesem Fall hat die Gleichzeitigkeit eine gnomische Funktion, da das Gedicht einen allzeit gültigen Sachverhalt thematisiert, nämlich die Vergänglichkeit.
Des Weiteren spiegelt die Sprechsituation eine konkret-individuelle Situation wieder, da der Sprecher das lyrische Du, eine weibliche Figur, direkt anspricht.
Auf pragmatischer Ebene sei noch auf die Sprechhandlung hinzuweisen. Der Sprecher richtet an das lyrische Du eine Aufforderung, das Leben zu genießen. Dies wird in der dritten Strophe ausgedrückt durch einen Imperativ: „goza“ (V. 9).
2.2 Semantische Ebene
Auf inhaltlicher Ebene ist folgendes Thema von Bedeutung: Das Gedicht handelt von der jugendlichen Schönheit und ihrer Vergänglichkeit.
In den ersten beiden Quartetten steht jeweils die Jugend und Schönheit im Mittelpunkt. Die Verbindung des Textes unter semantischem Aspekt lässt sich unter anderem durch die Isotopien zeigen. Die Isotopien, die im Gedicht vorzufinden sind, stellen einen Zusammenhang her zwischen der Schönheit der Frau mit der Natur. An erster Stelle seien hier die Blumen Lilie und Nelke zu erwähnen, die man mit den Farben Weiß und Rot verbindet. Diese werden in Beziehung zu de (V.5), „cuello“ (V.8). Diese Körperteile werden wiederum verglichen mit den Naturelementen Feld und Sonne.
Im ersten Terzett werden diese Elemente nochmals aufsummiert und es wird ein Vergleich gezogen zwischen den Naturelementen und den vier Körperteilen. Anhanddessen kann man eine Argumentationsstrategie erkennen: Der Sprecher fordert nun das lyrische Du auf, ihre Jugend zu genießen: „goza cuello, cabello, labio y frente“ (V.9). Hier wird das von Horaz geprägte Konzept des „carpe diem” verinnerlicht (vgl. Strosetzki 2003: 77).
In der Schlussstrophe, das sogenannte Decrescendo, werden diese Elemente wieder aufgenommen und in Bezug zu den Vergänglichkeitsymbolen „tierra […] humo […] polvo […] sombro“ (V. 14) gesetzt. Hier ist ein weiteres barockes Konzept vorzufinden, nämlich das Vanitas-Motiv.
Eine Isotopie, die sich durch das ganze Gedicht zieht, ist die Verwendung von Farben. So schimmert zu Beginn das Haar wie „oro bruñido“ (V.2), und die Stirn erscheint in einem klaren Weiß. In der Schlusstrophe wandelt sich das Gold in „plata“ (V.12) und das Weiß verfärbt sich in „víola“ (V.12). In gewisser Weise stehen die Farben in Opposition zueinander und stellen einen Kontrast her zwischen der Jugend, der „juventud“, und dem Alter, spanisch „vejez“.
Bezüglich des inhaltlichen Aufbaus lässt sich feststellen, dass die letzte Strophe eine Opposition zum vorhergehenden Text bildet: Das Gedicht beginnt mit der „belleza“ und der „juventud“ der Frau und endet mit der Vergänglichkeit der Schönheit und der „vejez“. Wie schon erwähnt unterstreicht Góngora folgendes: „memento mori“, „Gedenke, das du sterblich bist“, ein Motiv der Vanitas (vgl. Strosetzki 2003: 79).
Auf der Ebene der Wortbedeutung wird die Jugend durch eine Metapher ebenfalls aufgenommen: „edad dorada“ (V.10). Weitere Metaphern findet man bei der Umschreibung des schönen Körpers der Frau. So wird „cabello“ (V.1) mit „oro“ (V.2) verglichen, ihre „blanca frente“ (V.4) gleicht einer „lilio bello“ (V.4), ihr Hals ist wie ein „cristal luciente“ (V.11) und ihre Lippen werden einer Nelke gleichgesetzt (vgl. V. 5-6).
[...]
1 Die folgenden direkten Zitate aus dem Gedicht sind entnommen aus: Felten, Hans/ Valcárcel, Augustín: Spanische Lyrik von der Renaissance bis zum sp ä ten 19. Jahrhundert.3
Stuttgart: Philipp Reclam jun. GmbH & Co. 1990. S.196
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema von Góngoras Sonett?
Das Gedicht thematisiert die jugendliche Schönheit einer Frau und deren unvermeidliche Vergänglichkeit (Vanitas-Motiv).
Welche literarischen Konzepte werden im Gedicht verarbeitet?
Es vereint das horazische „Carpe Diem“ (Nutze den Tag/Genieße die Jugend) mit dem barocken „Memento Mori“ (Gedenke des Todes) und dem Vanitas-Motiv.
Wie nutzt Góngora Metaphern zur Beschreibung der Schönheit?
Er vergleicht Körperteile mit Naturelementen: Das Haar mit Gold, die Stirn mit Lilien, die Lippen mit Nelken und den Hals mit glänzendem Kristall.
Was bedeutet das „Decrescendo“ am Ende des Gedichts?
In der Schlusszeile werden die Symbole der Vergänglichkeit (Erde, Rauch, Staub, Schatten, Nichts) aneinandergereiht, um die totale Auflösung der Schönheit im Tod darzustellen.
In welchen historischen Kontext gehört Luis de Góngora?
Góngora war einer der bedeutendsten Lyriker des spanischen Barock (Siglo de Oro) und prägte mit seinem komplexen Stil den sogenannten Gongorismus oder Culteranismo.
- Quote paper
- Christine Martin (Author), 2013, Lyrikanalyse von Luis de Góngoras „Mientras por competir con tu cabello”, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230953