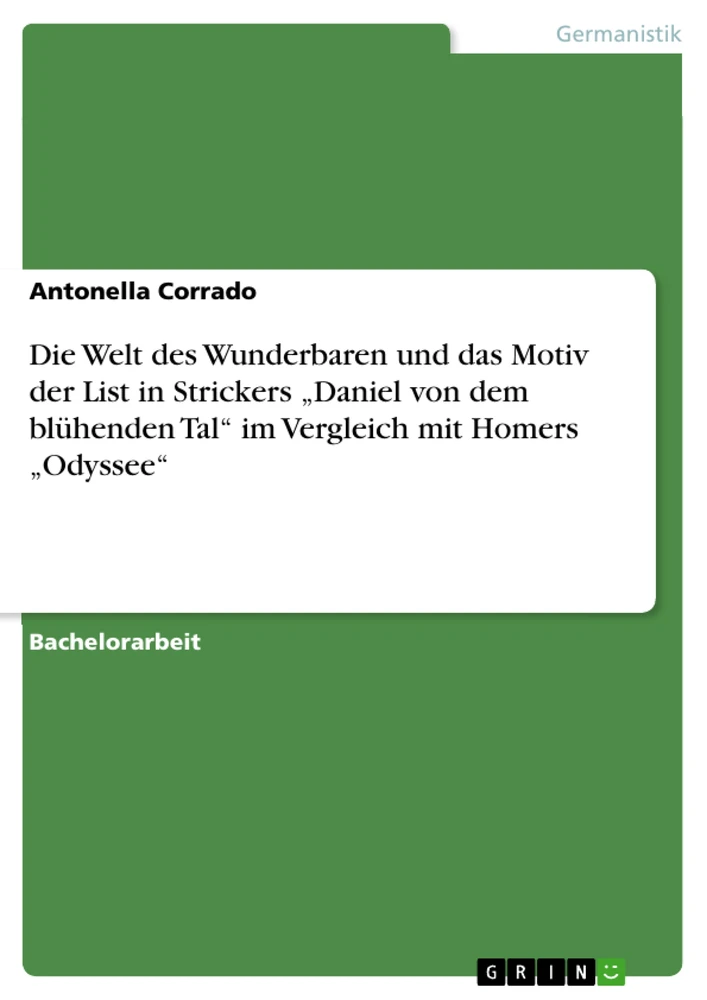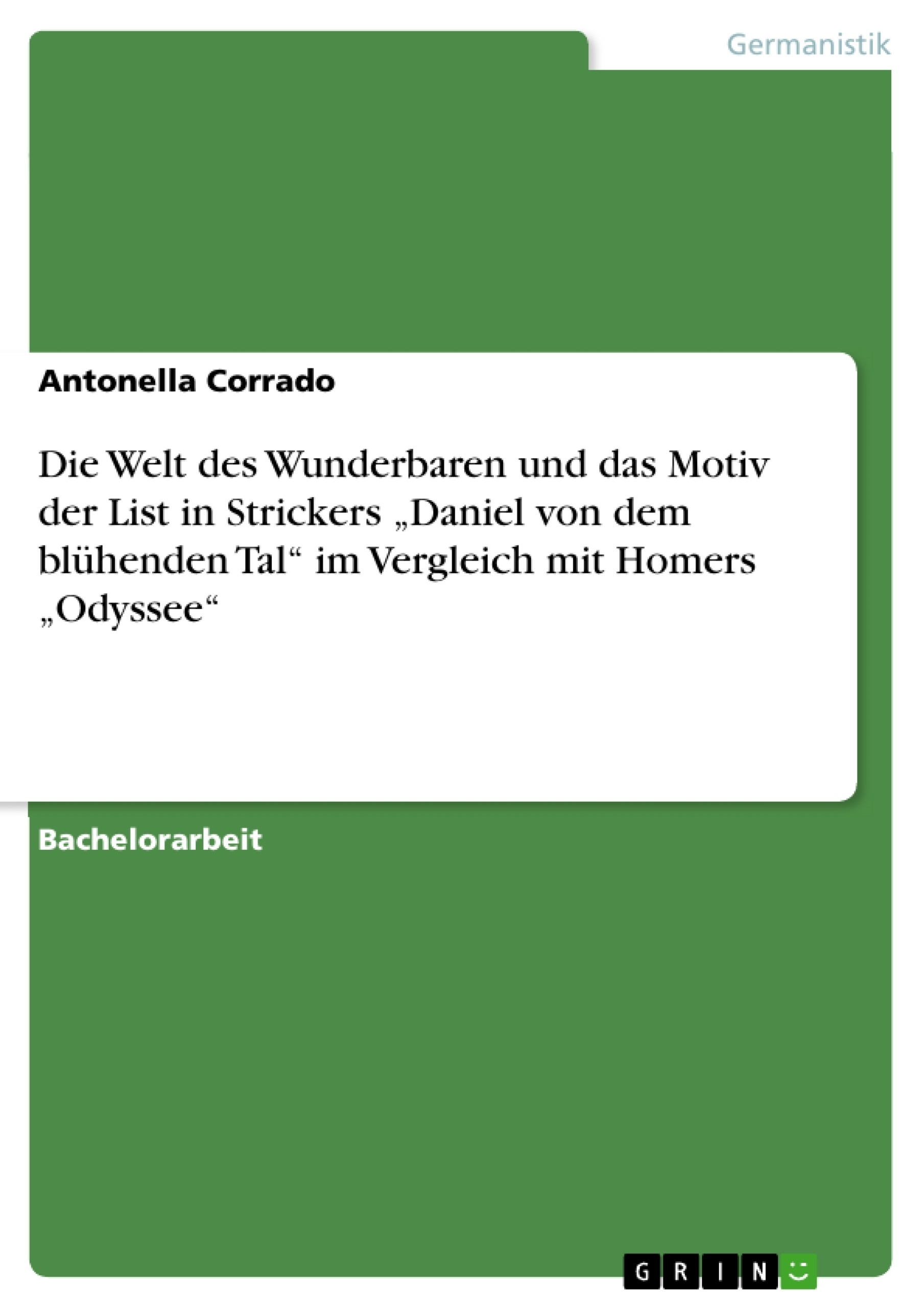Wie stark der Dichter Homer und seine Sagen im Mittelalter präsent waren, ist nicht leicht zu
beantworten. In vielen mittelalterlichen Werken lassen sich immerhin Spuren von Textkenntnissen
auffinden. Unter den Forschern ist es jedoch umstritten, ob die Autoren sich dabei auf den
Originaltext bezogen haben oder nur auf die Sagen, die in der Überlieferung und Bearbeitung über
die Jahrhunderte an sie weitergegeben worden waren.
Im 4. und 5. Jahrhundert wurde Homer noch geschätzt und gelesen, was man unter anderem daran
erkennen kann, dass er in der großen 'Etymologiae' von Isidor von Sevilla (um 560-636)
Erwähnung findet. Erst ab dem frühen Mittelalter sei laut Cornelia Römer ein stetiger Rückgang
„sowohl in Kenntnis als auch in Wertschätzung“ festzustellen. Thomas Bleicher geht davon aus,
dass der Name Homer und der Stoff seiner Epen dem frühen Mittelalter noch weitgehend bekannt
waren, der Text selbst jedoch nicht mehr im Original gelesen wurde. Die Forschungsergebnisse
Georg Finslers sind dem jedoch entgegenzusetzen. Er hat herausgefunden, dass „immerhin […] im
9. Jahrhundert in einzelnen Klosterschulen Griechisch getrieben worden sein [muss].“, da
beispielsweise „Abt Hatto und Erlebald mehrere [Exemplare von Homers Epen] gekauft haben, als
sie als Gesandte Kaiser Karls beim griechischen Kaiser in Konstantinopel weilten“. Demnach
lässt sich schlussfolgern, dass zumindest unter den Klerikern die Lektüre Homers bekannt war.
Im Hochmittelalter sei dann schließlich ein „vorübergehende[r] Verlust der griechischen
Überlieferung des 'Originaltextes'“ festzustellen. Besonders Ovid und Vergil galten nun „als
unangefochtene Autoritäten“, die „zum Kanon der Schulautoren gehörten.“. Ihre Werke wurden
im Gegensatz zu Homers übersetzt. Das absteigende Interesse an Homer und seinen Epen liegt laut
Regina Toepfers vor allem an „fehlende[n] Textvorlagen, mangelnde[n] Sprachkenntnisse[n] und
nicht vorhandene[n] Übersetzungen.“. Grund für die fehlenden Textkenntnisse und die nicht
vorhandenen Übersetzungen, ist laut Römer auch die Angst vor der Kirche gewesen, da die
Christen die griechische Mythologie mit ihrer heidnischen Götterwelt verpönten.[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schluss
- 1. Spuren von Homerkenntnissen beim Stricker
- 1.1. Die Homer-Rezeption im Mittelalter
- 1.2. Strickers mögliche Bezüge zu Homers Epen
- 2. Textanalyse I: Die List
- 3. Textanalyse II: Fabelwesen und magische Gegenstände
- 3.1. Die Fabelwesen
- 3.2. Die magischen Gegenstände
- Anhang
- Literaturverzeichnis
- Bildverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die möglichen Bezugssysteme, aus denen der Stricker für sein Werk "Daniel von dem blühenden Tal" schöpfte, insbesondere im Hinblick auf Homers Epen. Ziel ist es, die Funktion dieser Bezugssysteme innerhalb des Werks aufzuzeigen und die gattungsspezifischen Abweichungen des "Daniel" zu analysieren.
- Die Rezeption Homers im Mittelalter
- Die Rolle der List in Strickers "Daniel"
- Die Funktion von Fabelwesen und magischen Gegenständen
- Die gattungsspezifischen Abweichungen des "Daniel" von klassischen Artusromanen
- Die mögliche Bedeutung der fehlenden Minnethematik im "Daniel"
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Werks ein und beleuchtet die Bedeutung von Fabelwesen und magischen Gegenständen in der Literaturgeschichte, insbesondere in den Homerischen Epen und mittelalterlichen Artusromanen. Die Einleitung stellt den "Daniel" von Stricker als ein Beispiel für einen Artusroman vor, der sich durch seinen Einsatz von Fabelwesen, magischen Gegenständen und dem Motiv der List von anderen Artusromanen abhebt. Die Einleitung gibt einen Überblick über die Forschungslandschaft und die zentralen Fragen, die in der Arbeit behandelt werden.
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Rezeptionsgeschichte der homerischen Epen im Mittelalter. Es wird untersucht, inwieweit der Homer-Stoff den Autoren des 13. Jahrhunderts bekannt war und welche Quellen ihnen zur Verfügung standen. Die Ergebnisse dieses Kapitels bilden die Grundlage für die Analyse der möglichen Bezugssysteme des Strickers.
Das zweite Kapitel analysiert das Motiv der List im "Daniel" und untersucht dessen Funktion im Werk. Es werden exemplarische Figuren aus verschiedenen literaturhistorischen Epochen analysiert, um die Funktion der List im "Daniel" zu beleuchten und die möglichen Bezugsquellen des Strickers aufzuzeigen.
Das dritte Kapitel analysiert exemplarisch die Funktion der Fabelwesen und magischen Gegenstände im "Daniel". Es werden ausgewählte Wesen und Gegenstände vorgestellt und auf ihre mögliche Herkunft hin analysiert, um die möglichen Bezugssysteme des Strickers zu untermauern und die gattungsspezifischen Abweichungen des "Daniel" zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Rezeption von Homers Epen im Mittelalter, dem Motiv der List, Fabelwesen und magischen Gegenständen, gattungsspezifischen Abweichungen, Artusromanen, "Daniel von dem blühenden Tal", Stricker, mittelalterliche Literatur, griechische Mythologie.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurde Homer im Mittelalter rezipiert?
Die Kenntnis der Originaltexte war selten; man bezog sich meist auf lateinische Bearbeitungen oder Sagenstoffe, da Griechischkenntnisse im Westen kaum verbreitet waren.
Was zeichnet Strickers „Daniel von dem blühenden Tal“ aus?
Im Gegensatz zu klassischen Artusromanen nutzt der Protagonist Daniel primär die List (Metis) statt reinem ritterlichem Kampf, um Konflikte zu lösen.
Welche Rolle spielen Fabelwesen im Werk?
Die Arbeit analysiert exotische Wesen und magische Gegenstände, die Daniel begegnen, und vergleicht deren Funktion mit den Ungeheuern aus Homers Odyssee.
Warum gibt es im „Daniel“ keine Minnethematik?
Das Fehlen der klassischen Minne ist eine gattungsspezifische Abweichung, die den Fokus stärker auf die politische Klugheit und die strategische List des Helden legt.
Ist Daniel ein typischer Artusritter?
Nur bedingt. Während er dem Artushof angehört, bricht er ritterliche Konventionen durch den Einsatz von Magie und List, was ihn eher in die Nähe von Odysseus rückt.
- Quote paper
- Antonella Corrado (Author), 2012, Die Welt des Wunderbaren und das Motiv der List in Strickers „Daniel von dem blühenden Tal“ im Vergleich mit Homers „Odyssee“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231057