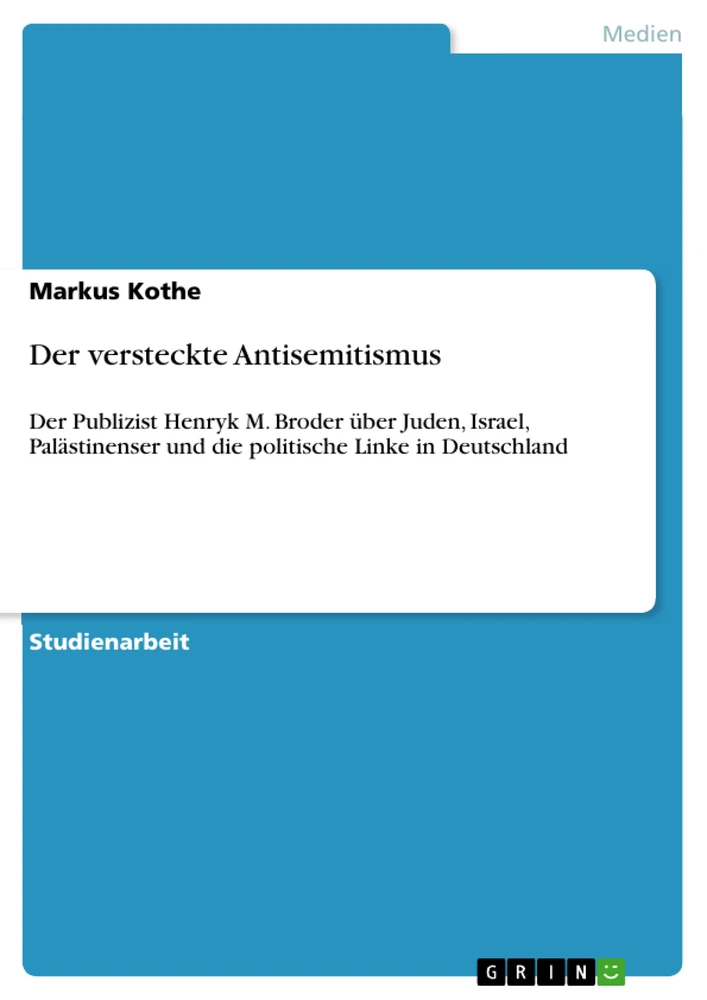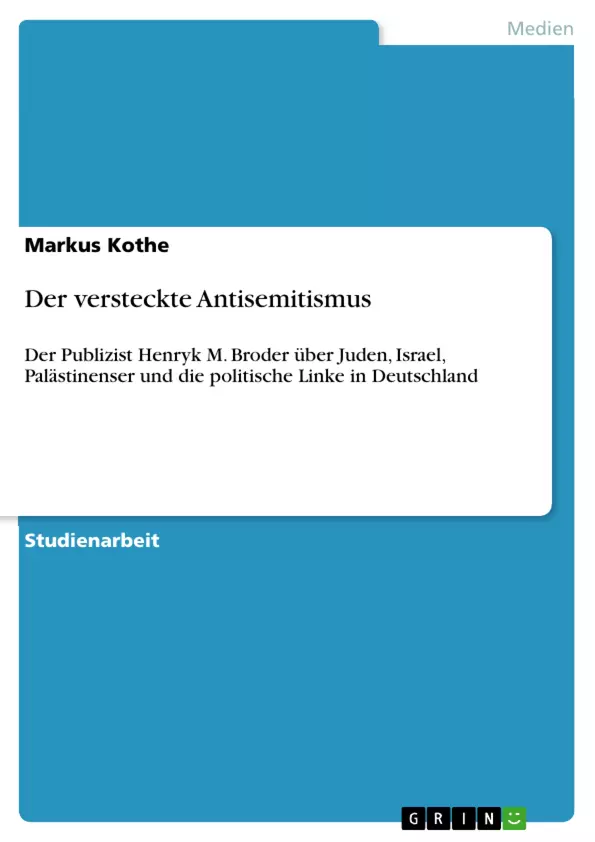Henryk Modest Broder hat es gelernt, Polemik gezielt einzusetzen. Seine Texte haben als markantes Merkmal eine nur selten vorzufindende sophistische Eleganz, eine Eleganz, mit der er Freund wie „Gegner“ gleichermaßen beeindruckt. Broder ist ein Provokateur, er scheut keine Schelte, seine Darstellungen glänzen durch Unausgewogenheit, sind seine subjektive Sicht auf die Dinge. Brigitte Erler charakterisiert ihn als jemanden, der jeden verteufele, der sich nicht der israelischen Mehrheitsmeinung anschließe. Alice Schwarzer nennt Broder einen unverbesserlichen Chauvinisten mit typisch deutschem Verhalten: rigides Schwarzweiß-Denken und ein borniertes Freund-Feind-Muster. Rudolf Augstein äußert sich nicht mehr, zwischen ihm und Broder herrsche Waffenstillstand.
Broder ist aber nicht nur Provokateur, sondern auch Entlarver. Erst durch die Erwähnung in Broderschen Artikeln erfährt so mancher Zeitgenosse, daß er überhaupt ein Antisemit ist. Immer wieder entdeckt Broder in den Deutschen Medien „den deutschen Oberlehrer“, frei nach dem Motto: „Am deutschen Wesen soll die Welt genesen!“ Und doch, bei aller Brisanz seiner Themen, gibt es noch einen anderen Broder: den Ironiker. Broder kann nicht immer ernst bleiben, besonders bei Interviews.
In vorliegender Untersuchung werden zwei seiner Texte sowie ein Interview mit ihm, alle mit Hintergrund Nahost-Konflikt, besprochen. In „Ihr bleibt die Kinder Eurer Eltern“ und „Für Juden gibt es hier keine Normalität“ erklärt Broder, wieso er im Jahre 1981 nach Israel emigrierte, wie er aufwuchs und welche Rolle es in seinem Leben spielte, Eltern zu haben, die Überlebende des Holocaust sind. Er rechnet in diesen beiden Artikeln mit der politischen Linken und der Friedensbewegung in Deutschland ab, weist immer wieder darauf hin, er wolle keine Stellvertreterkriege mehr führen, nicht mehr der Vorzeige-Jude sein. Er könne es nicht verstehen, wie Auschwitz in Deutschland allmählich vergessen wird und die Friedensbewegung im Nahost-Konflikt gegen Israel mobil mache. Seine Anklage: „Nur wie sich Juden in der Nach-Auschwitz-Landschaft angesichts des linken antizionistischen Gebrülls fühlen – diese Frage ist ihnen noch nie in den Sinn gekommen.“ Anhand der „Solidarität“ mit den Palästinensern seitens der Friedensbewegung und der politischen Linken entlarvt er ihre antizionistische und damit antisemitische Grundhaltung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der versteckte Antisemitismus
- „Ihr bleibt die Kinder Eurer Eltern“ und „Für Juden gibt es hier keine Normalität“
- „Unser Kampf“
- Der Naher Osten
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Ansichten des Publizisten Henryk M. Broder zum Nahostkonflikt und seiner Kritik an der politischen Linken in Deutschland.
- Broders Kritik an der deutschen Linken und ihrer Haltung zum Nahostkonflikt
- Der Zusammenhang zwischen Antisemitismus und Antizionismus
- Die Rolle des Holocaust in Broders Argumentation
- Die Legitimität der israelischen Politik
- Die Komplexität des Nahostkonflikts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Henryk M. Broder als Provokateur und Entlarver vor, der mit seinen Texten zum Nahostkonflikt die deutsche Linke kritisiert.
In den Artikeln „Ihr bleibt die Kinder Eurer Eltern“ und „Für Juden gibt es hier keine Normalität“ beschreibt Broder seine Emigration nach Israel im Jahre 1981 und seine Sicht auf die deutsche Gesellschaft.
„Unser Kampf“ befasst sich mit der deutschen Linken und ihrer Position zum Golfkrieg und Israel.
Die Arbeit untersucht den Nahostkonflikt und seine Komplexität, insbesondere die Frage der Legitimität beider Seiten.
Schlüsselwörter
Henryk M. Broder, Antisemitismus, Antizionismus, Nahostkonflikt, Israel, Palästina, Deutsche Linke, Friedensbewegung, Holocaust, Moral, Legitimität.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist Henryk M. Broder und welche Rolle spielt er in der Debatte?
Broder ist ein bekannter Publizist und Provokateur, der für seine scharfe Kritik an der deutschen Linken und seine Entlarvung von verstecktem Antisemitismus bekannt ist.
Was kritisiert Broder an der deutschen Friedensbewegung?
Er wirft ihr vor, unter dem Deckmantel des Antizionismus eine antisemitische Grundhaltung einzunehmen und einseitig gegen Israel mobil zu machen.
Welchen Zusammenhang sieht Broder zwischen Antisemitismus und Antizionismus?
Broder argumentiert, dass moderne Israelkritik oft als Ventil für latenten Antisemitismus dient, indem dem jüdischen Staat das Existenzrecht abgesprochen wird.
Warum emigrierte Broder 1981 nach Israel?
In seinen Texten erklärt er, dass er in Deutschland keine "Normalität" für Juden sah und sich gegen die Rolle als "Vorzeige-Jude" in der Nach-Auschwitz-Landschaft wehrte.
Was ist das Thema von Broders Werk „Unser Kampf“?
Dieses Werk befasst sich kritisch mit der Haltung der deutschen Linken zum Golfkrieg und deren Verhältnis zum Staat Israel.
- Quote paper
- M.A. Markus Kothe (Author), 2002, Der versteckte Antisemitismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231121